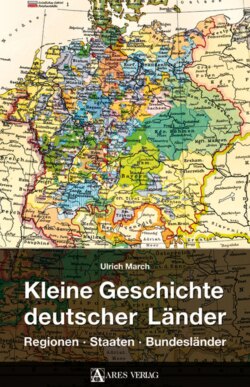Читать книгу Kleine Geschichte deutscher Länder - Ulrich March - Страница 9
3. Ausgewählte Länder und Regionen A. Norddeutscher Aufbruch (Herzogtum Sachsen)
ОглавлениеKurz vor seinem Tod bestimmt der erste deutsche König Konrad I., der politisch auf ganzer Linie gescheitert ist, seinen erbittertsten Gegner, Herzog Heinrich von Sachsen, zu seinem Nachfolger – ein bewundernswerter Akt menschlicher Größe und politischer Weitsicht, denn Heinrich ist nicht nur der mächtigste aller Stammesherzöge, sondern auch ein außerordentlich fähiger Herrscher (919–936). Mit seiner Wahl verlagert sich der Schwerpunkt der deutschen Geschichte nach Norddeutschland; zugleich beginnt ein jahrzehntelang anhaltender Aufstieg des Reiches, dessen staatlicher Zusammenhalt soeben noch am seidenen Faden gehangen hat.
Der neue König, von gewinnendem Auftreten, tritt sein Amt zu einem Zeitpunkt an, als das Reich – bedrängt von dem westfränkischen Teilreich, den Slawen und vor allem den Ungarn, zugleich innerlich zerstritten – praktisch nicht mehr handlungsfähig ist. Angesichts dieser Situation betreibt Heinrich von Anfang an eine Politik des Augenmaßes, verbunden mit Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit. So begnügt er sich zunächst mit einer nominellen Anerkennung durch die Bayern und die Schwaben, ohne allerdings noch vorhandene Reichsrechte in Süddeutschland aufzugeben. 925 gewinnt er in einem günstigen Augenblick die an Westfranken verlorengegangenen Rheinlande zurück. 928/29 erobert er die politischen Zentren der Elb-Oder-Slawen, Brandenburg und Meißen. 933 schlägt er die den Zeitgenossen unüberwindbar scheinenden Ungarn bei Riade an der Unstrut und verschafft damit dem Königtum auch in Süddeutschland Respekt und Anerkennung.
Sein Sohn Otto der Große (936–973) kann seine Politik daher von viel sichererer Basis aus betreiben. Er erobert das gesamte Elb-Oder-Gebiet, vereinigt Deutschland und Italien, beseitigt durch seinen Sieg auf dem Lechfeld (955), an dem alle deutschen Stämme beteiligt sind, endgültig die Ungarngefahr, schafft ein funktionsfähiges Regierungssystem, betreibt Missionspolitik in großem Stil und wird schließlich – in der Nachfolge Karls des Großen und der antiken Cäsaren – zum römischen Kaiser gekrönt (962).
Ganz Norddeutschland hat diese politischen Erfolge der heimischen Dynastie, errungen zum guten Teil mit Kräften des Herzogtums Sachsen, als Aufstieg in schwindelnde Höhen erlebt. Nur gut hundert Jahre zuvor war man in einem der längsten und brutalsten Kriege der europäischen Geschichte von Karl dem Großen niedergeworfen und gewaltsam christianisiert worden. Jetzt treten die Besiegten von damals das Erbe des Siegers an und führen einen der Nachfolgestaaten des karolingischen Großreichs zu neuer Blüte.
Die damals besonders im Norden des Reiches herrschende Aufbruchstimmung geht vor allem aus den Schriften Widukinds von Corvey, Roswithas von Gandersheim und Thietmars von Merseburg hervor. In Roswithas Lebensbeschreibung der Königin Mathilde feiert diese ihren Gemahl Heinrich als Errichter eines Reiches des Friedens und der Freiheit. Die Sachsen genössen „gar hohe Ehren – sie, denen niemals zuvor eine so außerordentliche Vorrangstellung beschieden war. O Deutschland!“, fährt die Autorin fort, „Du einst unter das Joch anderer Völker gebeugt, jetzt aber in kaiserlichem Schmuck, liebe den König … und halte beharrlich fest an dem Wunsch, daß Dir nie ein Regent aus jenem Geschlecht fehlen möge!“
Das Wort „kaiserlich“ trifft in der Sache nicht zu, da Heinrich I. niemals Kaiser war; es kennzeichnet aber die subjektive Einschätzung seiner Herrschaft durch die Zeitgenossen. In vergleichbarer Weise läßt Widukind von Corvey, dem die tatsächlichen Zusammenhänge zweifellos bekannt sind, die deutschen Truppen nach der Ungarnschlacht auf dem Lechfeld König Otto zum „Kaiser“ ausrufen, obgleich er diese Würde erst sieben Jahre später in Rom erhält.
Heinrich fühlt sich noch weitgehend als sächsischer Herzog, während Otto, um sich für seine überregionalen Aufgaben zu entlasten, mit der Inthronisierung Hermann Billungs eine neue Herzogsdynastie begründet. Über die Gemahlin und über eine Tochter Lothars von Supplinburg (König von 1125 bis 1138) verbindet sich die neue Dynastie schließlich mit den Welfen, so daß diese die beiden mächtigsten deutschen Stammesherzogtümer, Bayern und Sachsen, unter ihrer Herrschaft vereinigen und damit erstmals eine starke politische Verklammerung zwischen Nord- und Süddeutschland herbeiführen.