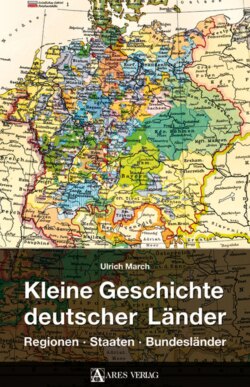Читать книгу Kleine Geschichte deutscher Länder - Ulrich March - Страница 15
E. Königsland am Rhein (Nördliche Oberrhein-Region)
ОглавлениеDas Einzugsgebiet des Rheins ist seit jeher eine völkerverbindende Region gewesen, der Strom selbst ist nicht nur im Bewußtsein der unmittelbaren Anwohner tief verankert. Schon in frühgeschichtlicher Zeit bietet sich hier die Möglichkeit, die verkehrsfeindliche Mittelgebirgsschwelle in Nord-Süd-Richtung zu überwinden. Vom Oberlauf des Rheins aus sind die nach Italien führenden Alpenpässe zu erreichen, auf dem Weg über die Burgundische Pforte auch das Rhônetal, das für den Nord-Süd-Verkehr bis heute eine ähnliche Bedeutung hat.
An zwei Stellen, am Nord- und am Südrand des Rheinischen Schiefergebirges, kreuzen bedeutende Ost-West-Verbindungen die Rheinschiene. Es ist kein Zufall, daß die Schwerpunkte bereits der römischen Aktivität im Raum Xanten – Köln einerseits, in Mainz andererseits gelegen haben, von hier aus hat man versucht, lippe- und mainaufwärts in das Innere Germaniens vorzudringen. Später folgen die Fernverbindungen Paris – Metz – Frankfurt – Leipzig und Köln – Hannover – Magdeburg – Berlin diesen Trassen, so daß die Kreuzungspunkte schon aus verkehrsgeographischen Gründen stets ihre Bedeutung behalten haben.
Erben der Römer im nördlichen Oberrheingebiet sind zunächst die Burgunder, die hier zu Beginn des 5. Jahrhunderts ein Reich mit der Hauptstadt Worms errichten. An diese Zeit erinnert noch das Nibelungenlied, dessen erster Teil in Worms spielt. Auch der im zweiten Teil geschilderte Untergang der Burgunder hat insofern einen historischen Kern, als das burgundische Reich 436 dem gemeinsamen Angriff von Römern und Hunnen erliegt. Auch die Bedeutung der Rheinschiene kommt in dem Lied zum Ausdruck: Siegfried, der „Held aus Niederland“, wird als Königssohn in Xanten geboren, und zur Werbung um Brunhild fahren er und König Gunther rheinabwärts zur Nordsee und nach Island.
Der Dom zu Speyer: Größter Sakralbau der Romanik
An die Stelle der Burgunder treten zunächst die Alemannen, die mit den Franken um die Herrschaft im heutigen Frankreich rivalisieren, von diesen aber 496 in die Schranken verwiesen und nach Süden abgedrängt werden. In karolingischer Zeit sind erhebliche Teile des nördlichen Oberrheingebietes fränkisches Königsland, besonders in der Umgebung der hier errichteten Pfalzen von Ingelheim und Tribur, die das System der hessischen Königspfalzen (Fritzlar, Hersfeld, Fulda, Frankfurt, Gelnhausen) nach Süden abrunden. Vor allem in der Pfalz Ingelheim, die wohl in den Jahren um 780 erbaut wird, hat sich Karl der Große gerne aufgehalten; in Tribur finden wiederholt Reichsversammlungen statt.
Nicht weit von der alten Burgunderhauptstadt Worms, wo die Karolinger ebenfalls über erhebliche Besitzungen verfügen, wird 764 ein Benediktinerkloster gegründet, das Karl der Große wenig später nach Lorsch verlegt, zur Reichsabtei erhebt und großzügig ausstattet; die Besitzungen der Abtei reichen später von Utrecht bis Basel. Während des ganzen Hochmittelalters stellt das 1232 an das Mainzer Erzstift, später an die Pfalz gefallene Kloster Lorsch ein Kulturzentrum ersten Ranges dar; die hier besonders gepflegte Reichsgeschichtsschreibung („Lorscher Annalen“) kann sich auf eine der größten Bibliotheken des Abendlandes stützen.
Daß die Gegend seit alters her den Charakter einer Königslandschaft hat, geht auch daraus hervor, daß das Kerngebiet des Erzbistums Mainz, der bedeutendsten Herrschaft dieses Raumes, zum guten Teil auf ehemaligem Königsland liegt. So fällt die Masse des Reichsguts um Rüdesheim, Eltville und Lorsch im Laufe des 9. Jahrhunderts an Mainz, und noch Otto II. vergibt 983 beträchtliche Ländereien um Bingen und im Rheingau an das Erzstift.
Im Zeitalter der Salierkaiser stellt dann das Oberrheingebiet das eigentliche Kernland des Reiches dar, insbesondere der Worms- und der Speyergau. Hier liegen in massiver Konzentration die Hausgüter der salischen Dynastie, die 1024 mit Konrad II. für ein Jahrhundert auf den deutschen Thron gelangt. Als Graf im Speyergau verfügt Konrad in der Region zwischen Kaiserslautern und dem Rheingau über umfangreiche Herrschaftsrechte und ausgedehnten Eigenbesitz, so daß die Region fortan eine wichtige politische Basis für die Reichsgewalt darstellt.
Dies zeigt sich zum Beispiel während des Investiturstreits, als ein großer Teil der Reichsfürsten und des hohen Reichsklerus von Heinrich IV. (1066–1106) abfällt und dieser sich weitgehend auf die Gebiete seiner unmittelbaren Herrschaft stützen muß. Dabei zieht er auch die Bewohner von Worms und Speyer heran, denen er so weitgehende Rechte erteilt, daß sich diese Orte zu den ersten Städten im Rechtssinne entwikkeln können. Am nördlichen Oberrhein wird damit eine neue Epoche der Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte eingeleitet. Die sich damals konstituierende Bürgerschaft der beiden Städte steht jeweils in scharfem politischen Gegensatz zu ihrem bisherigen bischöflichen Herrn, so daß die Allianz zwischen König und Bürgertum im beidseitigen Interesse liegt und infolgedessen über die Regierungszeit Heinrichs IV. hinaus andauert. 1074, 1104 und 1111 erhalten die beiden Städte Privilegien, die ihnen die völlige Emanzipation von ihren Stadtherren und den Aufstieg zu Freien Reichsstädten ermöglichen. Schon in der Salierzeit wird die dann später von den Staufern systematisch betriebene Städtepolitik eingeleitet – der Versuch, das rasch aufsteigende Bürgertum, seine erheblichen finanziellen Ressourcen und die damit verbundenen politischen und militärischen Möglichkeiten für die Reichspolitik zu nutzen.
Im Speyergau, der Wiege der Salierdynastie, wird zwischen 1030 und 1061 auch deren Grabstätte errichtet, der Dom zu Speyer. Es handelt sich um eine gewaltige dreischiffige Basilika mit Querhaus – der größte romanische Kirchenbau Deutschlands und eines der bedeutendsten Baudenkmäler des Abendlandes. Insgesamt acht Könige und Kaiser haben hier ihre letzte Ruhe gefunden, unter ihnen noch Rudolf von Habsburg (1273–1293), der, als er sein Ende kommen fühlt, in bewußter Anknüpfung an die Tradition seiner Vorgänger nach Speyer reitet. Der Dom bringt die Leitvorstellungen des hohen Mittelalters zum Ausdruck: die Majestät Gottes und die gemeinsame Zielsetzung der seinen Heilsplan erfüllenden Universalgewalten Reich und Kirche.
Mehr noch als Bamberg, vergleichbar nur mit dem Aachener Münster, stellt der Dom damit ein zentrales Monument des deutschen Königs- und abendländischen Kaisertums dar. So ist er auch immer verstanden worden, nicht nur im Mittelalter. Als beispielsweise während des Pfälzischen Krieges, also lange vor Aufkommen des nationalen Bewußtseins, französische Truppen den Dom und die Grabkammern plündern (1689), erregen sie damit nicht nur in der betroffenen Region, sondern in ganz Deutschland Abscheu. Umgekehrt ist sich der bayrische König Ludwig I. (1825–1848) allgemeiner Zustimmung sicher, als er den Dom wiederherstellen und um eine Vorhalle erweitern läßt, die zwar nicht dem heutigen Geschmack entspricht, inzwischen aber ebenfalls längst als historisches Monument zu sehen ist.
In staufischer Zeit verlagert sich das Schwergewicht des westdeutschen Reichsterritoriums aus dem Raum Rheingau – Worms – Speyer nach Süden. Den Staufern gelingt es schon früh, sich im Norden des alemannischen Siedlungsgebietes festzusetzen und etwa im Bereich der späteren Reichsstädte Annweiler und Landau die alemannisch-fränkische Stammesgrenze in Richtung Norden zu überschreiten. 1156 überträgt Barbarossa seinem Stiefbruder Konrad von Staufen die damals in der Entstehung befindliche Pfalzgrafschaft bei Rhein mit den Zentren Alzey, Neustadt/Weinstraße und Heidelberg, die spätere pfälzische Hauptstadt. Auch das weiter nördlich gelegene salische Hausgut kommt auf dem Erbwege an die neue Dynastie.
Überragende Bedeutung für die Region hat in der Stauferzeit der Ort Hagenau, der um 1035 in Anlehnung an eine Burg im Hagenauer Forst, dem Grenzwald zwischen Schwaben und Franken, entsteht. Hier errichten die Staufer 1153 eine Reichspfalz, in der bis zum Jahre 1208 die Reichskleinodien, darunter die aus dem 10. Jahrhundert stammende Reichskrone, aufbewahrt werden. Später wird Hagenau Freie Reichsstadt und Verwaltungszentrum für das Reichsgut im gesamten nördlichen Elsaß.
Weit über die Region hinaus reicht auch die Bedeutung der Reichsburg Trifels bei Annweiler, die, 1081 erstmals genannt, als stärkste Festung des Reiches gilt. Aus diesem Grunde werden 1208 die Reichskleinodien hierher gebracht, bevor sie im Zeitalter der luxemburgischen Kaiser auf dem Karlstein bei Prag, nach Ausbruch der Hussitenkriege in der Nürnberger Burg und seit 1805 schließlich in der Schatzkammer der Wiener Hofburg aufbewahrt werden.
Anfang des 13. Jahrhunderts spielt der Trifels sogar eine Rolle in der internationalen Politik. Der König von England, Richard Löwenherz, gerät bei seiner Rückkehr vom dritten Kreuzzug (1189–1192) in die Gefangenschaft seines Intimfeindes, des Herzogs von Österreich, und wird zunächst auf der Burg Dürnstein in der Wachau, danach auf dem Trifels inhaftiert. Nur dadurch, daß er sein Königreich England als Lehen vom Reich nimmt, kann er sich aus der Haft lösen. Die damalige Schwächeperiode des englischen Königtums hat insofern allgemeinhistorische Auswirkungen, als es dem englischen Adel damals gelingt, gegenüber der Krone die „Magna Charta“ durchzusetzen, die am Anfang der freiheitlichen Verfassungsentwicklung Englands und Europas steht.