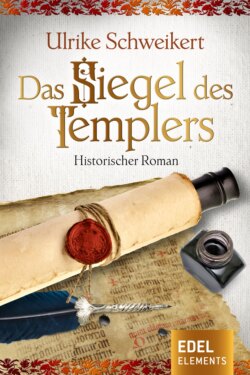Читать книгу Das Siegel des Templers - Ulrike Schweikert - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление| 5Larresoyna* |
Der Wind frischte auf, je näher Juliana der Passhöhe kam. Die Bäume wurden lichter, bis sie einem grasbedeckten Höhenzug wichen, der den Blick über Navarra freigab. Vom Aufstieg glühten ihre Wangen, und der Kittel in ihrem Rücken war schweißnass. Nun fuhr der Wind in ihre Gewänder und ließ sie frösteln. Sie blieb stehen und ließ ihren Blick schweifen. Welch ein Ausblick! Heute konnte man in den Pyrenäen die Wunder der Natur Gottes sehen, die Juliana auf ihrem Weg durch den Nebel verborgen geblieben waren. So stand sie nun auf dem Erropass und blickte staunend zurück zu den Bergen, die sie auf ihren eigenen Füßen überquert hatte.
»Wolf, hast du das gesehen?«, flüsterte sie.
Lange hatte Juliana nicht mehr so intensiv an den Freund aus Kindertagen gedacht wie nun, da sie vielleicht seinen Fußspuren folgte. War er überhaupt so weit gekommen, oder hatten die Wölfe in den Bergen sein Leben ausgelöscht oder ein Wegelagerer oder Krankheit und Schwäche? Hatte er das Grab des Apostels berührt? Aber warum war er danach nicht wieder zur Burg Ehrenberg zurückgekehrt? Fürchtete er den Zorn des Ritters und hatte Angst vor der Strafe? Schämte er sich zu sehr, dass er seine Pflichten weggeworfen hatte, oder wollte er die Freundin nicht wiedersehen, der er sich in seinem jugendlichen Überschwang versprochen hatte?
Immer noch besser, an Wolf zu denken als an ihren Vater. Im Kloster von Roncesuailles hatte sie den Gehilfen des Infirmarius nach ihm gefragt und auch einen der Helfer, die das Pilgerhospital am Morgen reinigten, aber sie konnten sich nicht an den Ritter von Ehrenberg erinnern. Vielleicht hatte er seinen Namen abgelegt und reiste, wie sie auch, unter dem Schutz eines anderen. Sein Name war durch den Mord entehrt. Möglich, dass er ihn erst wieder tragen wollte, wenn er am Grab des Apostels gesühnt hatte.
Der Gedanke an ihren Vater brachte die Erinnerungen zurück und drängte sie, ihren Weg fortzusetzen. Sie umfasste den Stab und schritt weit aus, den steilen Hang mit seinen immer dichter werdenden Wäldern aus Kiefern und Eichen hinab. Längst hatte die Sonne den Zenit überschritten und sank nun vor ihr in das Tal hinab. Sie überzog die Eichenblätter mit einem warmen Schimmer.
Am Fuß des Berges fühlten sich Julianas Füße heiß an und brannten, und so lenkte sie ihren Schritt zum Ufer des klaren Flüsschens, über das eine steinerne Brücke führte. Mit einem Seufzer der Erleichterung ließ sich Juliana ins Gras sinken, zog Schuhe und Beinlinge aus und streckte die Beine bis über die Waden in das erstaunlich kalte Wasser. Kleine Fische schwammen neugierig herbei. Einer war gar so dreist, an ihren nackten Zehen zu zupfen.
Eine Stimme ließ Juliana aufsehen. Eine Frau in einem grauen Habit mit einem schwarzen Schleiertuch auf dem Kopf beugte sich über die steinerne Brüstung und rief ihr etwas zu. Juliana hob die Hände, um ihr zu zeigen, dass sie nicht verstand. Die Frau nickte, überquerte die Brücke und kam die Uferböschung herab auf sie zu. Noch einmal versuchte sie es in der Sprache, die Juliana nicht verstand, dann wechselte sie ins Französische.
»Das ist nicht gut für deine Füße«, sagte sie. »Sie werden weich und wund, wenn du weitergehst.«
Juliana seufzte, »Ja, ich weiß, aber das kühle Wasser war zu verlockend.« Sie zog die Beine aus dem Wasser und trocknete sie an ihrem Umhang ab.
»Warte eine Weile, ehe du die Schuhe anziehst«, riet die Fremde und zeigte beim Lächeln erstaunlich weiße Zähne. »Ich heiße Sancha und helfe den Brüdern drüben im Spital. Wir haben nur ein kleines Haus, aber wir nehmen jeden Kranken und Bedürftigen auf, solange es in unseren Kräften steht. Wie heißt du, und wo kommst du her?«
Wie stets war Juliana bei den Fragen nach dem Woher und Warum auf der Hut und antwortete ausweichend.
»Juan«, lächelte die Frau. »Willst du heute noch weiter? Ich will dich nicht abweisen, aber du siehst mir jung und kräftig aus. Sicher schaffst du es noch bis zum Kloster San Agustín in Larresoyna. Die Augustinerherren haben mehr Platz zu bieten, und ich denke, auch das Essen kann dort reichlicher ausgegeben werden.« Sie seufzte. »In unserem Haus müssen sich heute alle mit wässriger Zwiebelsuppe und Gerstenbrei begnügen.«
Juliana dankte für den Rat. »Wie heißt der Weiler hier?«, fragte sie, um bei einem unverfänglichen Thema zu bleiben.
Die Laienschwester setzte sich neben sie ins Gras. »Wir nennen ihn Çuviri*, das heißt Brückendorf, denn erst als hier die feste Brücke über den Río Arga gebaut wurde, begann auch das Dorf zu entstehen.«
Juliana betrachtete die beiden Steinbogen mit dem massiven Pfeiler, um den das grünliche Wasser aufschäumte.
»Es ist eine ganz besondere Brücke«, fuhr die Schwester fort. »Dort im Pfeiler vermauert ist eine Reliquie von Santa Quiteria. Das war eine Märtyrerin aus Galicien, die für ihren Glauben als Jungfrau in den Tod ging.«
»Und was bewirkt die Reliquie im Brückenpfeiler?«
»Sie bewahrt Tiere davor, toll zu werden. Wir führen alle unsere Ziegen, Schafe und Kühe darüber und natürlich die Hunde.«
»Das funktioniert? Keines der Tiere wird krank?«, wunderte sich Juliana.
»Nein, nicht immer«, gab die Schwester freimütig zu. »Es gibt Jahre, in denen unser Vieh verschont bleibt, dann aber wieder trifft es auch unser Dorf. Meist ruft der Cura Pater Sebastian dann sofort zu einer Prozession auf. – Dennoch steht fest, dass die Tollheit hier bei uns weniger um sich greift als anderorts!«, bekräftigte Sancha ihre Aussage. »Auch wenn alle sagen, früher hätte Santa Quiteria besser geholfen.« Beide schwiegen.
»Vielleicht liegt es an den vielen Franken«, sagte sie nach einer Weile. »Sie sind anders als wir und haben keinen so tiefen Glauben. Und es werden immer mehr.« Sie seufzte. »Kein Wunder, nachdem unsere verehrte Königin Johanna einen Franzosen genommen hat! Nun ist sie tot, und mit ihrem Sohn Ludwig sitzt ein halber Franzose auf dem Thron.«
Juliana betrachtete die Frau neben sich mit den breiten, herben Gesichtszügen, der dunklen Haut und dem schwarzen Haar, das unter ihrem Schleiertuch hervorlugte. »Woher stammt Ihr, Sancha?«
»Ein Teil meiner Familie ist baskisch und kommt von der Küste, der andere hier aus Navarra.«
Man hatte Juliana auf ihrem Weg durch das Languedoc und die Gascogne viele Geschichten über die Navarresen erzählt und sie vor ihnen und vor den Basken gewarnt.
»Sie sind barbarische Völker«, hatte ein Tuchhändler aus Lyon berichtet, mit dem die Pilgergruppe auf einen Becher Wein zusammengesessen hatte. »Die Sprache der Basken ist der unseren völlig fremd. Sie tragen schwarze Kleider, die so kurz sind, dass sie kaum die Knie bedecken, und Schuhe aus ungegerbtem Leder, von dem sie nicht einmal die Haare entfernt haben. Gegen die Kälte, die in den Bergen auch im Sommer herrscht, hüllen sie sich in schwarze Wollmäntel. Ihre Kleider sind von schlechter Qualität und ihr Essen ebenfalls.«
»Ich kann daran nichts Schlimmes finden«, murmelte Juliana und erhielt dafür einen strafenden Blick des Tuchhändlers.
»Nur Geduld, mein junger Bursche, ich werde zu den wüsten Dingen schon noch kommen. Am Ende werden dir die Haare vor Entsetzen zu Berge stehen, und du wirst dir wünschen, nicht durch dieses Land reisen zu müssen. Die Navarresen sind voller Bosheit, schurkisch und falsch. Wenn sie sich zum Mahl setzen, dann essen die Herren mit den Knechten alle aus einem Topf. Sie schlingen ihren Fraß mit den Händen hinunter, statt, wie es Menschen würdig ist, einen Löffel zu benutzen. Man glaubt, Schweine oder Hunde vor sich zu haben.« Einige der Pilger lachten, andere sahen sich voller Unbehagen an.
»Wartet, das ist noch nicht alles.« Der Händler ließ sich seinen Becher noch einmal füllen und trank ihn zur Hälfte leer, ehe er fortfuhr. »Sie sind die Feinde der Franzosen. Hütet euch! Für eine Münze tötet jeder Navarrese einen Franzosen, wenn er kann. An den Flüssen fordern sie einen unverschämten Preis von allen Pilgern, ehe sie sie übersetzen, und von den Franzosen stets noch eine Münze dazu, obwohl jeder weiß, dass man den Pilgern nicht in die Tasche greifen soll. Auch sind die Preise in den Wirtshäusern hoch, dafür dass sie einem dann einen altersschwachen Hammel als süßes Lämmlein auf den Teller legen.«
»Mir stehen noch immer nicht die Haare zu Berge«, sagte ein Pilger aus der Champagne lachend, der an diesem Abend bereits vier Becher Wein geleert hatte und dessen Augen trüb glänzten. »Habt Ihr nichts Besseres zu bieten?«
»Ach, Ihr wollt die übelsten Schändlichkeiten hören? Nun, wenn Ihr mich so drängt. Ich hätte Euch diese Dinge gern erspart.« Die Sensationsgier in seiner Stimme strafte seine Worte Lügen. »Euch soll es die Schamesröte ins Gesicht treiben!« Er beugte sich vor und senkte ein wenig die Stimme, jedoch nur so, dass ihn alle noch gut verstehen konnten. »Wenn sich die Navarresen wärmen, zeigen sich Frauen und Männer ihre Scham, und sie treiben mit dem Vieh Unzucht. Sie küssen das Geschlecht ihrer Weiber und das der Maultiere.« Die Männer lachten. Nur Juliana senkte den Kopf. Ihre Wangen glühten.
»Man sagt, die Navarresen hängen ein Schloss an den Hintern ihrer Maultiere, dass außer ihnen kein anderer sich an ihrem Vieh vergehen kann.«
Nun brüllten die Pilger vor Lachen und schlugen mit den Bechern auf den Tisch. Es brauchte eine Weile, bis wieder Ruhe einkehrte.
»Und das habt Ihr alles auf Euren Reisen durch Navarra mit eigenen Augen gesehen?« Die Zweifel in Bruder Ruperts Stimme waren nicht zu überhören. Er hatte sich etwas abseits an die Wand gesetzt, die Augen geschlossen, und Juliana war es so vorgekommen, als würde er nicht auf das Gespräch am Nebentisch achten.
Der Tuchhändler wand sich. »Nein, nicht alles«, gab er schließlich zu, »aber so manches. Und dennoch ist jedes Wort wahr! Hat es nicht dieser Bischof in seinem Buch Liber Sancti Jacobi schon vor langer Zeit niedergeschrieben?«
»Mag sein«, brummte Bruder Rupert. »Ich würde dennoch keine meiner Münzen darauf verwetten.«
Juliana sah die Frau an ihrer Seite an, konnte aber nichts Barbarisches an ihr erkennen. Das Rolandslied kam ihr wieder in den Sinn und die Worte des ungläubigen Thomas. Konnte sie es wagen, eine Frau dieses Volkes zu fragen? Warum nicht!
»Kennt Ihr die Geschichte von Kaiser Karl und seinem getreuen Helden Roland? Jemand hat mir gesagt, es seien gar nicht die Sarazenen gewesen, die ihn angegriffen und vernichtet haben.« Sie zögerte und sah die Laienschwester abschätzend an. »Manche behaupten, die Basken hätten ihn in einen Hinterhalt gelockt. Wisst Ihr etwas darüber?«
Sancha schnaubte durch die Nase. »Wir kennen die Geschichte auch, aber bei uns wird sie ein wenig anders erzählt. Euer Held ist bei den Basken Errolán, ein böser Riese, der mit Felsbrocken wirft. Mein Volk sieht den Angriff als gerechte Vergeltung, dafür dass der Riese Irunga zerstört und dort mit Grausamkeit gewütet hat.«
Die Laienschwester erhob sich brüsk, legte dann aber die Hand auf ihr Herz und wünschte Juliana eine glückliche Pilgerfahrt. Eilig stieg sie die Böschung zur Brücke hinauf und entschwand Julianas Blicken.
Die Nacht war bereits hereingebrochen, als Juliana den Fluss ein zweites Mal überquerte. Sie schritt auf die Kirche zu, die vor ihr in den Nachthimmel aufragte: ein breiter, wehrhafter Turm, aus massiven Felsen gemauert mit einem einfachen Kirchenschiff an seiner Ostseite. Durch ihre schießschartenähnlichen Fenster wirkte sie eher wie einer der Burgställe, die es in Julianas Heimat so zahlreich gab. Diese Kirche war Gotteshaus und Schutzburg in einem und verzichtete auf filigranes, himmelwärts strebendes Gotteslob.
Juliana umrundete die Kirche und klopfte an die Klosterpforte. San Agustín war ebenso gedrungen und wehrhaft aus solidem Stein mit Strebemauern entlang der Außenseite. Das Mädchen musste eine ganze Weile warten, ehe sich nach dem vierten Klopfen ein Fensterchen in der Tür öffnete. Das Licht einer Laterne blendete sie, und eine brüchige Stimme fragte sie auf Baskisch, Französisch und Latein nach ihrem Begehr. Ihre Antwort schien den Augustiner zufrieden zu stellen, denn sie hörte, wie innen der Riegel zurückgeschoben wurde, und mit einem Kreischen schwang das Tor auf. Ein dürres Männchen, das ihr gerade einmal bis zur Brust reichte, stand mit erhobener Laterne vor ihr und musterte sie misstrauisch.
»Wir öffnen nicht gern, wenn die Nacht hereingebrochen ist«, sagte es und verriegelte das Tor, sobald Juliana eingetreten war. »Es treibt sich manch widerliches Volk in der Sierra herum«, fügte der Mönch hinzu, der sich als Fray Mateo vorstellte, während er sie einen kalten Gang entlangführte. »Erst vor zwei Tagen wurden uns drei Pilger gebracht – völlig nackt und halb tot. Wir wissen noch nicht, ob sie es schaffen. Sie wurden böse mit Messern und Keulen zugerichtet. Dabei hatten sie kaum etwas bei sich, das zu stehlen lohnte – das sagte uns jedenfalls der jüngste, der inzwischen wieder bei klarem Verstand ist.«
Unvermittelt blieb das Männchen stehen und sah Juliana vom Kopf bis zu den Füßen an. »Und du wanderst allein durch die Wälder? Ist dir nicht klar, wie gefährlich das ist?« Der Mönch schnalzte missbilligend mit der Zunge.
»Mir ist bisher nichts geschehen«, verteidigte sich Juliana mit dünner Stimme.
»Dummer Junge!«, schnarrte der Mönch. »Jacobus muss dich sehr lieben, dass er seine Hand schützend über dich hält.«
Er führte das Mädchen in eine fensterlose Küche, in deren großer Feuerstelle die Glut noch glomm. Daneben stand ein Kessel, aus dem er ihr eine Schale Eintopf schöpfte.
»Du kannst hier essen«, er deutete auf eine Bank vor einem Tisch aus rohem Holz. Er schlurfte zu einem Wandbord, nahm einen Laib Brot aus einer Tonschüssel und schnitt einen großzügigen Kanten ab. »Wir gehen hier früh zu Bett, damit wir uns rechtzeitig zur Matutin erheben können«, sagte er ein wenig vorwurfsvoll, als er ihr das Brotstück reichte.
Juliana senkte den Kopf. »Es tut mir Leid, dass ich Euch so spät noch Umstände mache, Fray Mateo, ich wusste nicht, wie weit der Weg hierher ist.«
Das Männchen lächelte und strich ihr über die blonden Locken, die seit ihrem heimlichen Aufbruch in Wimpfen schon wieder ein Stück gewachsen waren. »Musst dich nicht entschuldigen. Der Portner hält immer Wacht, um auch die Verspäteten, die Hilfe bedürfen, einzulassen. Nun iss, damit ich dich zum Schlafsaal führen kann.«
Das Mädchen schlang den kalten Eintopf und das Brot hinunter und trank einen Becher verdünnten Wein, den Fray Mateo ihr über den Tisch zuschob. Dann folgte sie ihm über eine Treppe in einen Saal mit einem Dutzend Strohmatratzen. Der Portner wartete, bis sie Kittel, Schuhe und Beinlinge abgelegt hatte und in ihrem Hemd unter die Decke gekrochen war. Dann erst hob er die Laterne auf und ging, um seinen Posten am Tor wieder einzunehmen. Das Klatschen seiner Sandalen auf dem Steinboden war das Letzte, das Juliana noch hörte, ehe sie in tiefen Schlaf sank.
* * *
Sie hatte tief und traumlos geschlafen. Weder der Gesang der Mönche, der um zwei Uhr morgens zur Matutin anhub, noch ihr Gotteslob zu den Laudes um halb fünf störten ihre Ruhe. Erst als ein paar Pilger sich erhoben, sich ankleideten und zum Frühmahl gingen, erwachte Juliana. Ein schwacher Lichtschein drang durch die Pergamentscheiben. Fast die Hälfte der Lager war noch belegt. Sicher waren hier auch die Unglücklichen, die auf ihrem Weg hierher überfallen worden waren. Während sich das Mädchen ankleidete, huschte ihr Blick neugierig von einem Bett zum nächsten. Oder wurden so schwer Verletzte in einem anderen Raum des Klosterspitals untergebracht?
Im Refektorium der Pilger, das von dem der Mönche getrennt war, traf Juliana auf fünf Männer und eine Frau. Sie setzte sich ein wenig abseits und beobachtete die anderen verstohlen, während sie eine Schüssel Mus mit Holunderbeeren löffelte, die zu dieser Jahreszeit überall an den Wegrändern üppig gediehen.
Zwei junge Männer, mit den groben grauen Kutten der Franziskaner bekleidet, saßen unter dem Fenster, die Köpfe gesenkt und schwiegen. An einem anderen Tisch sah sie drei Männer, die sich lebhaft unterhielten. Einer von ihnen war noch jung, ein leerer Schwertgurt hing um seine Hüfte. Die anderen mochten im Alter ihres Vaters sein. Während der eine Kleider aus gutem Tuch trug und einen pelzgefütterten Mantel über seine Knie gelegt hatte, sah der andere sehr zerlumpt aus. Julianas Blick wanderte zu der Frau weiter, die allein hinten an der Wand ihre Musschüssel leerte. Ihre Kleider waren zwar von der Reise gezeichnet, jedoch anständig und von dickem Wollstoff. Ihr Haar verbarg sie unter einer einfachen Haube. Wer war sie? Reiste sie allein? War sie überhaupt eine Pilgerin auf dem Weg nach Santiago? Juliana sah die Blicke, die die Männer immer wieder in ihre Richtung warfen. Die drei steckten die Köpfe zusammen. Sprachen sie über die Frau? Hegten sie irgendeine Teufelei aus? Aber nein, es waren Pilger! Sie würden sich auf ihrer Fahrt niemals einer Frau in schamloser Absicht nähern … Oder doch? Waren sie nicht schwache Sünder wie alle Menschen, die auch dem Ruf des Fleisches gehorchten? War das nicht letztlich der Grund, warum ihr Köper in Männerkleidern steckte?
Die Tür öffnete sich und ein gut genährter Mann mit roten Wangen trat ein. »Louise«, sprach er die Frau auf Französisch an. »Die Pferde sind bereit, wir können aufbrechen. Sie nickte, erhob sich und folgte ihm hinaus, ohne auf die Blicke zu achten, die ihr folgten. Auch Juliana sah auf die leere Türöffnung, in der sie verschwunden war, als deutsche Worte sie herumfahren ließen.
»Ich grüße dich. Darf ich mich zu dir setzen?«
Juliana klappte den Mund auf und schloss ihn wieder, ohne ein Wort herauszubringen. Sie starrte den jungen Mann an, der so unerwartet vor ihr stand. Seinen Rucksack trug er lässig über der Schulter, die leere Schwertscheide schwang gegen sein linkes Bein. Er war nur mittelgroß und ein wenig zu dünn für einen Ritter, der eine Rüstung tragen und ein Schwert schwingen musste. Dass er vermutlich aus einer adeligen Familie stammte, sagte sein schwarzes Haar, das ihm bis auf die Schulter fiel. Nur Edelfreien war es gestattet, das Haar lang zu tragen. Sein Bartwuchs war noch ein wenig spärlich. Vermutlich hatte er die zwanzig noch nicht erreicht. Auch seine Augen waren dunkel. Juliana hätte ihn für einen Franzosen gehalten, wenn er sie nicht in so klarem Deutsch angesprochen hätte.
»Habe ich dich erschreckt, oder kannst du nicht reden?«
Seine Stimme klang freundlich, wenn auch mit einem Hauch von Spott. Sicher wusste er, dass sie nicht stumm war. Endlich fand Juliana ihre Sprache wieder.
»Ja, doch, ich meine, natürlich darfst du dich setzen.« Sie musterten sich gegenseitig.
»Ich habe dich beobachtet«, sagte der Fremde, »und da kam mir der Gedanke, dass du nicht allein reisen solltest. Wollen wir uns zusammentun? Du bist doch auf dem Weg nach Santiago?«
Juliana nickte nur. Sie wusste nicht, was sie von diesem Überfall halten sollte, aber sie spürte, wie in ihr schon wieder der Drang nach Flucht aufwallte.
»Entschuldige mich, ich muss – ich meine – das heimliche Gemach …« Sie sprang auf, blieb mit dem Kittel an der Bank hängen und taumelte.
»Ein Aborterker ist da drüben den Gang runter«, gab der fremde junge Mann bereitwillig Auskunft. »Und eine Grube ist in dem kleinen Hof.«
Juliana raffte Tasche, Rucksack und Stab an sich, murmelte einen Dank und eilte hinaus. Obwohl sie sich wirklich erleichtern musste, nahm sie sich nicht die Zeit dazu. Das musste warten. Sie rief dem Mönch an der Pforte ein Dankeswort zu und eilte auf die Gasse hinaus. In schnellem Schritt durchquerte sie das Dorf, das sich entlang des Weges ausdehnte. Dann blieben die Häuser hinter ihr zurück, und sie wanderte durch die grüne Flussaue. Saftige Weiden, von Dornenreisig umgrenzt, mit Kühen und Schafen, aber auch Felder mit Gemüse und im Wind wogendem Korn säumten die Straße. Immer wieder verlief der Weg direkt am Río Arga entlang. In einem Weiler rastete Juliana im Schatten der Kirche, trank etwas Wasser und aß den Apfel, den sie in Roncesuailles geschenkt bekommen hatte.
»Du hast aber einen Schritt!«, erklang die Stimme vom Morgen unvermittelt neben ihr. »Man könnte meinen, du fliehst vor irgendetwas. Willst du mir nicht verraten, was du angestellt hast?«
Das Mädchen unterdrückte einen Aufschrei und wandte sich so langsam wie möglich um. »Rede keinen Unsinn! Es ist keine Sühnereise. Ich bin auf dem Pilgerweg, um den Apostel zu preisen! Da trödelt man nicht.«
»Die wenigsten, die ich getroffen habe, rennen allerdings so wie du«, neckte der junge Mann weiter und ließ sich im Schneidersitz neben ihr nieder.
»Wenn es nicht deine übergroßen Schuldgefühle sind, die dich treiben, könnte ich fast denken, du bist vor mir davongelaufen.«
Röte stieg dem Mädchen in die Wangen. »Verzeih, es ist nicht deine Schuld. Es ist nur – ich bin es inzwischen gewohnt, allein zu wandern.« Sie mied seinen Blick.
»Schlechte Erfahrungen gemacht«, sagte er leise und nickte. Eine Antwort schien er nicht zu erwarten, und so schwieg das Mädchen. »War vielleicht nicht die richtige Art, dich so anzusprechen. André de Gy.« Er streckte ihr die Hand entgegen, die sie zaghaft ergriff. »Ritter André de Gy«, fügte er zögernd hinzu.
»Oh!«, stieß Juliana erstaunt hervor. »Entschuldigt, ich habe Euch für jünger gehalten. Ich wollte nicht unhöflich sein.« André winkte ab. »Ist auch erst ein paar Monate her – mein Ritterschlag, meine ich. Ich bin es ohnehin noch gewohnt, dass die Leute mich duzen.«
Juliana betrachtete ihn. Eigentlich schien ihr der dunkelhaarige junge Mann sympathisch und keineswegs gefährlich.
»Ritter André de Gy? Ihr seid Franzose? Wo habt Ihr so gut Deutsch sprechen gelernt? Es klingt vertraut. Man kann kaum einen Akzent hören.«
»Gott bewahre, ich bin kein Franzose«, wehrte André ab. »Ich bin Burgunder. Aus der Freigrafschaft, nicht aus dem Herzogtum. Wir gehören also auch zum deutschen Kaiserreich.« Er zwinkerte. »Aber gelebt habe ich seit meinem siebten Lebensjahr bei meinem Oheim auf Burg Wildenstein an der Donau – erst als Page und dann als Knappe.«
»Wildenstein an der Donau«, wiederholte Juliana. Das erklärte alles.
»Dreizehn Jahre war ich dort, bis zu meinem Ritterschlag, dann habe ich mich in die Heimat aufgemacht, um meine Eltern zu sehen …« Er brach ab. Seine Miene verdüsterte sich, als habe sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Er schüttelte den Kopf, dann wandte er seinen Blick wieder Juliana zu. Sie wollte ihn eben fragen, warum die Schwertscheide an seiner Seite leer war, als er fortfuhr: »Was ist mit dir? Du hast mir noch immer nicht deinen Namen verraten. Wo kommst du her? Wie es sich anhört, aus Franken.«
»Ich heiße Johannes – von Ehrenberg, wo der Neckar und die Jagst zusammenfließen«, fügte sie unter seinem fragenden Blick hinzu und schalt sich sofort der Dummheit, Ehrenberg genannt zu haben. Anderseits, was konnte es schaden? Sicher war der junge Mann aus Burgund nie an den Neckar gekommen oder hatte jemanden ihrer Familie kennen gelernt.
»Ist dein Vater ein Edelfreier?«, wollte André wissen.
»Ein ehrenhafter Ritter«, stieß sie mit mehr Heftigkeit hervor, als sie es vorgehabt hatte.
André zog die Brauen zusammen. »Das hatte ich nicht bezweifelt. Du allerdings scheinst mir für den Ritterschlag noch zu jung.«
Juliana nickte schwach. Der junge Ritter de Gy sprang auf die Füße. »Genug geruht. Der Tag verrinnt, und wir sollten uns auf den Weg machen, wenn wir Pampalona heute noch erreichen wollen.«
Das Mädchen erhob sich ebenfalls und klopfte sich den Staub von den Kleidern. Sie wanderte neben André her und lauschte ihren Gefühlen. Nein, da war nichts, das sie vor ihm warnte. Anscheinend war er wirklich nur ein harmloser junger Ritter auf dem Weg nach Santiago.
* heute: Larrasoaiia