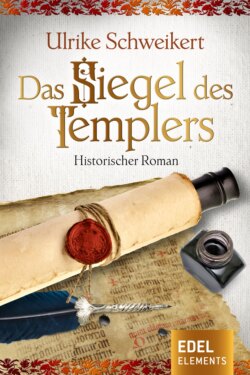Читать книгу Das Siegel des Templers - Ulrike Schweikert - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление| 8Die BußeWimpfen im Jahre des Herrn 1307 |
Juliana schläft nicht in dieser Nacht. Selbst wenn sie die Augen schließt, erscheint das Bild, als wäre es in ihre Lider geprägt: der Vater mit blutigen Händen, den Griff des Dolches umklammert, über die Leiche gebeugt.
Die Leiche. Allein das Wort lässt sie schaudern.
Am Nachmittag war er noch Swicker von Gemmingen-Streichenberg gewesen, der jüngste Sohn von Mutters Oheim. Ein Tempelritter, der im Heiligen Land kämpfte, kaum dass er den Ritterschlag erhalten hatte. Erst gestern hatte er ihr von Akkon erzählt, von der letzten Schlacht, in der sich selbst die tapferen Templer geschlagen geben mussten. Er verriet ihr seinen Traum: einmal Jerusalem sehen, den Tempelberg, wo die armen Ritter Christi ihre Wurzel hatten, die heilige Grabeskirche und die Davidsburg. Er sagte, der Großmeister wolle mit dem Papst sprechen, und dann würde es einen neuen Kreuzzug geben. Einhundertzwanzig Jahre lang war Jerusalem nun wieder in den Händen der Muselmanen – seit Saladin im Jahre des Herrn 1187 in die heilige Stadt einzogen war. Nun war es an der Zeit, dass die Al-Aksa-Moschee wieder zum Tempel Salomos erhoben wurde.
Der Templer Swicker war ein ernster Mann, der nicht viele Worte brauchte, mit einem von Kampf und Entbehrung gehärteten Körper und gebräunter Haut. Er trug sein sandfarbenes Haar kurz und einen dichten Bart an Wangen und Kinn. Juliana konnte den Blick nicht von ihm wenden. Die Ritter und anderen Freien, die sie kannte, rasierten sich stets sorgfältig und ließen ihr langes Haar offen auf die Schultern fallen. Kurzes Haar war ein Zeichen von Unfreiheit! Und doch würde niemand, der Swicker sah, auf die Idee kommen, er wäre ein unfreier Bauer. Ihn adelte diese ungewöhnliche Haartracht, wie sie auch bei seinen Mitbrüdern üblich war, auf ganz eigene Weise. Der Templer Swicker sah weniger herausgeputzt aus als sein Waffenbruder Jean de Folliaco. Der dunkle Franzose legte offensichtlich mehr Wert auf die Pflege seines Hauptes und verbrachte viel Zeit damit, das Ungeziefer zu bekämpfen. Aber auch sein Haupthaar war so kurz, dass man den Nacken sehen konnte.
Die Eltern hatten den Vetter der Mutter mit seinem Waffenbruder nach Burg Ehrenberg geladen und ihm zu Ehren eine reiche Tafel decken lassen. Der glatzköpfige Servient Bruder Humbert, der die beiden Ritter begleitete, durfte sich ans untere Ende der Tafel setzen und an dem Festmahl teilnehmen. So, erklärten die Templer, sei es auch auf ihren Burgen der Brauch. Die Wappner, die kämpfenden Servienten also, durften mit im Refektorium essen – wenn auch an eigenen Tischen. Die anderen dienenden Brüder dagegen, egal ob Knecht, Stallbursche oder Handwerker, aßen in der Küche oder einer eigenen Kammer.
Der Ritter von Ehrenberg ließ heute nicht weniger als zwanzig Gänge auftragen und forderte die Gäste immer wieder auf, kräftig zuzugreifen, vom Kapaun und vom Auerhahn, von Karpfen und von den Wachteln, den Krebsen und der Rehkeule, in Honig gedünstetem Hasen und Pfefferküken. Es gab Früchte in Wein eingelegt, Mandelspeisen und gezuckerte Mehlklöße. Lachs aus dem Neckar, den die Gewöhnlichen so oft essen mussten und der während der Woche ab und zu auch hier im Saal auf den Tisch kam, ließ er natürlich nicht auftragen.
»Das seid Ihr sicher nicht gewöhnt«, sagte Ritter Kraft von Ehrenberg mit einem Lächeln. »In den Komtureien werdet Ihr schmälere Kost bekommen – oder gar auf den Burgen, draußen im Okzident – nun ja, damals, bevor Euch die Sarazenen aus dem Heiligen Land vertrieben haben.« Er sah den Franzosen und seinen Waffenbruder abwechselnd an. »Oder stimmen die Gerüchte vom sagenhaften Reichtum und Überfluss, in dem die Templer schwelgen, etwa? Dann ist unsere Tafel natürlich nur Alltag für Euch!«
War da ein Hauch von Abneigung gewesen? Gar Feindseligkeit? Gegen den Vetter der Mutter oder die Templer allgemein?
Juliana liegt still auf dem Rücken, die Hände über dem Leib gefaltet, und versucht, sich jedes Wort, jede Geste, jeden Blick ins Gedächtnis zurückzurufen. Irgendwo in der Vergangenheit muss der Schlüssel zu dieser für sie unfassbaren Tat liegen. Sie will eine Antwort auf das Warum, das im Takt ihres Herzschlages durch ihren Geist hallt.
»In den Regeln unseres Ordens haben unser Ordensgründer Hugo von Payens und der heilige Bernhard festgelegt, dass die Brüder dreimal in der Woche Fleisch zu essen bekommen. In guten Zeiten kann das Essen besser sein, in schlechten Zeiten müssen wir uns bescheiden«, erwiderte Ritter Swicker steif.
»Also ich habe stets vortrefflich gegessen«, hörte Juliana den Franzosen sagen, doch Swicker fuhr fort, als habe er die Worte nicht vernommen.
»Reich sind wir nicht, und wir leben auch nicht im Überfluss. Wir haben, wie alle Brüder anderer Orden, ein Gelübde abgelegt: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Was wir brauchen, um die Pilger zu schützen, das ist unser Eigentum: unsere Pferde, unsere Rüstung und unsere Waffen. Alles andere gehört dem Orden.«
»Pilger? Was für Pilger? Das Heilige Land ist verloren. Ich glaube nicht, dass sich der Papst und der König auf einen neuen Kreuzzug einlassen.«
Swicker sah Juliana an, die den Blick errötend senkte.
»Das weiß bisher nur Gott der Herr. Es gibt immer Hilflose und Bedürftige, die es zu schützen lohnt. Denkt nur an Santiago, die Straße nach Sankt Jakob. Auch dort haben wir Burgen errichtet und wachen über die Sicherheit der Wege.«
Santiago – da ist es wieder. Gibt es einen Zusammenhang? Warum schickt der Dekan Vater nach Santiago und nicht nach Rom? Auch dort würde er den Ablass für eine solch große Sünde wie einen Mord erhalten. Welche Absicht steckt dahinter? Oder ist es nur ein Zufall, dass Jakobus und nicht Petrus Vergebung schenken soll?
Juliana fasst einen Entschluss. Sie wird nach St. Peter ins Tal gehen und mit Dekan von Hauenstein sprechen. Er muss es einfach zulassen, dass sie ihren Vater trifft und die in ihr brennenden Fragen stellen kann. Wird er ihr antworten? Wolfs Gestalt huscht durch ihren Sinn. Seine Stimme hallt geisterhaft in ihr wider. Wird auch ihr Vater von Sankt Jakob nicht zurückkehren? Ist das die letzte Möglichkeit in ihrem Leben, ihn zu sehen und zu umarmen?
Juliana schlüpft unter der Decke hervor, greift nach ihren Kleidern und schleicht nackt und barfuß aus der Kammer. Einen Moment lauscht sie noch dem Schnarchen der Kinderfrau. Sie hat nichts bemerkt. Kein Wunder, sie ist nahezu taub. Vor vielen Jahren war sie die Amme der Mutter und drei ihrer Geschwister gewesen, zog sie auf und kümmerte sich um sie und blieb dann auch nach ihrer Vermählung bei Sabrina von Gemmingen, um nun für ihre Kinder zu sorgen. Doch die Mutter war nicht vom Glück gesegnet. Vier Totgeburten, zwei Kinder, die das erste Jahr nicht überlebten, und ein Sohn, den ein Fieber dahinraffte. Nur ihre erste Tochter – Juliana – hatte die schlimmen Jahre unbeschadet überstanden. Und dann war ihr durch Gottes Gnade vor zwei Jahren doch noch ein Sohn geschenkt worden. Johannes. Welch großes Glück! Der Vater bestand darauf, eine junge Amme zu nehmen, die Tag und Nacht über sein Wohlergehen zu wachen hatte. Er wollte kein Risiko eingehen, den ersehnten Erben wieder zu verlieren.
Die Stube ist verlassen. Rasch schlüpft Juliana in Cotte, Surkot und Schuhe, hüllt sich in ihren Umhang und tritt auf die noch dunkle Gasse hinaus. Der Morgen ist kaum mehr als ein Schimmer am östlichen Horizont. Die Stadt schläft noch. Dennoch ist es für das Edelfräulein nicht schwierig, die Bergstadt Wimpfen ungesehen zu verlassen. Seit vielen Jahren schon ist die Mauer für die aufstrebende Stadt zu eng geworden, die alles daran setzt, dem König immer mehr Privilegien zu entreißen, bis sie den anderen freien Reichsstädten ebenbürtig ist. Die Zeiten, da die Wormser Bischöfe hier das Sagen hatten, sollen endgültig vorbei sein. So kommen mit jedem Jahr mehr Bürger und Hintersassen. Auch einige Judenfamilien haben sich hier niedergelassen. Viele Jahre lang redete man nur davon, dass die Ansiedlung im Süden vor der Mauer, rund um das Spital und bis hinauf zum Kloster der Dominikaner auf dem Hügel, mit zur Stadt gehören müsse, nun endlich lässt man Taten folgen. Im Westen ist die neue Stadtmauer schon fast fertig. Viele ihrer Steine stammen von der alten Mauer im Süden, die nun abgebrochen wird. Statt eines Grabens zieht sich nun eine neue Hauptgasse am Spital entlang durch die Stadt. Jeden Tag ist ein ganzes Heer von Männern dabei, den neuen Graben zu vertiefen und Steine zu Mauern aufzuschichten, während Frauen und Kinder Mist und Schlamm treten und den Mörtel rühren, Erde wegschleppen und Wasser holen. Noch liegt viel Arbeit vor ihnen: Der gesamte Osten der neuen, großen Stadt ist ein einziges, offenes Tor.
Juliana geht durch die neue Hauptstraße am Spital vorbei und verlässt ungehindert die Stadt. Der Karrenweg bringt sie den Hügel herunter ins Neckartal. Sie passiert den Friedhof mit der Kirche. Als sie die Talstadt erreicht, ist die Sonne bereits aufgegangen und das Stadttor geöffnet. Eilig überquert sie den Platz mit den Linden und betritt die Kirche der Stiftsherren durch das alte Westportal. Es ist still. Die ersten Sonnenstrahlen dringen durch die hohen Spitzbogenfenster im Chor und bringen das farbige Glas zum Leuchten. Heute hat Juliana nicht die Muße, die in den Rechtecken dargestellten Geschichten aus dem Neuen und Alten Testament zu betrachten. Sie durchquert das Mittelschiff und strebt auf die Tür im nördlichen Querschiff zu. Sie klopft, aber es rührt sich nichts. Sind die Stiftsherren noch nicht da, oder wollen sie bei ihrer Kapitelversammlung nicht gestört werden? Den Kreuzgang zu betreten, der hinter dieser Tür liegt, wagt Juliana nicht. Auch wenn dies kein Kloster ist und die adeligen Herren statt in der Gemeinschaft einer Klausur in eigenen Häusern in der Talstadt leben, können sie es nicht gutheißen, wenn eine Frau in das Stift eindringt.
Hinter dem Mädchen ertönen Schritte. Es ist der alte Mesner, der mit gebeugtem Haupt auf sie zuschlurft.
»Einen guten Morgen und Gottes Segen«, grüßt sie ihn. »Sind die Herren im Kapitelsaal?«
Der Alte sieht sie einige Augenblicke verwirrt an, dann schüttelt er den Kopf. »Nein, ist noch zu früh. Ein paar der Herren waren vor Sonnenaufgang da, um die Gebete zu den Laudes zu sprechen und zu singen, aber die sind schon wieder weg.«
»Und der Dekan?«, bohrt Juliana weiter.
»Der Herr von Hauenstein wird daheim bei seinem Frühmahl sitzen«, vermutet der Mesner. »Ich habe ihn heute noch nicht gesehen.«
»Er kam nicht zu den Laudes?«
Der Alte schüttelt den Kopf und tappt weiter auf den Altar zu. Juliana folgt ihm.
»Wisst Ihr, wo der Gefangene ist, den der Dekan in der Nacht mit zum Stift brachte?«
Der Mesner bleibt stehen und dreht sich zu ihr um. »Ein Gefangener? Hier im Stift?« Er klingt empört. »So etwas haben wir nicht! Wenn du nach einem Gefangenen suchst, musst du oben in der Pfalz zu den Bergfrieden gehen. Dort gibt es Verliese.«
Das Mädchen verabschiedet sich und tritt wieder auf den Platz hinaus. Neben dem Haus des Propstes Heinrich von Duna ist das des Dekans das prächtigste. Sie klopft nicht an, sondern schiebt die Tür auf und tritt in die Halle. Juliana war schon oft hier, entweder mit den Eltern zum Mahl geladen oder zu ihren Unterrichtsstunden bei dem väterlichen Freund, der mit ihr in Büchern gelesen und sie Französisch und Latein gelehrt hat. Sicher ist er in der kleinen Stube mit dem Kachelofen, in der er stets seine Mahlzeiten einnimmt, wenn keine Gäste zu bewirten sind. Vielleicht hat er den Vater mit zu sich genommen und sitzt jetzt in diesem Augenblick mit ihm zusammen bei Gewürzwein und kaltem Fleisch. Ihr Herz beginnt rascher zu schlagen. Die Hoffnung, ihn zu sehen, treibt sie an, die Angst vor der Wahrheit, die sie nicht hören will, hält sie zurück. Stufe für Stufe steigen ihre weichen Lederschuhe nach oben. Die Tür zur großen Stube ist nur angelehnt. Ein Lichtstreif fällt auf den Gang. Worte schallen ihr entgegen. Die Hand auf der Klinke bleibt das Ritterfräulein stehen.
»Wenn ich diesen Pfaffen zwischen meine Fäuste bekomme!«, knurrt eine Stimme, die Juliana bekannt vorkommt.
»Wie könnt Ihr solche Reden führen!«, ereifert sich die noch helle Stimme des Jungen, der als Schüler und Page dem Dekan dient. »Mein Herr ist ein edler Mann.«
»Bruder Humbert, mäßige dich! Es steht dir nicht zu, so über den Dekan zu sprechen. Lass uns den Bericht erst zu Ende hören.« Es ist die weiche Stimme des Franzosen, Swickers Reisegefährten. »Nun, mein Junge, du sagtest, der Dekan sei heute Nacht mit dem Ritter von Ehrenberg in dieses Haus gekommen, und sie hätten lange beisammen gesessen und miteinander gesprochen?«
»Ja, Herr.«
»Aber nun sind sie nicht mehr da. Wohin sind sie gegangen?«
Juliana scheint es, als könne der Franzose nur mühsam seine Ungeduld zügeln.
»Ich weiß es nicht. Der Herr hat es mir nicht gesagt. Wenn er ausgeht, frage ich nicht wohin.«
»Hast du den Männern nicht Wein gebracht oder etwas zu essen?«
»Ja, schon«, gibt der Junge zu.
»Dann konntest du vielleicht hören, was gesprochen wurde.«
Eine Pause tritt ein. Irgendjemand räuspert sich. Dann hört Juliana wieder die unsichere Stimme des Schülers. »Ich glaube nicht, dass es mein Herr schätzt, wenn ich über seine Angelegenheiten plaudere.« Er hat das letzte Wort noch nicht ganz ausgesprochen, da rumpelt es in der Stube, als sei ein Stuhl umgefallen, und der Junge stößt einen Schrei aus.
»Sprich, du kleine Ratte«, brüllt Bruder Humbert, der Franzose schreit: »Lass den Jungen los, Humbert, ich warne dich nur einmal.« Für einige Augenblicke ist nur ein unterdrücktes Schluchzen zu hören.
»Hör zu«, fährt Jean de Folliaco in betont freundlichem Ton fort. »Mein Waffenbruder Ritter Swicker von Gemmingen-Streichenberg ist vergangene Nacht in der Pfalzkapelle von Kraft von Ehrenberg getötet worden. Davon hast du doch sicher gehört?« Anscheinend nickt der Junge.
»Gut. Der Dekan hat den von Ehrenberg in Gewahrsam genommen, der sein Ehrenwort gab, nicht zu fliehen und sich dem Gericht auszuliefern. Nun kommen wir hierher, und weder der Dekan noch der Mörder sind anzutreffen, wie es uns doch zugesichert wurde. Wie kann ich ohne meinen Waffenbruder zu unserem Großmeister zurückkehren und nicht einmal Auskunft darüber geben können, was aus dem Mörder und seinem Fürsprecher geworden ist? Also bitte, wenn du etwas weißt, dann sage es uns.«
Der Junge scheint zu überlegen. Endlich sagt er gepresst: »Ich brachte meinem Herrn und dem Ritter von Ehrenberg Wein, Brot und Käse, als sie in der Nacht erschienen und nach mir schickten. Die Knechte und der Koch waren bereits nach Hause gegangen. Nur ich bleibe auch über Nacht. Sie sprachen von Orten, die ich nicht kenne, und von den Gefahren einer langen Reise. Als ich den Weinkrug noch einmal füllen kam, redeten sie über Burg Ehrenberg. Der Ritter wollte dorthin reiten, aber der Dekan verbot ihm, das Haus zu verlassen. Der Ritter sagte, es sei wichtig und dürfe nicht in falsche Hände geraten, dennoch wollte der Dekan nicht nachgeben. Später rief mich mein Herr noch einmal und trug mir auf, ein Bündel voller Proviant zu packen und eine Kürbisflasche mit Wein zu füllen. Er schickte mich auch nach einem alten Umhang und einem groben Hemd, die er in einer Truhe auf dem Boden aufbewahrte. Dann ist er gegangen. Der Ritter von Ehrenberg legte sich in der Gästekammer zur Ruhe, und auch ich suchte mein Lager auf, da man meiner nicht mehr bedurfte. Als ich am Morgen erwachte, waren weder der Ritter noch mein Herr im Haus. Ich kann Euch wirklich nicht mehr berichten. Ich schwöre es! Bitte glaubt mir.«
Anscheinend tun es die Brüder des Templerordens, denn Juliana hört den Jungen voll Erleichterung die Luft ausstoßen. Da schlägt unten die Haustür zu. Das Mädchen sieht sich panisch um. Wo kann sie sich verbergen? Schritte auf der Treppe. Sie schiebt die nächste Tür auf und schlüpft in die Schreibkammer mit dem Sekretär, ein paar Scherenstühlen und zwei großen Eichentruhen. Hinter der nur angelehnten Tür bleibt sie stehen und presst das Ohr an den Spalt.
»Einen gesegneten Morgen wünsche ich Euch«, hört sie die Stimme des Dekans. »Albert, du kannst jetzt gehen.« Er wartet, bis sich die Schritte des Jungen entfernt haben, ehe er weiterspricht. »So früh am Morgen habe ich die Herren Tempelritter nicht erwartet, sonst wäre ich natürlich zu Hause gewesen, um Euch zu empfangen. Ich hoffe, Ihr könnt mir verzeihen.«
Ein Knurren ist zu vernehmen, das vermutlich von Bruder Humbert stammt.
»Ich gebe zu, ich bin ein wenig irritiert«, antwortet der Franzose mit seinem weichen Akzent. »Wir möchten wissen, wo sich der von Ehrenberg befindet und wann der Prozess beginnen wird.«
»Es wird keinen Prozess geben«, sagt der Dekan sanft.
»Was?«, schreit der Wappner.
»Die Kirche hat ihr Urteil gefällt und dem Sünder eine Buße auferlegt, die ihn von seiner Schuld reinwaschen wird. Seid ohne Sorge, der Tod Eures Bruders bleibt nicht ungestraft.«
»Eine Kirchenbuße für einen Mord? Ein paar Ave Marias auf den Knien beten? Das ist zu wenig«, schaltet sich Jean de Folliaco wieder ein. »Ich frage Euch noch einmal: Wo habt Ihr ihn versteckt? Ich möchte mit ihm sprechen.«
»Das ist nicht möglich«, antwortet Gerold von Hauenstein. »Er ist nicht mehr in Wimpfen. Ich habe ihn schon vor Stunden verabschiedet.«
Juliana presst die Hand vor die Lippen, um den Schrei zu unterdrücken, der in ihr aufsteigt. Der Vater ist bereits weg. Ohne ein Wort des Abschiedes, ohne einen Gruß oder Segen – und ohne eine Erklärung.
»Weg? Ihr habt ihn gehen lassen?« Eine Pause entsteht. Der Templer stößt einen Pfiff aus. »So ist das, eine Bußpilgerschaft habt Ihr ihm auferlegt. Wohin? Für einen Mord wird er ja sicher nicht nur zur Wallfahrtskapelle ›Unserer lieben Frau im Nussbaum‹ auf den Höchstberg geschickt«, sagt er ein wenig sarkastisch.
»Nein, da habt Ihr Recht, Tempelritter«, bestätigt der Dekan in seiner ruhigen Art. Juliana ist es, als könne sie ihn sehen, wie er vor den erregten Männern steht, mit hocherhobenem Kopf, zu seiner beeindruckenden Größe aufgerichtet, die Arme vor dem Leib verschränkt, die Hände in den weiten Ärmeln verborgen. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen – zumindest hat Juliana das, seit sie sich erinnern kann, nie erlebt.
»Nun sagt uns schon, wohin er sich auf den Weg gemacht hat, damit wir unserem Großmeister berichten können.« Der Franzose lässt nicht locker. »Habt Ihr ihn nach Rom geschickt?« Er lacht kurz auf. »Oder gar bis ins Heilige Land?«
»Tut mir Leid, ich kann Euch keine Auskunft geben. Das ist eine Sache zwischen dem Ritter von Ehrenberg und seinem Beichtvater, das müsst Ihr verstehen. Und nun bitte ich Euch, zu gehen. Ich muss mich eilen, dass ich noch rechtzeitig zur Kapitelversammlung komme.«
»Verfluchter Pfaffe, so einfach kommt Ihr nicht davon!«, ereifert sich der Wappner.
»Bruder Humbert«, ruft der Franzose harsch, »wenn wir zurück sind, wirst du diesen Vorfall beichten und für diesen Fluch und die Beleidigung eine Strafe auf dich nehmen!«
»Ja, Ritter de Folliaco«, murrt der Servient. Die beiden Männer verlassen die Stube. Juliana sieht die Gestalten in den Flur treten und die Stubentür sorgfältig hinter sich schließen.
»Ich wüsste zu gern, wo der Dekan sich heute Nacht herumgetrieben hat«, murmelt der Templer, als er auf die Treppe zustrebt.
Das ist auch eine Frage, die Juliana keine Ruhe lässt. Sie begibt sich zum Westtor und fragt die Wachen. Es dauert eine Weile, bis sie den Mann gefunden hat, der in der Nacht am Tor stand.
»Seltsam, das haben mich auch der Templer und sein Wappner gerade erst gefragt«, sagt der Wächter und mustert Juliana vom Kopf bis zu den Füßen.
»Und, hast du ihnen die gewünschte Auskunft gegeben?«, bohrt das Mädchen weiter.
»Nein.«
»Was heißt nein?« Sie unterdrückt einen Seufzer. Sehr gesprächig ist der Wachmann nicht gerade. Jedes Wort muss man ihm wie einen Wurm aus der Nase ziehen.
»Nein heißt, dass ich den Herrn Dekan nicht gesehen habe und ihnen die gewünschte Antwort nicht geben konnte.«
Das Mädchen mustert den Posten mit zusammengekniffenen Augen. Sagt er die Wahrheit? Hat der Dekan die Stadt nicht verlassen? Dann kann er auch nicht nach Ehrenberg geritten sein. Juliana erkundigt sich noch nach ihrem Vater, aber anscheinend hat auch er dieses Tor in der Nacht nur stadteinwärts passiert.
In Gedanken wandert das Mädchen die breite Hauptstraße entlang, die hinter dem Osttor in die Landstraße übergeht. Diese führt weiter nach Eisesheim und dann bis Heilbronn am anderen Ufer des Flusses. Wenn der Vater nach Süden reist, dann hat er die Stadt sicher in diese Richtung verlassen. Ein Schatten berührt sie. Juliana schreckt zurück und sieht auf – direkt in die dunklen Augen des Franzosen, der ihr zusammen mit dem Wappner entgegenkommt. Der Tempelritter bleibt stehen und neigt den Kopf.
»Verzeiht, edles Fräulein, ich wollte Euch nicht erschrecken.« Er tritt beiseite in den von Karrenrädern durchfurchten Morast und lässt das Mädchen passieren.
»Danke«, stotterte sie, rafft die Röcke und eilt weiter. Es ist ihr, als spüre sie seinen Blick im Rücken. Hat er sie erkannt? Sie muss es annehmen, war er doch mit seinem Waffenbruder und dem Servienten zwei Tage auf Ehrenberg zu Gast. Vielleicht jedoch war auch er in Gedanken versunken und hat daher nicht recht hingesehen. Immerhin hat er sie nicht mit ihrem Namen angesprochen.
Juliana traut sich nicht sich umzudrehen, zu sehr fürchtet sie, dass sie sich damit erst recht in seinen Geist drängt.
Der Wachmann am Osttor erkennt das Ritterfräulein und lässt sich durch ihr Flehen schnell erweichen. Vermutlich hofft er, dafür noch ein paar makabere Details dieses aufregenden Vorfalls aus dem Mund der Tochter zu erfahren.
»Es war bestimmt noch zwei Stunden vor dem Morgengrauen, als Euer werter Herr Vater hier auftauchte, angetan mit einem einfachen Mäntel und mit einem Stab in der Hand, wie einer dieser gewöhnlichen Pilger, die manchmal im Stift Unterkunft begehren. Erst hatte er ja vor, mit dem Boot meines Oheims und dessen Sohn über den Fluss zu setzen, aber zu dieser finsteren Stunde würde keiner der Apostelfischer seinen Kahn zu Wasser lassen – und bis zum Morgengrauen, wenn die Fischer ohnehin auf den Neckar rausfahren, wollte er nicht warten. Also ließ ich ihn zum Türlein hinaus und schloss es hinter ihm wieder sorgfältig ab«, betont der Mann.
»Warst du nicht erstaunt, dass er um diese Zeit und in so ungewöhnlicher Kleidung vor dir stand?«, will Juliana wissen, die wohl ahnt, dass sich der Wächter diesen Verstoß gegen die Stadtordnung hat versilbern lassen.
Er schüttelt den Kopf. »Nein. Unser verehrter Dekan von Hauenstein war ja vorher bei mir und hat mir seinen Wunsch dargelegt, als er mit seinem Ross um Mitternacht davonritt. Er zeigte sich sehr großzügig.« Der Wächter errötet. »Wie könnte ich mich den Bitten eines so wichtigen Mannes im Stift verweigern?«
Also hat der Dekan dafür bezahlt, dass der Vater bereits seit Stunden auf der Reise sein kann.
»Das war ganz richtig von dir«, lobt ihn Juliana, obwohl er ihr dadurch die Möglichkeit geraubt hat, sich von ihrem Vater zu verabschieden.
»Ach, waren gerade der Templer und sein Wappner bei dir und haben dir ähnliche Fragen gestellt?«
»Ja, woher wisst Ihr das?«
Juliana zuckt mit den Schultern. »Das war nicht schwer zu erraten«, murmelt sie. »Und? Hast du ihnen Auskunft gegeben?«
Die Augen des Wächters huschen unruhig umher. »Nein, was denkt Ihr? Das sind Angelegenheiten der Stadt und des Stifts. Da hat sich so ein fremder Templer nicht einzumischen. – Noch dazu ein Franzose!«, fügt er hinzu.
»Aber nun berichtet mir, Fräulein, wie hat sich das Unglück in der Pfalzkapelle zugetragen?« Sein Blick ist nun fest auf das Gesicht vor ihm gerichtet.
Das Mädchen seufzt. Das ist wohl der Preis, den sie für seine Auskünfte bezahlen muss.