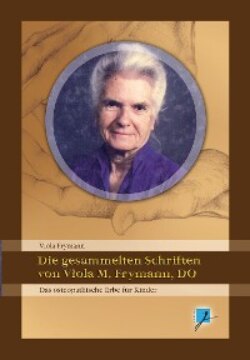Читать книгу Die gesammelten Schriften von Viola M. Frymann, DO - Viola M Frymann - Страница 11
1. DER ZUSAMMENHANG VON STÖRUNGEN DES KRANIOSAKRALEN MECHANISMUS MIT DER SYMPTOMATIK BEI NEUGEBORENEN: EINE STUDIE MIT 1.250 NEUGEBORENEN
ОглавлениеViola M. Frymann, DO, FAAO
Genehmigter Nachdruck aus JAOA (65)
1059 - 1075, 1966
In dieser Studie wird die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen der Symptomatik bei Neugeborenen und den anatomisch-physiologischen Störungen des Kraniosakralen Mechanismus erforscht. Die Hypothese des Primären Respiratorischen Mechanismus postuliert eine rhythmische kraniale Bewegung, die von außen palpiert werden kann, und die aus dem kombinierten Effekt der inhärenten Motilität des Zentralen Nervensystems, der Fluktuation der Zerebrospinalen Flüssigkeit, des reziproken Spannungsmechanismus der Dura mater und ihrer Auffaltungen und der Gelenkbeweglichkeit der Schädelknochen und des Sakrum zwischen den Ossa ilia hervorgeht. Die Wehen haben unter Umständen einen offensichtlich traumatischen Effekt auf den Kraniosakralen Mechanismus. Strain-Muster innerhalb der sich entwickelnden Teile des Os occipitale scheinen signifikant an der Auslösung von Symptomen des Nervensystems beteiligt zu sein. Bei nervösen Säuglingen wurden ein Flexions-Strain an der Symphysis sphenobasilaris, ein sakraler Extensions-Strain und eine Kompression an der Symphysis sphenobasilaris festgestellt. Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Torsions-Strain der Symphysis sphenobasilaris mit Restriktion der Mobilität des Os temporale und den die Atmung und den Kreislauf betreffenden Symptomen.
Der Schädel ist zum Zeitpunkt der Geburt so beschaffen, dass er sich den bei der Geburt entstehenden Kräften bestmöglich anpassen und somit Traumata für das empfindliche Nervensystem minimieren kann. Zusätzlich besitzt er die größtmögliche Kapazität für eine Rückformung nach Vollendung der Geburt.
Zum Zeitpunkt der Geburt ist die Ossifikation der Schädelknochen noch nicht abgeschlossen: Os occipitale, Os temporale, Os sphenoidale, Os frontale und die Mandibula bestehen aus mehreren Teilen. Jeder Bestandteil dieser Knochen kann funktionell als ein separater Knochen betrachtet werden und ist im Stande sich im Verhältnis zum Nachbarknochen sowohl physiologisch in Reaktion auf die Kräfte, die aus dem Schädel selbst kommen und sich pathologisch auf ein von außen wirkendes Trauma zu bewegen. Ein gründliches Wissen über die betreffende Anatomie ist essenziell für das Verständnis der Symptomatik, die aus einem bestimmten Strain-Muster hervorgehen kann. Zudem wird es den Osteopathen zur primären Ursache hinter einem sich manifestierenden Symptom weisen.
Aus Zeitgründen kann hier nicht zu detailliert auf diese wichtigen Bereiche eingegangen und somit können nur herausragende Beispiele betrachtet werden.
Anatomische und Physiologische Betrachtungen1
Das Os occipitale besteht zum Zeitpunkt der Geburt aus vier Teilen: die Pars basilaris, den beiden Partes condylaris laterales und der Squama, die aus einem Zusammenschluss des membranösen interparietalen Okziput und dem kartilaginären Supraokziput hervorgeht und ab dem dritten Schwangerschaftsmonat gebildet wird. Diese vier Teile formen die anterioren, lateralen und posterioren Ränder des Foramen magnum. Eine Verschiebung ihrer gegenseitigen Verbindungen zueinander kann das Foramen magnum verzerren, was häufig auch der Fall ist (Abbildungen 1 - 6). Der Nervus hypoglossus durchtritt den Knorpel zwischen Pars basilaris, Massae laterales und Partes condylares (Abbildungen 2, 3, 5). Der Nervus hypoglossus repräsentiert den motorischen Nerv der Zunge und seine physiologische Funktion ist von herausragender Bedeutung für den Saug- und Schluckmechanismus. Das Foramen jugulare befindet sich unmittelbar antero-lateral zur Artikulation zwischen Pars basilaris und der Pars condylaris. Die Vena jugularis verlässt hier den Schädel auf beiden Seiten und sorgt für den Abfluss von 95 % des Blutes aus dem Kopf. Anterior zur Vena jugularis im Foramen jugulare liegt der Nervus vagus und der Nervus accessorius, die vom Nervus glossopharyngeus anterior wiederum nur durch ein Septum der Dura mater getrennt sind. Der Nervus glossopharyngeus sorgt für das Schlucken; der Nervus vagus hat weite Wirkungsbereiche, ist aber beim Neugeborenen besonders wichtig im Zusammenhang mit der neuromuskulären Physiologie des Verdauungssystems, des Kreislaufs und der Atmung. Mit anderen Worten, bei Unregelmäßigkeiten der Atmung, kardialen Störungen und Erbrechen oder hyperaktiver Peristaltik liegt eine Störung des Nervus vagus nahe.
Die Okziputbasis artikuliert anterior mit der Sphenoidbasis, von der sie durch einen Meniskus getrennt ist. Das Os sphenoidale entwickelt sich aus zwei Teilen, dem so genannten Prä- und dem Post-Sphenoid. Das Prä-Sphenoid ist anterior zum Tuberculum sellae turcicae platziert. Die Ala minor geht in sie über. Das Post-Sphenoid umfasst die Sella turcica sowie das Dorsum sellae und ist mit der Ala major und dem Processus pterygoideus verbunden. Das Prä- und das Post-Sphenoid vereinigen sich während des siebten oder achten Monats des fötalen Lebens. Zum Zeitpunkt der Geburt besteht das Os sphenoidale aus drei Teilen, nämlich dem Körper und den beidseitig vorhandenen Alae minores bzw. den Einheiten von Alae majores und Processi pterygoidei. Die extraokulären Muskeln haben ihren Ursprung im Ligamentum annulare, das die Fissura orbitalis superior, den Raum zwischen der Ala minor und der Ala major, überspannt. Dieselbe Fissur stellt einen Eingang für alle die okuläre und orbitale Funktion betreffenden Nerven dar. Eine Ausnahme bildet lediglich der Nervus opticus; er stellt zugleich den Ausgang für den venösen Abfluss des Auges und der Augenhöhle dar. Das Ganglion sphenopalatinum beeinflusst die Orbita und die oberen Atemwege tiefgreifend und liegt im Winkel zwischen dem Körper und dem Processus pterygoideus, welcher seinerseits mit dem Os palatinum artikuliert.
Der intraossäre epiphysiale Knorpel zwischen der Einheit der Ala major und dem Processus pterygoideus und dem Körper des Os sphenoidale liegt tief im Sinus cavernosus mit der ihn begleitenden Arteria carotis interna und der dritten, vierten, ophthalmischen Division des fünften und sechsten kranialen Nervs. Daher sollten okuläre, orbitale sowie nasale Symptome und Symptome in den oberen Atemwegen die Aufmerksamkeit auf jene Bereiche lenken, die mit den drei Teilen des Os sphenoidale in Verbindung stehen.
Das Os temporale besteht zum Zeitpunkt der Geburt aus zwei sich entwickelnden Anteilen: der Squama, die sich kurz vor der Geburt mit dem tympanischen Ring vereinigt, und der Pars petromastoidea (Abbildungen 1 und 6). Die Bedeutung der Integrität des Foramen jugulare, bei welchem die Pars petrosa ossis temporalis die antero-laterale Grenze formt, wurde bereits betont. Die Funktion des Hörens, des Gleichgewichts, der Bewegungen der Gesichtsmuskulatur und der dentalen Okklusion sind abhängig von der anatomisch-physiologischen Effizienz des Os temporale.
Beim neugeborenen Kind sind die Gelenkmechanismen des erwachsenen Schädels noch nicht ausgereift; es gibt noch keine Suturen, keine Verzahnungen, keine Gomphosen, überlappende und nicht überlappende Artikulationen usw. Die knöchernen Elemente der Schädelbasis entwickeln sich in ihrer kartilaginären Matrix, während jene des Schädeldachs in einer Membran aus dural-periostalem Gewebe eingehüllt sind, in dem sie sich entwickeln. So wird für die maximale Beweglichkeit der Basis gesorgt, um sich innerhalb der Begrenzungen der membranösen Einschränkungen den Mechanismen der Geburt und einem Zusammenziehen des Schädeldachs anzupassen. Die Bestandteile des Os frontale und des Os occipitale können eventuell über oder unter die Ossa parietalia und die Alae majores des Os sphenoidale gleiten, welche sich ihrerseits noch tiefer unter die Squama des Os temporale und die Alae majores des Os sphenoidale schieben können, um den Kopf so weit zu verkleinern, damit er durch den Geburtskanal treten kann (Abbildungen 1, 4). Sobald der gesunde Säugling schreit, wird der Schädel wieder ausgeweitet und danach folgt eine normale Entwicklung. Wenn das Kind jedoch eine geringe Vitalität aufweist oder die während der Geburt wirkenden Kräfte unverhältnismäßig stark waren, wird der Schädel durch die Aktivitäten des Kindes nur unvollständig entfaltet.
Dr. Sutherland2 beschrieb die rhythmische Bewegung des Schädels im Jahre 1939 in The Cranial Bowl. Eine solche Bewegung kann leicht mit empfindsamen Händen ertastet werden. Steele berichtete 1965 auf der Konferenz der Sutherland Cranial Teaching Foundation in Kirksville, Missouri, von bereits entwickelten Methoden für die Aufzeichnung dieser Bewegung. Es wird behauptet, dass diese palpierbare rhythmische Bewegung des Kranium einen kombinierten Effekt der inhärenten Motilität des Zentralen Nervensystems, der Fluktuation der Zerebrospinalen Flüssigkeit, des Reziproken Spannungsmechanismus der Dura mater und ihrer Auffaltungen, dazu der Gelenkbeweglichkeit der Schädelknochen und des Sakrum zwischen den Ossa ilia darstellt. Jede Komponente hängt von der anderen ab und ist für die Effekte der pathologischen Störungen in allen anderen Komponenten empfänglich.
Abbildung 1. Geschätztes Alter, pränatal. Beachten Sie die sich in der Entwicklung befindlichen Teile des Os occipitale. Das Foramen magnum ist durch die Asymmetrie der Partes condylares verzerrt. Die sich entwickelnden Teile des Os temporale sind erkennbar.
Diese Hypothese ist bekannt als der Primäre Respiratorische Mechanismus. Dabei handelt es sich nicht um eine willentliche Gelenkbeweglichkeit, die durch eine muskuläre Aktion ausgelöst wird, sondern um eine unwillkürliche Bewegung. Das ganze System funktioniert während der Respirationsphasen als eine Einheit.
Die mechanische Interpretation des Gelenkflächen-Designs der Schädelknochen, wie etwa die abgeschrägten Gelenkflächen, weist auf eine dem Respiratorischen Mechanismus zugehörige Bewegung hin. Dies bezieht sich nicht auf den Atemmechanismus des thorakalen Zwerchfells. Es ist ein eigenständiger Primärer Respiratorischer Mechanismus. Alle physiologischen Zentren des menschlichen Körpers, einschließlich des Atemzentrums, sind auf der Ebene des vierten Ventrikel angesiedelt. Der Primäre Respiratorische Mechanismus nimmt im Hinblick zum thorakalen Atemmechanismus durch das Atemzentrum eine primäre Stellung ein.
Abbildung 2. Geschätztes Alter, drei Monate. Die posteriore Fontanelle beginnt zu kalzifizieren. Beachten Sie die sich entwickelnden Teile des Os occipitale mit der auf beiden Seiten verlaufenden Rinne für den Nervus hypoglossus zwischen Pars condylaris und Pars basilaris. Beachten Sie auch die Asymmetrie der Fossa jugularis.
Dr. Sutherland3 beschrieb die Gelenkbeweglichkeit sehr lebhaft in einem unveröffentlichen Vortrag, den er 1944 im Des Moines Still College hielt, etwa so: Es gibt eine Gelenkbeweglichkeit der Schädelbasis, die aus Knochenkernen besteht, welche innerhalb kartilaginärer Substanz ossifizieren. Dies stellt die Schale des Schädels dar, wobei es in diesem Bereich ohne eine entsprechende Kompensation im Schädeldach keine Mobilität gäbe. Dort entstehen die Knochen durch Ossifikation der Membranen. Diese Kompensation wird durch zwei Eigenschaften erreicht. Eine davon ist die Bereitstellung der suturalen Bewegung, welche durch das gezahnte Design der Artikulationen zwischen den Knochen des Schädelgewölbes angedeutet ist. Die andere besteht in der Flexibilität, innerhalb der strukturellen Teile dieser aus Membranen entstehenden Knochen. Das Os sphenoidale, einschließlich der Sella turcica, kann man sich nun wie ein Rad mit Speichen vorstellen. So wie sich das Os sphenoidale dreht oder rotiert, bewegen sich die verschiedenen Stellen des Rades, wie es eben bei Speichen der Fall ist. Es handelt sich nicht um eine zurück- oder vorwärtsgehende Bewegung.
Abbildung 3. Geschätztes Alter, Neugeborenes. Beachten Sie die Distorsion des Foramen magnum, der Sphenoidbasis und der posterioren Nasenlöcher.
Das Os occipitale dreht sich ebenfalls wie ein Rad und beide Räder drehen sich zur selben Zeit. Während der Inspirationsphase in diesem Primären Respiratorischen Mechanismus, die Flexion genannt wird, dreht sich das radähnliche Os sphenoidale nach anterior und das Os occipitale nach posterior. Daher bewegt sich sowohl die Sella turcica als auch das anteriore Ende des Processus basilaris des Os occipitale nach superior. Während der Expirationsphase, die Extension genannt wird, passiert genau das Gegenteil: Das Os sphenoidale bewegt sich nach posterior und das Os occipitale nach anterior. Daher bewegt sich die Sella turcica nach unten, das anteriore Ende des Processus basilaris bewegt sich ebenfalls nach unten, und das Foramen jugulare sowie das Foramen magnum drehen sich genauso mit dem Rad, wie es vorweg durch die Speichen veranschaulicht wurde. Obwohl sich die Sella turcica und der Okziputbasis abwärts bewegen, bleiben sie wie in einem Bogen angeordnet.
Abbildung 4. Geschätztes Alter, pränatal. Tatsächlich handelt es sich um eine Distorsion der Mandibula. Beachten Sie die Asymmetrie der Partes condylares des Os occipitale, des Foramen magnum, der Ossa temporalia und daher auch der Mandibula.
Da sich die Ossa temporalia der Bewegung der Okziputbasis anschließen, werden sie im Hinblick auf ihre Form und ihre Anordnung zwischen dem Os sphenoidale und dem Os occipitale als nächstes betrachtet. Eine genaue Studie ihrer Gelenkflächen deutet auf die Mechanik jener Bewegung hin, die das Os sphenoidale und das Os occipitale während der Flexion und der Extension an der Symphysis sphenobasilaris ausführen. Das Os temporale bewegt sich dabei wie ein schaukelndes Rad. Die Partes petrosi sind auf einer Diagonale angeordnet, die nach vorne und zur Mitte des Kopfes zeigt. Diese diagonale Linie ist die Achse, um die sich der Knochen bewegt. Stellen Sie sich das Os temporale vor: Es liegt innerhalb der Schädelbasis zwischen dem Os occipitale und dem Os sphenoidale mit der Einkerbung an der Spitze der Partes petrosae und in Verbindung mit dem flachen Teil des Processus basilaris des Os occipitale. Bewegen sich Os sphenoidale und Os occipitale während der Inspirationsphase in Flexion, rotieren die Partes petrosae nach außen. Sobald sich das Os sphenoidale und das Os occipitale wieder in die Extension bewegen, rotieren die Partes petrosae hingegen nach innen. Bei der Außenrotation der Pars petrosa bewegt sich das Mastoid nach antero-lateral und der Processus mastoideus nach postero-medial, was wiederum zur Folge hat, dass bei einer Außenrotation der Partes petrosae das Mastoid an der Außenseite des Schädels prominenter ist und der Processus mastoideus weniger prominent. Im Fall der Innenrotation der Partes petrosae verhält es sich umgekehrt.
Daher gibt es auf der Außenseite des Schädels Beweise für eine Rotation der Partes petrosae, die sich auf das Innere des Schädels beziehen, und diese kann man fühlen. Die Ossa temporalia bewegen sich mit der Pars basilaris des Os occipitale, da sie aufgrund der kiemenähnlichen Artikulationen und auch durch den Processus jugulare bewegt werden. Sobald sich der Processus basilaris wie eine Speiche des okzipitalen Rades dreht, dreht sich die Pars petrosa des Os temporale mit. So gibt es eine zeitgleiche Bewegung zwischen den zwei Knochen an der Sutura okzipitomastoidale, welche der Bewegung des Deckels eines Einmachglases ähnelt. Zusammenfassend kann man daher sagen: Sobald das Os occipitale sich wie ein Rad dreht, wird der Processus basilaris nach vorne gedreht und die Processus jugulare sowie das Foramen magnum drehen sich auch nach vorne. Die Pars petrosa des Os temporale rotiert nach außen, das Mastoid wird an der Außenseite des Schädel prominenter, während der Processus mastoideus weniger herausragt.
Das sich radähnlich verhaltende Os sphenoidale dreht ebenfalls mit, wobei sich das anteriore Ende nach unten und die Alae majores nach vorne bewegen. Diese Bewegung lässt die Augen nach vorne und die Ecken der Bestandteile des Os frontale auf die Seite treten; daher gibt es ein Zurückweichen an der Sutura metopica, an welcher die beiden sich entwickelnden Knochen zusammenfinden.
In der Mittelinie artikuliert die Spitze des Os ethmoidale und der Körper des Os sphenoidale mit der Lamina perpendicularis des Os ethmoidale. Dieses artikuliert seinerseits mit dem Vomer, das wiederum mit dem Rostrum auf dem Körper des Os sphenoidale artikuliert. Das Vomer erstreckt sich wie eine Pflugschar über Gaumen und Maxilla.
Dreht sich das Os sphenoidale, kommt es zu einer geringen Gleitbewegung zwischen dem Os ethmoidale und dem Vomer. Der Processus pterygoideus stößt unter dem Körper des Os sphenoidale an und folgt dessen Bewegung wie die Speichen eines Rad nach unten, hinten und außen. Sie drehen sich zu den Einkerbungen auf der posterioren Seite des Os palatinum. Die Ossa palatina passen so in die Ossa maxillaria, dass der Processus pterygoideus die Maxilla ebenso nach außen und posterior dreht, wie auch die seitlichen Ecken des Os frontale. Die oberen Schneidezähne weichen zurück, genauso wie die Sutura metopica des Os frontale. Da die Alae majores und die Alae minores des Os sphenoidale einen Teil der Augenhöhlen formen, lässt die Vorwärtsbewegung der Alae majores bei der Flexion die Augäpfel hervortreten. Durch seine Artikulation mit dem Os zygomaticum kippt es die Alae majores bei der Flexion nach außen. Da der Processus zygomaticus des Os temporale sich mit der Pars petrosa in eine Außenrotation bewegt, hilft es auch bei einer Außenrotation des Jochbeins, welches wiederum die Außenrotation der Maxilla indiziert.
Abbildung 5. Geschätztes Alter, 1 - 1 ½ Jahre. Beachten Sie die Asymmetrie des Foramen magnum und der Fossa jugularis. Der intraossäre artikulierende Raum zwischen der Pars condylaris und dem basalen Anteil des Os occipitale, welcher den Nervus hypoglossus einschließt, ist deutlich von beiden Seiten zu sehen. Die Asymmetrie der Alae majores des Os sphenoidale ist offensichtlich, der linke steht relativ anterior zum rechten. Die Asymmetrie ist auch bei den posterioren Nasenlöchern, den horizontalen Platten der Ossa palatina und der Maxilla beobachtet worden.
Bei einem Schädeltyp mit Flexion und Außenrotation kommt es zu einer Expansion des Schädels mit geweiteten Augenhöhlen und prominentem Augäpfeln. Das Mastoid ist prominent und die Spitzen des Processus mastoideus weichen zurück. Bei einem Schädeltyp mit Extension und Innenrotation passiert genau das Gegenteil: Der Schädel ist eng, das Os sphenoidale ist nach hinten gedreht, das Os frontale nach innen und das Ethmoid ist nach posterior verengt. Die Maxilla steht oben und nach innen und das Os zygomaticum hat sich nach innen gedreht, was eine Verengung und Vertiefung der Orbita bewirkt. Die Partes petrosae stehen rotiert nach innen, was bedeutet, dass das Mastoid und die parietalen Ecken medial liegen und der Processus mastoideus hervorspringt.
Diese Beschreibung der Flexions- und Extensionsphasen der kranialen rhythmischen Bewegung ist notgedrungen kurz und beabsichtigt lediglich eine Andeutung der Grundlagen, die für diese spezielle Studie benötigt werden. Vollständigere Informationen hierzu ergeben sich aus den Kursen und Veröffentlichungen der Sutherland Cranial Teaching Foundation in Denver, Colorado.
Abbildung 6. Geschätztes Alter, 1 - 1 ½ Jahre. Beachten Sie das Foramen magnum und die Asymmetrie des Os temporale.
Die besagte rhythmische Bewegung muss solange weitergehen wie das Leben besteht. Ihr Muster mag durch physiologische oder pathologische Umstände gestört sein, ihre Frequenz kann verändert, ihre Amplitude vergrößert oder verkleinert sein, aber die Bewegung muss weitergehen. Bei der Erstellung der vorliegenden Stunde wurde herausgefunden, dass weniger als 12 % von 1250 Babys normale, symmetrische, frei bewegliche Mechanismen haben. Der Geburtsprozess stellt somit wahrscheinlich den häufigsten Belastungsfaktor dar, dem der Schädel ausgesetzt ist. Die effiziente physiologische Entwicklung und Funktion des darin enthaltenen Zentralen Nervensystems hängt von der Integrität dieses Mechanismus ab. Es ist daher an der Zeit, den Geburtsprozess in der Weise zu beurteilen, wie er sich auf eben diesen fein abgestimmten Kranialen Mechanismus auswirken kann.
Abbildung 7. Alter 5 1⁄2 Jahre. Achten Sie auf die anhaltende Asymmetrie des Foramen magnum, nachdem die Verknöcherung abgeschlossen ist.
Der Mechanismus der Geburt4
Während der Entwicklung nimmt der Fötus eine Flexionsstellung ein. Die Wirbelsäule beschreibt eine einzige, sanfte konkave Kurve nach vorne, wobei sich der Kopf zur Brust hinuntergebeugt. Während des Weges vom Leben im Uterus bis zur Geburt steigt der Fötus hinab, beugt sich, rotiert nach innen, streckt sich und rotiert schließlich nach außen. Dies geschieht als Folge der Schwerkräfte, der Gebärmutterkontraktionen, des Widerstands des knöchernen Beckens und der Weichteilgewebe der Mutter auf dem Weg des Deszensus. Die daraus resultierenden Kräfte, die auf den sich präsentierenden Teil einwirken, verändern dabei die Form und Postition so, dass der Fötus sich besser den Konturen der verschiedenen Ebenen des Geburtskanals anpassen kann.
Bevor die Wehen beginnen, ist der Fötus in einer unvollständigen Flexion und der okzipitofrontale Durchmesser präsentiert sich. Ist sein antero-posteriorer Durchmesser größer als jener des mütterlichen Becken, muss der Kopf mit seinem größten Durchmesser in den Geburtskanal eintreten und der längste Durchmesser wird als Transversale bezeichnet. Der Kopf trifft im Becken und seiner Beckenmuskulatur auf beträchtlichen Widerstand, welcher dazu dient ihn zu formen. Die Eminentia parietale posterior steigt bis zu einem Punkt unterhalb des Promontorium ab; somit liegt der größte Teil des Os parietale posterior über dem Inlet und die Sutura sagittalis liegt näher zum Os pubis als zum Sakrum. Während der Teil des Os parietale posterior gegen das Promontorium lehnt, bleibt er relativ stationär und bildet einen Drehpunkt. Die Eminentia parietale anterior wird stückweise nach unten hinter das Os pubis bewegt und bringt die Sutura sagittalis im Zentrum des Beckens in eine synklitische Position.
Abbildung 8. Alter 10 Jahre. Anhaltende Asymmetrie des Foramen magnum und der Fossa jugularis. Eine relative anteriore und mediale Stellung des linken temporomandibulären Gelenks verglichen zum rechten.
Steigt der Kopf während der Geburt weiter ab, trifft er auf den Widerstand der konvergenten Seitenwände des mittleren und unteren Beckens. Der Fötus wird immer weiter flektiert, da etwa gleichwertige Kräfte von den Beckenwänden gegen die Stirn und das Os occipitale einwirken. Sie bilden die beiden Arme eines Hebels, wobei das Foramen magnum das Fulkrum bildet. Da der anteriore Arm länger ist als der posteriore, steigt das Os occipitale mit jeder Kontraktion hinab, während die Stirn solange relativ stabil bleibt, bis die Flexion vollständig ist. Der kleinste Durchmesser des Kopfes, der subokzipito-bregmatische Durchmesser, kommt dann zum Vorschein.
Es findet auch eine Innenrotation statt, da das Sakrum und die unteren Seitenwände des Beckens nach innen und nach anterior abfallen, und weil die Musculi levator ani eine zweischichtige geneigte Ebene bilden und das daraus resultierende Gefälle auch in anteriore Richtung weist. Sobald das Os occipitale weiter hinabsteigt, trifft es auf die Muskelbäuche der Levatormuskulatur und die knöchernen Seitenwände und wird daher gezwungen, den Beckenboden hinauf bis zu einer Position unterhalb des Arcus pubis zu gehen. Sobald der anterior rotierte Kopf weiter hinuntersteigt, wird der subokzipitale Bereich unterhalb des Os pubis gedrückt und dient dort als Pivot, um den Kopf in die Extension zu rotieren. Dabei gleiten die Stirn, das Gesicht und eventuell auch das Kinn entlang der geneigten Ebene nach oben, entlang der Strukturen, die das Perineum bilden. Nachdem der Kopf geboren wurde, rotiert er in einen 45 Grad-Winkel auf die rechte oder linke Seite, um seine normale Beziehung mit dem Rücken und den Schultern einzunehmen.
Eine Anzahl an Faktoren kommen zu diesem normalen Mechanismus hinzu, nämlich (1) die Unterstützung der mütterlichen Unterleibsmuskulatur, um die fötale Flexion aufrechtzuerhalten, (2) der Widerstand des Beckenbodens, um eine Drehung des Kopfes nach innen auszulösen, während das Baby hinuntersteigt, (3) nicht zu viel oder zu wenig Platz im Becken für den Kopf, (4) normale Beckenform und (5) rhythmische progressive Gebärmutterkontraktionen bei gleichzeitiger Dilatation des Gebärmutterhalses.
Anomalitäten der Größe und der Form des fötalen Kopfes können bei Verformung durch ein zusammengezogenes Becken entstehen. Anomalitäten in der Position und der Präsentation, die wiederum den Kopfformen, können von Mängeln kommen, die aus den fünf oben aufgelisteten Faktoren resultieren. Schrittweise vergrößerte Grade der fötalen Extension können vorkommen und die Rotation mag verzögert oder aufgehalten sein. In solchen Momenten muss eine beträchtliche Verformung des Kopfes stattfinden, wenn der Kopf durch den Geburtskanal treten soll. Die traumatischen Auswirkungen einer andauernden okzipitoposterioren Position, einer Querlage im kleinen Becken, Brauen- und Gesichtsgeburtslagen („Sternengucker”) sind jeder Hebamme oder jedem Kinderarzt bekannt. Aber es ist wichtig, dass man die Effekte eines solchen Traumas im Detail versteht und somit ein Mittel der Linderung findet oder es komplett beheben kann.
Untersuchung der Neugeborenen
Jedes Kind dieser Studie wurde von dem Osteopath, der in der unmittelbaren Phase unmittelbar nach der Geburt anwesend war, komplett untersucht. Die spezielle strukturelle Untersuchung für diese Studie wurde innerhalb der ersten fünf Lebenstage gemacht, es sei denn das Kind benötigte eine bestimmte Isolation, wie etwa bei einigen Frühgeburten. In solchen Fällen wurde die Untersuchung so schnell wie es ging nach der Isolationsphase gemacht. Einzelheiten der Wehen, einschließlich der Parität der Mutter, wurden dokumentiert. Lag kein Wehenverlauf vor, wurde das Baby nicht in diese Reihe mit aufgenommen. Dies war das einzige Kriterium für einen Ausschluss aus dieser Studie. Insgesamt wurden 1.250 randomisiert ausgewählte Neugeborene in der Studie berücksichtigt.
Gebärende
Eine Primipara wird hier als Mutter definiert, die ihr erstes lebendes Kind zur Welt bringt. Dieser Ausdruck bezeichnet auch jene, die vorher schon Fehlgeburten mit einem nicht-lebenden Embryo oder Fötus hatten. 33 % waren Primipara, 67 % Multipara (Tabelle 1).
Geburtsdauer
Es wurden drei Wehenkategorien gewählt – kurz, mittellang und lang. Kurze Wehen wurden definiert als weniger als sechs Stunden, mittellange Wehen dauerten sechs bis zwölf Stunden und lange Wehen dauerten über zwölf Stunden. Die Studiengruppe zeigte folgende Verteilung: kurz: 32 %, mittellang: 36 %, lang: 33 % (Tabelle 2).
Geburtsgewicht
Babys mit weniger als sechs Pfund Geburtsgewicht wurden als klein bezeichnet, jene, die zwischen sechs und acht Pfund wogen, als mittelgroß, und große Babys waren jene, die acht Pfund oder mehr wogen. Etwa 10 % der Kinder waren klein, 64 % lagen in der mittleren Kategorie und 26 % wurden als groß eingestuft.
Geburtsmechanismus
Die Art der Verformung des Kopfes nach der Geburt wird durch die Stellung desselben bestimmt, wie sie sich beim Durchtritt durch den Geburtskanal zeigt. Der Kopf, der mit dem Os occipitale in posteriorer Richtung hinabsteigt, sich aber schließlich dreht und durch einen anterioren okzipitalen Mechanismus entbunden wird, wird aufgrund der posterioren okzipitalen Stellung zum mütterlichen Becken geformt. Dasselbe gilt für den Kopf, der durch eine Querlage im kleinen Becken geformt wurde. Es ist die Position, in welcher der Kopf die längste Zeit im Becken verbringt und das am längsten anhaltende Strain-Muster nach der Geburt bewirkt. Von allen aufgezeichneten Wehen hatten 79 % einen anterioren okzipitalen Mechanismus, entweder nach rechts oder links. 5 % waren in Steißlage, während die übrigen 16 % posterior-okzipitale Geburtslagen, Querlagen und Geburtslagen mit dem Gesicht nach vorne aufwiesen (Tabelle 4).
Art der Anästhesie
Die zwölf Fälle mit einer natürlichen Geburt ohne jede Betäubung oder Schmerzmittel waren entweder bei Müttern, die speziell nach dieser Methode fragten oder bei jenen, die eine sehr schnelle Geburt hatten, nachdem sie das Krankenhaus erreichten, und bei der keine Zeit mehr für die Anordnung einer Anästhesie möglich war. In 32 Fällen erhielt die Mutter eine Pudendusanästhesie und 27 Frauen erhielten lediglich ein paar Züge Äther während der starken Kontraktionen und der Geburt des Kopfes. Diese Gruppe stellt 6 % der Gesamtheit dar. Einige Arten der Spinalanästhesie, entweder eine peridurale Anästhesie (PDA) oder eine Sattelblockanästhesie wurden bei 67 % angewandt und 27 % erhielten eine inhalative Vollnarkose (Tabelle 5).
Art der Entbindung
Die Entbindung geschah entweder spontan, durch Zange oder per Kaiserschnitt. In drei Fällen wurde die Forceps-Entbindung angewandt, da der Kopf bei der Präsentation in Steißlage „nachkam” und bei einem Fall gab es eine Geburt durch Kaiserschnitt nach zu trägen Wehen und fehlgeschlagener Zangengeburt. 33 % der Entbindungen erfolgten spontan; bei 63 % war eine Zangengeburt nötig und bei 4 % ein Kaiserschnitt (Tabelle 6).
Der Bezug der „Art der Entbindung“ zur „Art der Anästhesie“ ist in Tabelle 7 dargestellt. Es ist offensichtlich, dass bei einer Spinalanästhesie häufiger die Zange als Hilfsmittel zur Geburt eingesetzt wird.
Untersuchung des Säuglings
Jedes anormale Verhalten oder entsprechende Symptome in der Phase unmittelbar nach der Geburt wurden dokumentiert. Diese wurden wie folgt klassifiziert: Jene ohne anormale Symptome waren in jener asymptomatischen Kategorie eingestuft, die 874 Fälle, einschließlich 14 Zwillingen umfasste.
Die Klassifizierung ‘nervös’ deckte jene Babys ab, die an Erbrechen, unersättlichem Appetit ohne jegliche Gewichtzunahme, hypertoner Muskulatur, an opisthotonen Spastiken, Tremor und Schlaflosigkeit litten (204 Säuglinge). Zusätzlich wurden fünf nervöse Kinder mit Gelbsucht und zwei lethargische Kinder ohne Gelbsucht in diese Kategorie eingeteilt, was eine Gesamtzahl von 211 ergab.
Die Gruppe der Säuglinge mit Problemen bezogen auf den Kreislauf oder die Atmung schloss jene Kinder mit einer schweren, unregelmäßigen oder brodelnden Atmung bzw. übermäßiger Schleimbildung (72 Babys) ein, jene Kinder mit zirkulatorischer Stase und deutlicher Zyanose (16, einschließlich zwei Zwillinge), nervöse Kinder mit Problemen der Atmung (7) oder mit zirkulatorischer Stase (7), Säuglinge mit Problemen der Atmung und Gelbsucht (3), mit Lethargie (1), mit zirkulatorischer Stase (50) und ein mongoloides Kind mit Problemen der Atmung (1). Die Gesamtanzahl in dieser Kategorie betrug 157 Kinder.
Es gab fünf Babys mit Gelbsucht, ein mongoloides Kind (angeborener Hypopituitarismus) und ein lethargisches Kind mit Gelbsucht. Diese acht Säuglinge machten die Gelbsucht-Mongoloismus-Kategorie aus. Die Gesamtzahl beträgt 1.250. Die Untersuchung schließt die Beobachtung des ganzen Kindes, seiner Haltung, seines Muskeltonus, seiner Reizbarkeit sowie Farbe und Form mit ein.
Unregelmäßigkeiten von Struktur oder Funktion wurden dokumentiert.
Die speziellen Vorgehensweisen bei der körperlichen Untersuchung werden in beachtlicher Genauigkeit beschrieben, aber für ein besseres Verständnis ihrer Bedeutung wird der Leser an die vorher präsentierte anatomische und physiologische Diskussion erinnert. Der Schädel eines Neugeborenen hat eine sehr empfindliche Struktur und die Herangehensweise muss mit äußerster Sanftheit erfolgen. Die Kunst der Palpation wurde in einer früheren Veröffentlichung5 beschrieben und es ist essenziell, eine sensible Wahrnehmung und ein Verständnis für den diagnostischen „Touch” in den Fingern zu entwickeln, wenn diese Störungen beim Neugeborenen entdeckt und korrigiert werden sollen.
Das Sakrum wird zuerst untersucht. Der Osteopath, der rechts neben dem auf dem Rücken liegenden Kind auf dem Untersuchungstisch sitzt, führt seine rechte Hand zwischen die Beine und legt sie unter das Sakrum, wobei er den Ellenbogen auf den Tisch legt. Die untersuchende Hand baut einen wahrnehmenden Kontakt mit dem Kreuzbein, den iliosakralen Artikulationen, den unteren Lendenwirbeln und der danebenliegenden Muskulatur auf.
Die rhythmische Bewegung des Sakrum ist eine empfindliche, sanfte mit dem Verlauf der Flexion und Extension schaukelnde Bewegung, die mit der leichten Bewegung eines Bootes auf ruhigem Wasser verglichen werden kann. Die palpierende Hand beobachtet die Position der Sakrumbasis, ob sie sich anterior wie bei der Extension oder posterior wie bei der Flexion befindet, ob sie auf einer Seite im Vergleich zur anderen superior steht und ob sie um eine Vertikal-Achse gedreht ist. Dies führt dazu, das es zum Os ilium auf der einen Seite relativ anterior und auf der Gegenseite posterior steht. Es findet eine sehr sanfte Aktivierung der physiologischen Bewegung der Flexion und Extension statt und es kann ein freies Bewegungsausmaß festgestellt werden. In einigen Fällen gibt es eine freie schaukelnde Bewegung; in anderen fühlt sich das Sakrum an, als wäre es entgegen der Extension eingeschränkt, das heißt, die Basis bewegt sich relativ stetig in anteriore Richtung, aber sie hat eine sehr geringe Schwingung nach posterior. Bei einem Flexions-Strain verhält es sich umgekehrt. Diese Flexions-Extensions-Bewegung kann durch eine Drehung um eine Sagittal-Achse verändert werden, welche die Sakrumbasis dazu bringt, links oder rechts höher zu stehen. Sie kann auch durch eine Drehung um eine Vertikal-Achse modifiziert werden, welche die eine Seite nach anterior und die andere nach posterior bringt. Es sind auch Spannungen im lumbalen Bereich aufgefallen.
Der Osteopath sitzt anschließend zur Durchführung der kranialen Untersuchung am Kopf des Babys. Die Größe und Form des Kopfes, Überschneidung oder Trennung von Suturen, die Größe der Fontanellen, das Vorkommen von Abschürfungen und Kontusionen, jede Gesichtslähmung, jede Art von Ödemen und die Symmetrie der Augen, des Mundes und der Nasenlöcher werden aufgenommen. Daraufhin wird der Kopf abgetastet, um seine Spannung, die Überlappung oder das Herausragen von Artikulationen und seine allgemeine Form zu evaluieren.
Die Partes condylares des Os occipitale werden als Nächstes untersucht, um ihre Position im Verhältnis zueinander und zum Atlas und ihre freie Beweglichkeit im Verhältnis zum Primären Respiratorischen Mechanismus zu bewerten. Bei der Spezifizierung einer Position sollte niemals vergessen werden, dass es sich um einen dynamischen Mechanismus handelt. Die Position spezifiziert demnach jene Richtung, in welche sich diese Struktur hauptsächlich im Vergleich zu der medianen symmetrischen Position einer balancierten Bewegung beim Normalen bewegt. Es gibt viele Fälle, in denen die komprimierenden Kräfte so stark waren, dass die inhärente Motilität in einem bestimmten Gebiet bis hin zu Null reduziert vorgefunden wird, aber es ist sorgfältiger, auch jene Gebiete des neugeborenen Schädel zu beobachten, die eine drastisch reduzierte physiologische Bewegung aufweisen, als lediglich jene, die überhaupt keine haben. Man kann die Bewegung durch einen Vergleich der beiden Seiten einschätzen: Zum Beispiel bewegt sich die rechte Pars condylaris bereitwilliger nach anterior als nach posterior. Daher sollte die benutzte Terminologie als eine Richtung des Strains bezeichnet werden; jene Richtung also, in welche sich der Balancepunkt in der Bewegung verschoben hat.
Mit dem Begriff „Kompression” wird eine deutliche Reduktion der inhärenten physiologischen Bewegung angedeutet und es ist oft nötig, einen Bereich zu dekomprimieren, bevor sein Bewegungsmuster evaluiert werden kann (Tabelle 8).
Abbildung 9. Diagramme der Schädeldächer von oben: A, Flexion; B, Extension; C, Torsion nach links; D, Side-bending-Rotation, konvex zur rechten Seite; E, Vertikal-Strain der Basis sphenoidalis superior; F, Vertikal-Strain der Sphenoidbasis, inferior; G, lateraler Strain mit der Basis sphenoidalis zur linken Seite hin.
Daher wird beim Bericht eine mögliche bilaterale Kompression als solche aufgenommen, obwohl das Ausmaß auf einer Seite viel größer sein kann als auf der anderen. Eine unilaterale Kompression wird folgendermaßen definiert: Eine Seite ist eingeschränkt und die andere Seite hat freie Beweglichkeit. Jene Fälle, bei denen es keine Einschränkung der physiologischen Beweglichkeit gab, wurden als ‘frei’ bezeichnet. In der ganzen Reihe wurden bei 31 %, also etwas weniger als einem Drittel frei bewegbare okzipitale Knochen festgestellt. Bei 46 % wurde ein Ausmaß an bilateraler Kompression, entweder schwer oder moderat festgestellt. Dabei wurde das Ausmaß danach bestimmt, wie leicht eine Dekompression erreicht wurde. Von 508 bilateralen Kompressionen wurden 97 oder 19 % als moderat eingestuft.
Die Bedeutung eines Strain-Musters kann nicht voll erfasst werden, wenn keine Nachuntersuchungen in der Phase der Kindheit stattfinden. Nichtsdestotrotz zeigt sich bei kritischer Betrachtung der verschiedenen klinischen Klassifizierungen ein Trend, der annehmen lässt, dass okzipitale Strains der Partes condylares von klinischer Signifikanz sind (Tabelle 8). Bei den asymptomatischen Säuglingen wiesen 37 % einen gewissen Grad an bilateraler Kompression der Partes condylares auf, bei nervösen Babys ließ sich hingegen bei 79 % ein schwerer Grad dieser Kompression nachweisen. Nervöse Babys zeigten keinerlei lediglich moderate Kompressionen. Auf der anderen Seite zeigten 39 % der asymptomatischen Kinder keine Anzeichen von okzipitalen Strains, während es bei den nervösen Kindern nur 5 % waren; 95 % der nervösen Kinder hatten irgendeine Art eines okzipitalen Strains. Während 61 % der asymptomatischen Kinder auch einen gewissen Grad an Strain-Mustern aufwiesen, so muss bemerkt werden, dass die Symptome der nervlichen Reizung nicht immer innerhalb der ersten Lebenstage auftreten. Des Weiteren folgt der Dekompression eines solchen okzipitalen Strains bei nervösen Kindern häufig eine sofortige Entspannung: Das Schreibaby hört auf zu schreien, das angespannte Kind entspannt sich und schläft, das sich übergebende Kind fängt nun an, die Nahrung bei sich zu halten.
Als nächstes wird die Motilität der Symphysis sphenobasilaris anhand des Kontaktes mit dem Schädeldach studiert. Die Zeigefinger sind auf den Anguli laterale des Os frontale und den Alae majores des Os sphenoidale, der kleine Finger ruht auf den Anguli laterale des Os occipitale und die übrigen Finger liegen über dem Os parietale und den Squamae der Ossa temporalia. Die Daumen überkreuzen sich oben, sind aber nicht in Kontakt mit der Sutura sagittalis. Dann werden die Daumen als Fulkrum benutzt, um dem Mechanismus sanft in Richtung Flexion, dann in Richtung Extension, zur rechten und linken Torsion, zu einer Side-bending-Rotation rechts oder links, zum vertikalen Strain mit superiorer Basis des Os sphenoidale, zum vertikalen Strain mit inferiorer Basis des Os sphenoidale und letztendlich zum lateralen Strain mit der Basis des Os sphenoidale zur rechten oder zur linken zu bewegen. Damit kann eine Einschätzung des Grades der anteroposterioren Kompression erhalten werden.
Flexion und Extension (Abbildungen 9A und B) wurden schon als physiologische Bewegungen des primären Respirationsmechanismus beschrieben. Ein Torsions-Strain (Abbildung 9C), der häufig durch eine Kompression der peripheren Artikulation in einem Quadranten des Kopfes sowie etwa dem Pterion oder dem fronto-sphenoidalen bzw. okzipito-mastoidalen Bereich verursacht wird, ist eine Rotation des Os sphenoidale und des Os occipitale in einer gegenläufigen Richtung um eine Sagittal-Achse.
Side-bending-Rotations-Strains (Abbildung 9D) resultieren häufig aus dem Druck auf die Seite des Kopfes über die spheno-squamöse Artikulation, welcher durch das sakrale Promontorium der Mutter entstehen kann, sobald der Kopf ins Becken eintritt. Dieser periphere Strain löst eine seitlich geneigte Rotation aus, das heißt, eine Rotation der okzipitalen und sphenoidalen Basis in entgegengesetzte Richtungen um die Vertikal-Achsen mit einer gleichzeitigen Drehung um eine Sagittal-Achse in derselben Richtung, hin zur Konvexität. Die Konturen des Kopfes deuten den Typus des Strain-Musters im Kopf an.
Vertikale Strain-Muster entstehen als Folge okzipitaler Kompression der Partes condylares oder einer Gesichtskompression bei Stirnlage. Die „Räder” des Os sphenoidale und des Os occipitale kann man sich so vorstellen: Sie rotieren um parallele Horizontal-Achsen in dieselbe Richtung und erzeugen so einen Abscher-Strain an der Symphyse. Es gibt eine flexionsartige Position des Os sphenoidale mit einer extensionsartigen Position des Os occipitale, sobald die Sphenoidbasis sich superior gedreht hat bzw. umgekehrt. Dreht die Sphenoidbasis superior (Abbildung 9E), lässt die Beobachtung von außen ein breites Gesicht, hervorstehende Augen, eine flache Sutura metopica, einen abgeflachten Gaumenbogen und ein enges Os occipitale und Schädeldach, ein abgeflachtes Mastoid sowie eine Prominenz des Processus mastoideus zum Vorschein kommen (beim Neugeborenen ist der Processus mastoideus noch nicht entwickelt, aber die Palpation des Ursprungs der zervikalen Muskeln, die aus ihm hervorgehen, bieten den nötigen Anhaltspunkt). Steht die Sphenoidbasis inferior (Abbildung 9 F), ist das Gesicht schmal, die Augenhöhlen klein, die Augäpfel zurückweichend, die Sutura metopica prominent und der Gaumenbogen hoch und eng, während sich das Os occipitale abgeflacht und die Ossa parietalia sich weit präsentieren und die Ossa temporalia am Mastoid prominent bzw. am Processus mastoideus zurückweichend sind.
Ein lateraler Strain der Symphysis sphenobasilaris (Abbildung 9G), respektive die gleichgerichtete Rotation des „Rades” des Os sphenoidale und des Os occipitale um die parallelen Vertikal-Achsen erzeugt die Kopfform, die uns als ein parallelogrammförmiger Kopf bekannt ist.
Da die Symphysis sphenobasilaris den zentralen Punkt dieser komplexen Artikulationsstrukturen bezeichnet, betrifft die sie beeinflussende Belastung automatisch alle anderen Teile des Kopfes. Torsions-Strains können ihre Ursache etwa in einer unilateralen Kompression der Partes condylares oder des okzipito-mastoidalen Bereichs bzw. fronto-sphenoidalen Bereiches haben, nur um einige der am häufigsten vorkommenden Ursachen zu nennen. Alle anderen Strain-Muster der Basis können in ähnlicher Weise mit den peripheren Strain verbunden sein. Jedoch erzeugen Distorsionen des gesamten Kopfes, wie in Abbildungen 9 und 10 gezeigt wird, primäre Strain-Muster des Primären Respiratorischen Mechanismus. Da es häufig vorkommt, dass es komplexe Muster gibt, die aus mehreren Strain-Elementen bestehen, wird eine Klassifizierung schwieriger. Daher wird eine Kompression des Mechanismus, die mit einer eingeschränkten Bewegung in allen Richtungen einhergeht, bei den abschließenden Analysen vorrangig betrachtet. Vertikale oder laterale Strain-Muster haben den Vorrang, mit Ausnahme der Kompression; Flexion und Extension sind gegenüber allen anderen Strain-Mustern nachrangig zu sehen (Tabelle 9). Die gleiche Analysemethode wurde auf die verschiedenen Studiengruppen angewandt (Tabelle 9).
Angesichts des häufigen Vorkommens eines Flexions-Musters bei nervösen Babys war es von Interesse zu bestimmen, wie viele Kinder der nervösen Gruppe verglichen mit der asymptomatischen Gruppe eine Flexions-Komponente bezogen auf die Kopfformen aufwiesen. Ein Flexions-Strain an der Schädelbasis kam bei Kindern mit neurologischen Symptomen noch häufiger vor als bei asymptomatischen Kindern (Tabelle 10). Das Ereignis einer Kompression ist auch sehr viel häufiger in dieser Gruppe.
Das häufige Vorkommen eines Torsions-Musters bei Kleinkindern mit Beschwerden der Atmung oder zirkulatorischer Stase wird in Tabelle 9 aufgezeigt. Das Vorkommen einer Torsion wurde dann in ähnlicher Weise aus den komplexen Strain-Mustern herausgelesen (Tabelle 11). Das häufige Vorkommen eines Torsions-Musters bei den Kleinkindern mit Beschwerden der Atmung oder zirkulatorischer Stase wird nochmals hinsichtlich der Strains im Temporalbereich betrachtet.
Die Ossa temporalia werden folgendermaßen untersucht: Das Os occipitale wird mit den hohlen Händen gestützt und die Zeigefinger liegen auf den Spitzen der Processi mastoidei. Die Positionen im Verhältnis zur relativen Prominenz der Ossa mastoidea werden als Maß für die Außen- bzw. Innenrotation benutzt. Eine sanfte Bewegung wird ausgelöst, um den Eindruck, der durch die Beobachtung der Position gewonnen wurde, zu bestätigen. Die Ossa temporalia werden Strain-Muster an der Symphysis sphenobasilaris reflektieren, aber sie können genauso durch die Kräfte, welche die okzipitomastoidalen, parieto-mastoidalen, spheno-squamösen oder zygomatico-temporalen Artikulationen komprimieren oder eindrücken, verzerrt werden.
Um die Aufzeichnung zu vereinfachen, wurde jedem Säugling mit einer eingeschränkten temporalen Beweglichkeit ein temporaler Strain zugeschrieben. Er wurde als rechts, links oder bilateral bezeichnet. Ob es sich bei dieser Einschränkung um eine Außen- bzw. Innenrotation handelt, konnte nicht unterschieden werden, noch wurden spezifische ätiologische Bereiche der Kompression erfasst, die im okzipito-mastoidalen bzw. spheno-squamösen Bereich auftraten. Da die Veränderung der lokalen physiologischen Funktion und ihre Wirkung auf den Primären Respiratorischen Zyklus klinisch signifikant sind, ist eine solche Reduzierung zulässig. Eine weitere Studie mit einem speziellen artikulierendem Bezug im Hinblick auf den Mechanismus während der Geburt wäre wahrscheinlich dazu geeignet, einige der Mechanismen, die für die Entstehung solcher Strains verantwortlich sind, vorzustellen.
Bei der Gruppe mit Problemen der Atmung oder des Kreislaufs kam der rechte temporale Strain am häufigsten vor. Zudem soll beachtet werden, dass weniger als 8 % dieser Fälle frei bewegliche Ossa temporalia aufwiesen, während sie bei 29 % asymptomatischen Kleinkindern frei beweglich waren. Des Weiteren kam es bei einem Release der eingeschränkten Ossa temporalia und der Wiederherstellung einer freien, rhythmischen Bewegung zu einer ruhigen, leichten, rhythmischen Atmung und einer Verbesserung der Hautfarbe des Kindes. Bei der Diskussion der Strain-Muster der Symphysis sphenobasilaris wurde in unserer Studiengruppe die Aufmerksamkeit auf das vermehrte Vorkommen von Torsions-Strains gelenkt. Restriktionen des Os temporale gehen einem Torsions-Muster an der Schädelbasis häufig voraus und es wird stets von Ungleichgewichten am Os temporale begleitet (Tabelle 12).
Bilaterale Restriktionen werden häufig bei nervlich angespannten Kindern gefunden. Es wird nochmals daran erinnert, dass eine Kompression der Symphysis sphenobasilaris auch ein sehr häufiger Befund bei solchen Babys war. Eine solche temporale Restriktion könnte die Folge eines absoluten komprimierenden Effektes eines großen Kopfes in einem kleinen Becken sein, einer geringeren Unverhältnismäßigkeit, welche die Geburt verzögert, aber letztlich doch eine vaginale Geburt erlaubt, oder sie kann sekundär sein zur antero-posterioren Kompression des teilweise erweiterten Kopfes, der die Mobilität an der Symphysis sphenobasilaris vermindert (Tabelle 12).
Zum Schluss wird in dieser Studie der untere Pol des Mechanismus, das Sakrum, betrachtet. Strain-Muster des Sakrum sind eng mit jenen innerhalb des Kopfes verbunden, da die Kernverbindung der Dura mater nicht nur am Foramen magnum, am Axis und C3 und seinem oberen Pol fixiert ist, sondern auch durch fibröse Bänder bis hin zum zweiten sakralen Segment an seinem unteren Pol6. Es wird etwa oft darauf hingewiesen, dass eine Kompression der Pars condylaris auf der rechten Seite mit einem Ungleichgewicht an der Sakrumbasis einhergeht, sodass die linke Seite im Verhältnis zur rechten etwas höher steht. Mit anderen Worten: Eine eingeschränkte Pars occipitalis inferior ist mit einer tiefer stehenden Sakrumbasis auf derselben Seite verbunden. Physiologisch betrachtet bewegt sich die Schädelbasis während der Inspirationphase in Richtung Flexion, welche als die Richtung der postero-superioren Bewegung der Schädelbasis und der anterioren Bewegung des Apex definiert ist. In der Gruppe mit nervösen Kindern wurde eine Flexion an der Schädelbasis bei 103 Kindern oder 49 % der Fälle gefunden und davon zeigten 76 Kinder auch ein in Extension fixiertes Sakrum. In der gesamten Gruppe mit 211 Kindern mit nervösen Symptomen, wiesen 142 oder 73,2 % einen schweren sakralen Extensions-Strain auf. In einigen Fällen stellte das Sakrum den Primärfaktor und sein Release entspannte das Kind und stellte die freie Beweglichkeit der Partes condylares occipitalis wieder her. Noch häufiger jedoch stellten die Partes condylares das vorrangige Problem dar, welches gelöst werden musste, bevor eine Reaktion im Sakrum oder die nervösen Symptome des Kindes betreffend erreicht werden konnten (Tabelle 13).
Abschließende Bemerkungen
In dieser Reihe mit 1.250 Babys waren 139 Kinder mit symmetrischen, frei beweglichen Kraniosakralen Mechanismen. Weitere sechs Kinder waren nur in einem Bereich moderat eingeschränkt, der so leicht gelöst werden konnte. Es wurde angenommen, dass die spontane Aktivität des Kindes, das Schreien und Saugen, diese Auflösung hervorgebracht hatte. Diese 145 Kinder, die anscheinend strukturell und funktionell voll und ganz gesund sind, repräsentieren nur 11,6 % aller untersuchten Kinder. Erkennbare Symptome der Gereiztheit des Zentralen Nervensystems waren offensichtlich bei 211 Kindern oder 16,88 %. Anzeichen für Probleme bei der Atmung oder des Kreislaufs gab es bei 157 Kindern oder 12,56 %. Bis zum fünften Lebenstag blieben 729 oder 58,32 % symptomfrei.
Eine Studie der Befunde bei den unterschiedlichen Studiengruppen lässt vermuten, dass jene Strains innerhalb der sich entwickelnden Teile des Os occipitale bei der Entstehung nervöser Symptome, wie etwa beim Erbrechen, bei der hyperaktiven Peristaltik, dem Tremor, der Hypertonizität und der Gereiztheit von beträchtlicher Bedeutung sind. Das Auftreten eines Flexions-Strains an der Symphysis sphenobasilaris und eines Extensions-Strains des Sakrum, einer unphysiologischen Kombination, ist ein weiterer Befund. Eine Kompression der Symphysis sphenobasilaris, die jegliche Bewegung eingrenzt, trat bei nervösen Kindern signifikant gehäuft auf.
Ein Torsions-Strain an der Symphysis sphenobasilaris und Restriktionen der temporalen Mobilität sind von Bedeutung bei Problemen der Atmung und des Kreislaufs.
Die gezeigten Abbildungen führen zu bestimmten Schlussfolgerungen, die es wert sind, weiter studiert und getestet zu werden. Jedoch zeigen diese Abbildungen nicht die Veränderungen, die geschehen, wenn diese Strain-Muster gelöst werden. Diese Studie war auch nicht dazu gedacht. Die wirklich dramatische Entspannung eines nervösen Kindes, sobald ein extendiertes Sakrum gelöst oder eine kondyläre oder sphenobasilare Kompression behoben wurde, sind Dinge, die beobachtet werden müssen, damit man sie in ihrer Gesamtheit verstehen kann. Die Wiederkehr der leichten Atmung oder einer gesunden rosa Hautfarbe eines Kind, mit zuvor brodelnder unregelmäßiger röchelnder Atmung bei der Wiederherstellung einer freien Beweglichkeit der Ossa temporalia legt eine bedeutende Verbindung zwischen Struktur und Funktion nahe.
Aber was ist mit den 729 asymptomatischen Kindern, die strukturelle Strain-Muster haben? Dies ist die Frage, die nur durch eine langfristige Nachfolge-Studie beantwortet werden kann. Wäre es vielleicht möglich, dass in der Antwort die Lösung für einige der ungelösten Probleme der Kindheit liegt?
Die Antwort könnte einen Teil jenes zerebralen Traumas erklären, das von Taft und Goldfarb7 in ihrer Diskussion der Ätiologie der kindlichen Schizophrenie als ein herbeigeführter Umstand bei einem genetisch bedingten Prozess beschrieben wird und der durch sämtliche Arten von Stress ausgelöst werden kann. Studien über die Schizophrenie bei Erwachsenen aus dem Team von Woods8 weisen auf das Vorhandensein einer eingeschränkten Beweglichkeit und Belastbarkeit des Kranialen Mechanismus hin.
Möglicherweise kann so auch die Antwort auf einige jener Fälle minimaler zerebraler Dysfunktionen gefunden werden, besonders in jener Gruppe, die Paine9 beschreibt und in der die pränatalen und geburtshilflichen Verläufe vollkommen frei von so genannten potenziellen zerebralen Störfaktoren sind. „Es wird im Allgemeinen behauptet”, stellt er fest, „dass ein geringgradiger mentaler Defekt bei einem Kind von intelligenten Eltern wahrscheinlich durch einen unglücklichen Unfall (pränatal, natal oder postnatal) passiert ist.” Dieser Unfall geschieht häufig während des Geburtsprozesses und hinterlässt seine Spuren in den anatomisch-physiologischen Mechanismen, welche das unreife und sich noch entwickelnde Zentrale Nervensystem enthalten, schützen und beeinflussen.
Oder sie wirft einen Lichtschimmer auf die Ursache und Vorsorge eines mentalen Handicaps. Sheridan10 bemerkte, dass viele Kinder mit einem mentalen Handicap an einer strukturellen oder funktionellen Anomalie leiden, die früher nicht bemerkt oder zu gering eingeschätzt wurden. Die momentane Arbeit von A. P. Warthman und Sr. Mary in Detroit, Michigan, die bisher unveröffentlicht ist, liefert beträchtliche Hinweise auf eine Verbindung zwischen langsam lernenden Kindern, den so genannten „Trödlern”, Kinder mit Leseproblemen und mental schwachen Kindern, welche mit einer anatomisch-physiologischen Störung des Kraniosakralen Mechanismus einhergeht.
Sie kann auch weitere Anhaltspunkte beim komplexen Problem der zerebralen Kinderlähmung liefern. MacKeith11 weist darauf hin, dass „bei nur etwa der Hälfte der Fälle von Kinderlähmung eine eindeutige Ursache bekannt ist.” Des Weiteren, „auch wenn es eine ‘offensichtliche’ Ursache, wie die nicht einsetzende Atmung bei der Geburt, gibt, kann diese fehlende Atmung bei der Geburt und die Kinderlähmung von zuvor bestehenden Faktoren herrühren.”
Bei der Studie des Primären Respiratorischen Mechanismus beim Neugeborenen wird zumindest ein Teil dieser bereits bestehenden Störung nachgewiesen und er weist auf Faktoren hin, die für viele andere Probleme der frühen Kindheit, des Schulkindalters und sogar des späteren Lebens, verantwortlich gemacht werden könnten.
Zusammenfassung
1.250 randomisiert ausgewählte Neugeborene wurden untersucht, um einen möglichen Zusammenhang zwischen anatomisch-physiologischen Störungen des Kraniosakralen Mechanismus und deren Symptomatik zu erforschen.
Der Grad der Ossifikation des Schädels bei der Geburt wird mit einer besonderen Aufmerksamkeit auf die sich entwickelnden Teilen des Os occipitale, der Ossa temporalia und des Os sphenoidale betrachtet. Die Signifikanz der intraossären Artikulationen zwischen diesen Teilen wird durch eine Berücksichtigung der eng damit verbundenen vitalen Strukturen erfasst.
Das anatomisch-physiologische Konzept von Dr. Sutherland, der Primäre Respiratorische Mechanismus, postuliert, dass die rhythmische kraniale Bewegung, die von außen tastbar und für die Aufzeichungen zugänglich ist, aus einem kombinierten Effekt der inhärenten Motilität des Zentralen Nervensystems, der Fluktuation der Zerebrospinalen Flüssigkeit, des Reziproken Spannungsmechanismus der Dura mater und ihren Auffaltungen und der Gelenkbeweglichkeit der Schädelknochen bzw. des Sakrum zwischen den Ossa ilia besteht.
Der Mechanismus der Geburt in jeglicher Form wird unter bestimmten Umständen als möglicher traumatischer Einfluss auf den Kraniosakralen Mechanismus in Erwägung gezogen.
Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass Strain-Muster innerhalb der sich entwickelnden Teile des Os occipitale von beträchtlicher Signifikanz bei der Entstehung von neurologisch bedingten Symptomen, respektive Erbrechen, hyperaktive Peristaltik, Tremor, Hypertonus und Reizbarkeit sind. Eine unphysiologische Kombination aus Flexions-Strain an der Symphysis sphenobasilaris und Extensions-Strain des Sakrum wird in dieser Gruppe von Kindern häufig gefunden. Eine Kompression der Symphysis sphenobasilaris kommt häufiger bei nervösen Babys vor.
Es wird angenommen, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen einem Torsions-Strain der Symphysis sphenobasilaris mit Restriktion des Os temporale und Symptomen bezogen auf Atmung und Kreislauf besteht.
Es wurde empfohlen, die mögliche ätiologische Bedeutung der Strain-Muster beim asymptomatischen neugeborenen Kind zu diskutieren und weitere Forschung anzustreben.