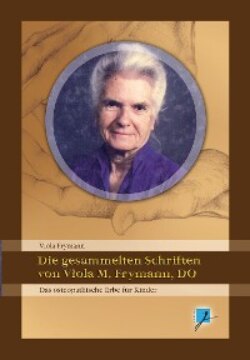Читать книгу Die gesammelten Schriften von Viola M. Frymann, DO - Viola M Frymann - Страница 15
3. LERNSCHWIERIGKEITEN VON KINDERN AUS DEM BLICKWINKEL DER OSTEOPATHIE
ОглавлениеViola M. Frymann, DO, FAAO
Genehmigter Nachdruck aus JAOA Vol. 76,
Sep 1976
Eine Skoliose der Wirbelsäule aufgrund eines Geburtstraumas oder eines Traumas im Kleinkindesalter spielt möglicherweise eine Rolle bei Lernproblemen von Kindern. Neuere Studien über die Entwicklung des Gehirns weisen darauf hin, dass es während der ersten beiden Lebensjahre am verletzlichsten ist und dass das Wachstum des Zentralen Nervensystems während dieser Zeit durch die Integrität des umliegenden fibrösen bzw. ossären Gehäuses beeinflusst wird. Eine traumatische Verwringung dieses Gehäuses, dem kranial-vertebral-sakralen Mechanismus, wird vielleicht erst sehr lange nach dessen Entstehung entdeckt, etwa wenn Lernprobleme den Osteopathen dazu veranlassen, dem Ganzen nachzugehen. Ihre Korrektur im Kleinkindesalter gibt Anlass zur Hoffnung, prophylaktisch wirksam zu sein. Osteopathische Behandlung als therapeutische Maßnahme hat die beste Prognose in der frühen Kindheit, aber auch älteren Kindern kann geholfen werden, ihr maximales Potenzial zu erreichen.
Von Zeit zu Zeit wurden unterschiedliche Faktoren für Lernprobleme bei Kindern verantwortlich gemacht. Einige davon sind Vererbung1, Trauma2, Unterernährung3, Hypoglykämie4, Allergien5, Störungen der Wahrnehmung6, psychischer Stress zuhause und vorausgegangenes Scheitern in der Schule7. Folgender Fall umfasst fast alle davon:
Fall 1. Ein zwölfjähriges Mädchen (Abbildung 1A) mochte nicht zur Schule gehen, da sie nicht mit der Situation im Klassenzimmer umgehen konnte. Sie hatte Schwierigkeiten in Rechtschreibung und ihr Begriffsvermögen war beeinträchtigt. In Mathematik war sie auf dem Niveau der dritten Klasse. Sie hatte Schwierigkeiten beim Lesen und konnte sich das Gelesene nicht allzu gut merken.
Ihre Kindergärtnerin hat ihr Angst eingejagt. In der ersten Klasse wurde sie fast gar nicht wahrgenommen und die zweite Klasse musste sie wiederholen. Als sie die sechste Klasse erreichte, drohte das Verlassen der Schule. Sie war das erste und einzige Kind einer hochgradig nervösen, neurotischen 35-jährigen Mutter. Eine „miserable” 9 ½-monatige Schwangerschaft, fünf Nächte mit vorzeitigen Wehen und fünfzehn Stunden voll schwerer unproduktiver Wehen endeten mit einem Kaiserschnitt.
Der Kopf des Säuglings wurde stark komprimiert. Die Atmung war verlangsamt. Während der neonatalen Phase und dem ersten Lebensjahr musste sie sich als Baby oft übergeben. Mit 18 Monaten hatte sie zeitweise starke Bauchschmerzen. Als sie sechs Jahre alt war wurde der Blinddarm entfernt, aber sie hatte immer noch häufig mit Bauchschmerzen zu kämpfen.
Mit vier Jahren wurde Kurzsichtigkeit festgestellt. Im Alter von zehn entwickelten sich Kopfschmerzen.
Asthma und Ekzeme stellen jüngere Entwicklungen dar. Ihr Appetit konnte als ‘heikel’ bezeichnet werden und ihre Ernährung bestand aus raffiniertem Getreide, übermäßig viel weißem Zucker, Süßigkeiten, stark verarbeiteten Lebensmitteln, Fleisch und Kartoffelbrei, Hamburgern und Burritos, selten einem Salat und niemals frischen Früchte.
Im Alter von zwei Jahren fiel sie aus dem Kinderwagen auf ihren Kopf. Ihr Vater hatte Schwierigkeiten Lesen zu lernen. Allergisches Asthma trat in der Familie stark gehäuft auf.
Der Einfluss der Umgebung auf die Psyche war angespannt, verunsichernd, abweisend und bedrückend. Ein fünfstündiger Glukosetoleranztest brachte eine reaktive Hypoglykämie ans Licht.
Ein Behandlungsprogramm wurde entwickelt um die muskuloskeletalen Auswirkungen des Traumas zu eliminieren, die Ernährung zu verbessern, die Hypoglykämie und die Allergien zu überwinden, die Wahrnehmungsfunktion umzuerziehen und die Situation zu Hause mit mehr Geborgenheit und Harmonie zu gestalten und somit auch ein produktiveres und angenehmeres Lernklima zu gestalten.
Innerhalb von zehn Monaten berichtete die Schule von einer ‘unermesslichen Verbesserung’ (Abbildung 1B).
Viele der zuvor angeführten ätiologischen Faktoren wurden in Fach- sowie Populärliteratur diskutiert, wobei die spezifischen Auswirkungen des perinatalen Traumas jedoch nur vermutet wurden. Rosenberg und Weller8 gaben einen Überblick über die Literatur und äußerten die Ansicht, dass bei vielen Kindern die Lernschwierigkeiten in der Schule von nicht diagnostizierten pränatalen oder perinatalen Schäden herrühren. Des Weiteren entsteht der klinische Eindruck9,10, dass eine osteopathische strukturelle Diagnose und die Behandlung einer Dysfunktion innerhalb des Kraniosakralen Mechanismus einen bedeutenden Beitrag zur Vermeidung und Verbesserung von Lernschwäche bei Kindern leistet.
Abbildung 1A. (Fall 1). Zwölfjähriges Mädchen am 1. November 1971 vor der Behandlung.
Abbildung 1B. Nach der Behandlung am 25. Januar 1972. Beachten Sie die Verbesserung des Gesichtsausdrucks, der Position des Kopfes auf dem Hals und die Erweiterung des Gesichtes relativ zur Länge, die sich in Folge der Behandlung eingestellt hat.
Gegenwärtige Studie
In der Hoffnung, das Problem beleuchten und einen Beitrag zu seiner Milderung leisten zu können, wurde eine Studie in Auftrag gegeben, um Antworten auf die folgenden Fragen zu erhalten:
1 Besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Kindern mit und ohne Lernproblemen bei der Geburt und der Entwicklung in der frühen Kindheit?
2 Besteht ein charakteristisches traumatisches Muster im Kraniosakralen Mechanismus bei Kindern mit Lernproblemen?
3 Besteht eine Signifikanz bezüglich des Traumazeitpunkts?
Das klinische Material stammte aus meinem privaten Gebrauch; dieser besteht aus Anamnesen einer Reihe unspezifisch ausgewählter Patienten zwischen 4 - 14 Jahren folgender Kategorien:
Gruppe 1 bestand aus 74 durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Schülern ohne Seh- und Lernschwäche, die allgemeinmedizinische Betreuung für eine Auswahl an gewöhnlichen Erkrankungen suchten.
Gruppe 2 umfasste 32 durchschnittliche oder überdurchschnittliche Schüler mit Sehschwäche, Kurz- bzw. Weitsichtigkeit oder Schielen, ohne Lernprobleme, die allgemeinmedizinische Betreuung für ein ähnliches Spektrum an gewöhnlichen Erkrankungen suchten.
Gruppe 3 setzte sich aus 103 Kindern zusammen, die Probleme in der Schule hatten, weil sie nicht in der üblichen von den etablierten Bildungssystemen geforderten Weise lernen konnten.
Definition des Problems
Der Begriff „Lernschwierigkeit” ist weder eingegrenzt noch präzise, aber er umschließt eine Vielzahl an Bedingungen, die einer Lernschwäche zugrunde liegen. Bowley11 behauptete, dass die Anzahl der Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen, mit Ungeschicklichkeit und Wahrnehmungsschwierigkeiten die Anzahl der Kinder mit unkomplizierter spezifischer entwicklungsbedingter Legasthenie bei Weitem übersteigt.
In modernen Gesellschaften ist das Lesen eine unverzichtbare Fähigkeit. Ein zwingender Ausruf vieler Eltern: „Aber er muss lesen lernen; er kommt im Leben nicht voran, wenn er nicht lesen kann.” Viele berühmte Männer in der Geschichte, darunter auch Winston Churchill, Bernard Shaw und Leonardo da Vinci, hatten große Schwierigkeiten lesen zu lernen. Sie wurden in ihrer frühen Kindheit als unglückliche Versager betrachtet und ihre Eltern litten sicher unter Verzweiflung und Ängsten, die wohl allen Eltern bekannt sein dürften, deren Kinder nicht in der Lage sind, lesen zu lernen.
Das Lernen kann man sich als einen Eisberg menschlicher Erfahrung vorstellen. Errungenschaften in allen Sphären der Bemühungen sind das sichtbare Bauwerk aus Eis. An der Wasserlinie befindet sich die Fähigkeit zu lesen, da es nur wenige Beschäftigungen im Leben gibt, bei denen das Lesen keine vorausgesetzte Kunstfertigkeit darstellt. Dennoch verstecken sich hinter dem Meer der „normalen Entwicklung” unzählige komplexe Entwicklungsstufen, die jenen Mechanismus bereithalten, aus dem sich die Fähigkeit zu Lesen entwickelt.
Geburt und frühe Kindheit
Das Neugeborene mit zwei gesunden Augen und einem kompetenten Zentralen Nervensystem empfängt die Schemen des Lichtes, des Schattens und der Farben auf der Retina und überträgt sie in die für optische Vorgänge verantwortlichen Bahnen des Gehirns. Aber es verstreichen Tage oder Wochen bis sich diese paarig angeordnete kommunikative Funktion, das Sehvermögen, herausgebildet hat. Das Datum kann exakt bestimmt werden: Es ist der Tag, an dem das Baby seine Mutter anschaut und plötzlich ein Lächeln über sein Gesicht huscht. Bei dieser ersten einfachen Erfahrung hat eine komplexe Schaltung das optische Abbild von der reizempfindlichen, empfangenden Retina in den auswertenden zerebralen Kortex übertragen; dort wird es mit dem ergänzenden Input der Erinnerung zusammengefügt und bewirkt nun über den motorischen Kortex und deren Bahnen zu den Zellkernen der Gesichtsregion eine Reaktion, die als fröhliche Bewegungen der Gesichtsmuskulatur beobachtet werden kann. Bereits im Alter von 10 - 12 Wochen hat sich ein Kreislauf entwickelt, der eine Reaktion einschließt, welche die oberen Gliedmaßen erreicht und eine Bewegung hin zum Mund und koordinierende Aktivitäten wie Saugen und Schlucken umfasste.
Mit etwa 9 oder 10 Monaten wird der ganze Körper inkl. der unteren Extremitäten in diesen visuellen Kreislauf eingebunden; das Baby sieht, reicht nach etwas, stellt sich auf Hände und Knie und krabbelt mit einer reibungslos verlaufenden integrierten Bewegung von Kopf, Hals, Schultern, oberen Extremitäten, Thorax, Wirbelsäule, Becken und unteren Extremitäten auf das begehrte Objekt zu. Die Komplexität dieser gewöhnlichen Aktivität wird oft solange unterschätzt, bis man sich mit einem Kind konfrontiert sieht, das nicht krabbeln kann oder das Arm- und Beinbewegungen nicht in dieser harmonischen Wechselseitigkeit kombinieren kann. Hierin zeigt sich oft erstmalig der erste Zusammenbruch des visuellen Systems.
Mit fast zwölf Monaten hat das gesunde Kind eine Welt über sich entdeckt. Es zieht sich auf die Beine hoch, steht, läuft, rennt und versucht zu klettern. Ein Kind, das nicht krabbelt, reagiert vielleicht auch auf die visuellen Attraktionen über ihm, aber die komplexen koordinierten Bahnen, die das Krabbeln mit sich bringt, sind noch nicht genügend gefestigt. Es fehlen ihm die feinen, koordinierten, harmonischen Interaktionen der Muskeln und des Skelettes, die erforderlich für das Gleichgewicht sind. Es fällt übermäßig viel hin; es kann seinen Körper nicht gewandt um Gegenstände und durch Türen bewegen. Es beginnt durch seine eigene Ungeschicklichkeit frustriert zu sein. Seine Eltern reagieren gereizt, weil es „ungeschickt” ist.
Imitation ist eine andere Reaktion des visuellen Kommunikationskreises, wodurch ein Kind viele Fähigkeiten, darunter auch die Sprache, erlernt. Sehen Kinder die Betätigung der Lippen, Zähne und dem Gesicht nicht, lernen sie nur langsam sprechen. Darüber hinaus ist Sprache nur ein weiterer Bestandteil des visuellen Schaltkreises. Das Kind sieht etwas, kann es nicht erreichen und ruft oder fragt danach.
Es sieht etwas Aufregendes und muss darüber sprechen.
Sprechen ist eine kompliziert koordinierte, harmonisch abgestimmte neuromuskuläre Aktivität, die dem Laufen folgt, und diese kann gleichermaßen verzögert oder beeinträchtigt sein, falls die Entwicklung in der Vergangenheit unvollständig oder gestört gewesen ist.
Der visuelle Schaltkreis kann eine emotionale Reaktion wie Weinen oder Lachen, Aggression oder Rückzug hervorrufen. Er kann eine intellektuelle Neugier erwecken, die sich im Auseinandernehmen und später im Zusammensetzen manifestiert. Jedoch erfordern solche Fähigkeiten eine Wahrnehmung für räumliche Zusammenhänge, Richtungen wie oben, unten, links, rechts, vorwärts und rückwärts. Bauen erfordert das Erkennen von Konturen, Formen bzw. Größe sowie der Zuordnung von bestimmten Objekten zu dazugehörigen Aussparungen. Dies ist eine Erweiterung des visuellen Schaltkreises. Das Kind, das keine Formen und Räume erkennen kann, wird keine Puzzlespiele in Angriff nehmen. Erkennt es keine Richtungen im Raum, wird es Projekte, die mit dem Bauen zu tun haben, meiden. Des Weiteren wird es Schwierigkeiten haben einen Ball zu fangen, ihn in die richtige Richtung zu werfen oder Seil zu springen.
Ist es fünf Jahr alt, wird von ihm erwartet, dass es kleinere, kompliziertere Formen wie etwa Buchstaben und Zahlen unterscheiden kann. Für die Kunstfertigkeit des Schreibens ist es nötig, diese zu reproduzieren. Um hier angemessene Leistungen zu erbringen, müssen zwei gesunde Augen so koordiniert sein, dass sie die Übertragung eines einzelnen Bildes in den visuellen Kortex gewährleisten können.
Die Anpassung der Pupillen an Licht und Entfernung und die feine Koordination der extraokulären Muskeln, um beide Augen auf das Objekt zu richten und eine exakte Wahrnehmung über Tiefe bereitzustellen, sind einige der essenziellen okulären Funktionen, die von der interaktiven Funktion zahlreicher Komponenten abhängen, u. a.: den neuronalen Segmenten des oberen Thorax, dem Stammhirn, den Nuclei und Tractus des II., III., IV. und VI. sowie dem ophtalmischen Anteil des V. Hirnnerven, dem Tractus opticus, den Verbindungsbahnen und dem okzipitalen Kortex. Des Weiteren müssen diese Bahnen harmonisch mit dem zervikalen und pektoralen Mechanismus, den oberen Extremitäten und tatsächlich auch mit der Haltung des ganzen Körpers interagieren.
Das Lesen schließt Erkennen, Auswerten, Erinnerung sowie das Verstehen einer Abfolge komplexer Vorgänge ein. Dies wird durch eine leichte Bewegung der Augen von links nach rechts entlang einer Druckzeile und die Übertragung der Impulse durch die Bahnen, die den auswertenden Bereichen des Großhirns zugeordnet sind, möglich. Dort werden die Informationen mit anderen Eindrücken aus dem Gedächtnis kombiniert und sie als initiierende Information an das Bewusstsein weiterleitet. Die ausgeführte Reaktion kann intellektueller (Interesse), emotionaler (Freude, Sorgen, Ärger oder Inspiration) oder physischer Natur sein (Sprechen, Schreiben oder Bewegung).
Sofern es keine groben Defizite in diesem visuellen Mechanismus gibt, wird die Wahrnehmungs-Dysfunktion selten vor den Aktivitäten im Vorschulalter erkannt. Frühere Schwächen werden normalerweise nicht als ein Teil dieses Lernmusters erkannt. Im Kindergarten tut sich das Kind schwer mit dem Alphabet oder es verwechselt d und b bzw. p und q. Es ist nicht in der Lage richtig zu zählen oder Zahlen zu erkennen. Es hat wenig Erfolg mit Puzzlespielen und fängt damit gar nicht erst an. Sobald es bemerkt, dass es nicht erfolgreich am geplanten Programm teilnehmen kann, sucht es nach etwas, das es tun, und nach einem Kameraden, mit dem es etwas unternehmen kann.
Auf dem Spielplatz ist das Leben nur wenig besser, da es keinen Ball fangen kann, ihn in die falsche Richtung wirft und nicht Seil springen oder sogar noch nicht einmal „Himmel und Hölle” spielen kann. Man bekommt ein offizielles Schreiben, dass es „unreif ” oder „hyperaktiv” ist bzw. stört und daher noch nicht reif genug für die erste Klasse sei. Entweder muss es sich der Demütigung eines weiteren noch frustierenderen Jahres im Kindergarten abfinden oder nach der Versetzung in eine andere Klasse herausfinden, dass sich seine Schwierigkeiten verschlimmern, da es das Alphabet nicht lesen, keine Wörter erkennen, nicht auf einer Linie malen kann und zudem keine Vorstellung von Zahlen hat. Es scheint, über Nacht zum Versager, zum Außenseiter, kurzum ein Problem für seine Lehrer und eine Enttäuschung für seine Eltern geworden zu sein.
Es vergehen vielleicht mehrere Jahre seines Lebens, bevor das wirkliche Problem erkannt und sogar noch mehr Zeit bis eine angemessene Betreuung organisiert wird. In der Zwischenzeit kann die Gewohnheit des Scheiterns so tief verankert sein, dass es auch dann schwierig wird sie zu überwinden, wenn aufgeklärte Helfer gefunden werden.
Gordon2 verwies auf die Ergebnisse einer Studie an britischen Schulen von Brenner und seinen Mitarbeitern12 und behauptete:
Da über 6 % der Kinder in Grundschulen eine bedeutende Störung des motorischen und des Wahrnehmungsapparates haben, liegt es auf der Hand, dass wir Osteopathen große Bemühungen dahingehend anstellen und versuchen müssen, die Gründe dafür zu finden.
Die Mehrzahl der Grundschulen in den Vereinigten Staaten hat mindestens ein Kind mit solchen Schwierigkeiten in jeder Klasse. Es ist ein häufiges Problem. Es verlangt Aufmerksamkeit.
In meiner Studiengruppe wurde der Geburtsverlauf studiert, um zu bestimmen, ob es einen signifikanten Unterschied beim Auftreten von traumatischen oder biochemischen Beeinträchtigungen in den Gruppen 1 und 2 verglichen mit Gruppe 3 gab. Solche Beeinträchtigungen werden in Tabelle 1 abgebildet.
Die Entdeckung, dass 72,8 % der Kinder, die später Lernprobleme entwickelten, verglichen mit 28,3 % ohne Lernprobleme, ein beträchtliches Trauma vor oder während der Geburt erlitten haben, war verblüffend. Außerdem war der Grad an Problemen und Traumata von weitaus höherer Intensität bei den Kindern in Gruppe 3. Beispielsweise erfolgte die Geburt bei 20 Kindern in Gruppe 3 (19,4 %) erst nach Wehen von 24 Stunden und länger, während nur drei (2,9 %) in Gruppe 1 und 2 eine solche Anamnese aufwiesen. Lange Spannen vorzeitiger oder unproduktiver Wehen, die in einem Kaiserschnitt gipfelten, wurden für 23 (22,3 %) der Kinder in Gruppe 3 verzeichnet und nur bei dreien (2,8 %) in Gruppe 1 und 2. Missbildungen des Neugeborenenschädels wurden für 25 (24,2 %) der Kinder in Gruppe 3 und nur bei vier Kindern (3,8 %) in den Gruppen 1 und 2 festgestellt. Dabei ist noch zu berücksichtigen, wie schwierig es für die Mutter ist, sich daran zu erinnern.
Die Anamnese eines Schädeltraumas während der ersten beiden Lebensjahren ist oft unzuverlässig, da die meisten Unfälle vergessen sind, es sei denn, das Kind musste genäht, mit einem Gips versorgt oder wegen einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. Möglicherweise wird einem bedeutsamem Trauma jedoch nicht die oben angesprochene spezifische Art von Aufmerksamkeit entgegengebracht. Die physiologischen Funktionen des Kraniosakralen Mechanismus können durch eine Verletzung, deren Symptome sich allmählich entwickeln, deformiert oder gestört werden, und der Bezug zur Verletzung ist für die Eltern oftmals nicht offensichtlich.
In Tabelle 2 werden Unfälle, an die sich erinnert werden konnte, gezeigt. Auf den ersten Blick könnte man schließen, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Vorliegen eines Traumas bei den Kindern in Gruppe 1 und 2 ohne Lernprobleme (27,4 %) und bei denjenigen in Gruppe 3 mit Lernproblemen (30,1 %) gibt. Jedoch verletzen sich die Kleinkinder in Gruppe 2 mit Sehschwäche fast doppelt so oft wie jene in Gruppe 1 ohne eine solche Schwäche. Einige der Unfälle konnten ohne Zweifel der Sehschwäche zugeschrieben werden, aber manche Unfälle könnten auch selbst zum Sehproblem beigetragen haben. Das höhere Vorkommen von Unfällen in Gruppe 3 kann die Folge von Wahrnehmungs-Dysfunktionen sein und ebenso dazu beigetragen haben.
In einigen Fällen erinnerten sich die Eltern daran, dass sowohl Leistungen als auch Verhalten des Kindes nach einem Unfall deutlich schlechter wurden.
Zum Zeitpunkt der Kopfverletzungen, die ausreichten um einen Schock oder eine Bewusstlosigkeit auszulösen, waren zwei der Kinder fünf Jahre und zwei von ihnen 9 Jahre alt. Bei zwei Kindern im Alter von einem bzw. zwei Jahren entwickelten sich ab dem Zeitpunkt der Verletzung verhältnismäßig schnell Hyperaktivität und Verhaltensprobleme, denen später Lernprobleme in der Schule folgten.
Das Vorkommen von Unfällen ab einem Alter von drei Jahren (Tabelle 2) bei Kindern mit Lernproblemen (Gruppe 3) zeigte sich fast dreimal so groß wie in den anderen Gruppen. Des Weiteren war der Schweregrad und die Häufigkeit solcher Unfälle höher. Dies kann als Folge von Koordinationsstörungen und Wahrnehmungs-Dysfunktionen, welche mit der Lernschwäche assoziiert sind, interpretiert werden.
Die zweite zu untersuchende Fragestellung lautete: Kann ein Strain-Muster, welches naturgemäß einzigartig bzw. individuell ausgeprägt ist, durch Palpation des Kraniosakralen Mechanismus des Kindes mit Lernproblemen diagnostiziert werden? Ein Blick auf Tabelle 3 verdeutlicht unmissverständlich, dass sämtliche Strain-Muster in allen Kindergruppen festgestellt werden konnten. Mit Ausnahme der rechts und linksseitigen Side-bending-Rotation kamen alle Strain-Muster bei den Kindern mit Lern- und Sehproblemen signifikant häufiger vor als bei Kindern ohne diese Probleme. Die Bedeutung dieses Strains für das visuelle Problem wird in einem anderen Artikel diskutiert. Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Strain-Muster wurde ebenfalls an anderer Stelle veröffentlicht.13
An diesem Punkt der Forschung wurde klar, dass ein perinatales Trauma eindeutig häufiger vorkam, obwohl kein signifikanter Unterschied in der Art der Strain-Muster bei 4 - 14-jährigen Kindern mit bzw. ohne Lernprobleme zu verzeichnen war. Die dritte Frage, die es zu beantworten galt, besteht daher in der Bedeutung des Zeitpunktes der Entstehung eines Strain-Musters: Unterscheiden sich die während der perinatalen Phase stattgefundenen traumatischen Auswirkungen bzw. jene während schwerer Wehen von den Auswirkungen ähnlicher Strains im späteren Leben?
Neuere Studien über die Entwicklung des Gehirns, die in erster Linie durchgeführt wurden, um herauszufinden, „ob Unterernährung während bestimmter Phasen der Gehirnentwicklung zu anhaltenden Veränderungen im Verhalten führen kann”, haben einige bedeutende und relevante Antworten in Bezug auf Lernprobleme geliefert. Dobbing und Smart14 definierten die zu beantwortende Frage wie folgt: ob … die Wachstumsretardierung, unter einer Vielzahl anderer wichtiger früher Umweltfaktoren als beitragender Faktor zur Summe der Einflüsse, die das „Erreichen” des Erwachsenseins bestimmen, identifiziert werden kann.
Ich würde einen Schritt weitergehen und fragen, ob nicht auch eine Skoliose der Skelettstruktur möglicherweise einen Faktor darstellt, dem eine Wachstumsverzögerung zugrunde liegt. Dies sind tiefgreifende und provozierende Fragestellungen, aber sie sind fundamental, um die Dimensionen der Ursache für die Probleme der Kinder umfassend zu verstehen.
Dobbing und Smart14 untersuchten zuerst:
… die Annahme, dass es Phasen gibt, in der die Verletzlichkeit der physischen Entwicklung des Gehirns, in denen Wachstumsverzögerungen zu andauernden Distorsionen und Defiziten der Gehirnstruktur des Erwachsenen führen können, größer ist.
Hierbei handelt es sich um quantifizierbare Störungen, die das Wachstum des Gehirns betreffen. Sie erkannten, dass „möglicherweise einige Fälle von bis jetzt nicht klassifizierter mentaler Retardierung solch eine messbare … Pathologie aufweisen.” In der Studie über die Wissenschaft der entwicklungsbezogenen Ernährung, mit der sich Dobbing und Smart beschäftigten, wurden drei in Wechselbeziehung stehende Parameter erkannt, namentlich der Schweregrad, die Dauer und der Zeitpunkt der Unterernährung. Sie bemerkten die Bedeutung des dritten Faktors, des Alters, bei Unterernährung. Er wies darauf hin, dass es Übergangsphasen erhöhter Empfindsamkeit gibt, die mit den empfindlichen Phasen während der Verhaltensentwicklung identisch sind. Der Begriff „verletzlich” wird nach Dobbing und Smart benutzt, um solche Phasen zu umschreiben, „die beides, eine andauernde Distorsion und ein andauerndes Defizit, nach sich ziehen”.
Es wurde eine Differenzierung zwischen der Phase mitotischer Zellmultiplikation und dem späteren Stadium des Zellwachstums erarbeitet. Die Autoren deuteten die Möglichkeit an, dass ein quantitatives neuronales Zelldefizit weniger Bedeutung für die sich entwickelnde Gehirnfunktion besitzt, wie Defizite bezogen auf die dentritische Verzweigung und beim Aufbau synaptischer Verbindungen. Diese bilden ein Äquivalent für das Verhältnis von Gehirn- bzw. Zellgröße dar und das kann auch auf andere Organe im Körper übertragen werden. Man wählte den Begriff „Wachstumsspurt”, um die Übergangsphasen mit hoher Wachstumsgeschwindigkeit zu bezeichnen.
Dobbing und Smart14 konstatierten:
Der Wachstumsspurt des Gehirns beginnt etwa zu der Zeit, in der die neuroblastische Multiplikation aufhört und die Anzahl an Neuronen des Erwachsenenalters schon fast erreicht ist, gegen Ende des zweiten fötalen Trimesters des Menschen … Er endet mit dem Ende der rapiden Hauptmyelinisierungsphase, während eines postnatalen Alters von etwa zwei Jahren.
Dobbing und Sands15 zeigten, dass der Wachstumsspurt des Gehirns auch dann zu einem vorbestimmten chronologischen Alter stattfinden muss, wenn die Bedingungen ungünstig sind. Dieser Effekt einer schlechten Ernährung verlangsamt somit den Prozess des Gehirnwachstums. Es erfolgt keine Verschiebung desselben.
Die vulnerable Phase für das menschliche Kleinkind schließt das dritte Trimester des fötalen Lebens und die ersten 18 - 24 Monate des postnatalen Lebens ein.14 Daher findet nur ein Achtel der vulnerablen Phase im Uterus statt.
Dobbing und Smart14 konstatieren:
Somit hängt viel von der Wachstumsrate während der verbleibenden sieben Achtel des Wachstumsspurts des menschlichen Gehirns ab. Folglich stellen die ersten anderthalb Jahre des postnatalen Lebens nicht nur eine Phase der Vulnerabilität dar, sondern auch eine der Chancen.
Welche Chancen? Wie kann diese Chance am besten genutzt werden, um Lernschwäche bei Kindern zu vermeiden oder zumindest einzudämmen? Der Aufbau eines ruhigen, harmonischen, sicheren und lebensbejahenden emotionalen und geistigen Umfelds, in welches das Kind hineingeboren wird und in dem es aufgezogen wird, ist überaus wichtig. Eine saubere Luft ohne Verschmutzung durch Smog, toxischen Insektiziden und Düngern, Tabakrauch und anderen Nebenprodukten dieses industriellen Zeitalters ist somit ebenfalls von essenzieller Bedeutung. Des Weiteren ist zur Schaffung optimaler Bedingungen in dieser Phase der Chancen ein biochemisch ganzheitliches inneres Milieu entscheidend, welches durch unverfälschte, unbehandelte, nicht verseuchte natürliche Nahrungsmittel in ausgewogenen Portionen geschaffen wird.
So essenziell diese Aspekte auch sein mögen, sie werden in dieser Arbeit nicht diskutiert. Mir geht es hier nicht um die das Kind umgebende Atmosphäre oder die Ernährung, auf deren Grundlage es seinen Organismus ausbilden muss, sondern um das Muster und die Leistung des neuromuskuloskeletalen Systems, innerhalb dessen es leben und mit dem es sich ausdrücken muss. In den ersten zwei Jahren seines Lebens stellt das Wachstum des Nervensystems eines der wichtigsten Funktionen dar. Dieses Wachstum wird bestimmt durch die Integrität des ihn ummantelnden fibrös-ossären Gehäuses – dem Kranial-vertebral-sakralen Mechanismus.
Anatomie
Einige anatomischen Eigenschaften des neugeborenen Schädels dienen entsprechend der Sache. Gray16 zufolge besteht das Os sphenoidale bei der Geburt aus drei sich entwickelnden Teilen; einem zentralen, bestehend aus dem Körper mit seinen Alae minores und zwei seitlichen, den Alae majores mit den Processi pterygoidei. Diese drei Teile sind vor dem Verschluss der Knochenfugen im Alter von etwa einem Jahr in der Lage sich gegeneinander zu verschieben. Die Fissura orbitalis superior bildet jenen Raum zwischen Ala major und Ala minor, durch den sämtliche Nerven der extraokulären Muskulatur sowie der III., IV. und der VI. Hirnnerv verlaufen. Auch die autonome Versorgung und die venöse Drainage erfolgen auf diesem Weg. Der sehnige Ursprungsring von vier Augenmuskeln befindet sich an der Wurzel der Ala minor bzw. dem Rand der Ala major. Daher wird die intaorbitale neuromuskuläre Funktion durch die funktionell-strukturelle Verbindung des sich entwickelnden Os sphenoidale beeinflusst.
Ein Lateral-Strain der Sphenoidbasis im Verhältnis zur Okzipitalbasis, welcher durch einen Strain im Uterus bzw. während der Geburt oder durch ein frühes postnatales Trauma verursacht wurde, erzeugt nicht nur einen Abscher-Strain bezogen auf die Artikulation zwischen dem Körper des Os sphenoidale und der Okzipitalbasis, sondern auch eine intraossäre Läsion an den sich entwickelnden intraossären Knorpelverbindungsstücken zwischen der Ala major, dem Processus pterygoideus und dem Körper auf der Seite, gegen die sich die Sphenoidbasis bewegt.
Eine Verschiebungen der Orbitaachse erfolgt aufgrund der Rotation des Os sphenoidale relativ zum Os occipitale; eine Verschiebung der Orbitaform hingegen entsteht bei medialem Strain der Ala major des Os sphenoidale und der Distorsion der Fissurra orbitalis superior, resultierend aus einer veränderten Position der Ala major und minor. Pathophysiologische Einflüsse auf jene Strukturen, die durch diese Fissura treten, sind wahrscheinlich.
Das Os temporale besteht bei der Geburt aus zwei sich entwickelnden Teilen, dem Petromastoid und der Squama. Die membranösen Ansätze des Tentorium cerebelli bewirken eine Bewegung der Pars petromastoidale gegenüber dem Okziput in postero-medialer Richtung und in antero-medialer Richtung gegenüber dem Körper des Os sphenoidale, wohingegen die Squama auf die Ala major des Os sphenoidale sowie das Os parietale reagiert.
Ein seitlicher Strain führt zu einer Distorsion der Verbindung der Okzipitalbasis zwischen den Partes petrosae. Die Squama des Os temporale bewegt sich mit der Ala major des Os sphenoidale. Dies führt zu einer intraossären Läsion des Os temporale, bei welchem die Squama antero-medial befördert wird, die zu einer Winkelöffnung der Achse des Os petrosum innerhalb der Basis führt. Entwickelt sich die Schädelbasis ohne Strains, bildet die Achse des Os petrosum auf einer Seite einen 90°-Winkel mit der gegenüberliegenden Seite. Die intraossären Läsionen des Os parietale bzw. Os sphenoidale sind verantwortlich für die Störung sowohl des III., IV. und VI. Hirnnerven und den ophtalmischen Anteil des V. Hirnnerven als auch für die Störung des Sinus cavernosus bzw. des Sinus petrosus, die eine venöse Drainage aus der Orbita ermöglichen.
Das Os occipitale besteht bei der Geburt aus vier Teilen und vereinigt sich erst im Alter von sechs Jahren zu einem Knochen. Demnach wird das Hinterhaupt in dieser vulnerablen Phase durch vier Knochen gebildet, welche das Foramen magnum umschließen. Fast alle wichtigen Nervenbahnen zwischen Gehirn und Körper durchqueren die von jenen vier Teilen des Hinterhauptes umbauten Aussparungen. Zudem verläuft der XII. Hirnnerv, der motorische Nerv der Zunge, zwischen den Partes condylares und der Pars basilaris. Neunter, zehnter und XI. Hirnnerv verlassen den Schädel in enger Verbindung zu derselben intraossären Artikulation. Bei der Präsentation des Hinterhauptes zeigt sich die okzipitale Squama, welche den Geburtskanal öffnen muss. Ein Missverhältnis oder die Rigidität der Zervix oder jede andere Obstruktion, die den symmetrischen Abstieg des Kopfes in den Geburtskanal beeinflusst, kann mittels der Squama oder den Partes condylares eine anteriore Kompression der Pars basilaris verursachen und es im Verhältnis zum Körper des Os sphenoidale verzerren. Symmetrische Kompression kann einen Vertikal-Strain erzeugen; asymmetrische Kräfte bewirken einen Lateral-Strain. Zudem besetzen die Hemisphären des Kleinhirns die inferioren Quadranten der okzipitalen Squama und die Okzipitallappen die superioren Quadranten. Eine Distorsion der okzipitalen Squama, die dazu führt, dass sich das Supraokziput flach und fest zeigt und der interparietale Teil verengt und zugespitzt ist, kann die Leistung der betreffenden Bereiche des Gehirns, die an der Koordination, dem Gleichgewicht und dem Sehvermögen beteiligt sind, beeinflussen.
So ein Trauma verformt nicht nur die Gehirnschale. Es kann auch durch die Dura mater übertragen werden, der Kernverbindung zwischen Kranium und Sakrum. Eine okzipitale Distorsion spiegelt sich in einer sakralen Fehlstellung. Des Weiteren stehen verschiedene Anteile des Gesichtsschädels mit der Schädelbasis in Verbindung. Die Distorsion des Schädels tritt häufig mit einer Skoliose der Wirbelsäule auf; sie ist maßgeblich dafür verantwortlich und untrennbar mit ihr verbunden. Der folgende Fall zeigt dies anschaulich:
Fall 2. Ein 7 ½-jähriges Mädchen (Abbildung 2A) wurde mit einem „krummen Kopf ” und einem Schiefhals geboren. Sie zeigte sich verlangsamt und lag in der Schule in den meisten ihrer Fächer unter dem Durchschnitt. Zudem zeigte sie ein explosives Temperament, sobald sie nicht das bekam, was sie wollte. Eine Untersuchung ergab eine schwere parallelogrammförmige Distorsion des Kopfes aufgrund eines Lateral-Strains der Symphysis sphenobasilaris rechts mit superiorem Vertikal-Strain und Kompression auf der rechten Seite. Eine kompensatorische Skoliose (Abbildung 3) wurde festgestellt. Man erstellte angesichts eines so schweren angeborenen Musters bei einem 7 ½-jährigen Kind eine vorsichtige Prognose und erst nach zwei Monaten wöchentlich erfolgender struktureller Behandlung wurde eine erfreuliche Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Leistung bemerkt (Abbildungen 2B, 3B).
Es ist wichtig, nochmals die rhythmischen Bewegungen des Kraniosakralen Mechanismus zu betonen.17 Distorsionen der anatomischen Form können die physiologischen Funktionen des Primären Respiratorischen Mechanismus beeinträchtigen, verhindern oder verzerren, was die inhärente Motilität des Zentralen Nervensystems und die fluktuierende Bewegung der Zerebrospinalen Flüssigkeit einschließt.
Wieder stellt sich die zwingende Frage: Was passiert während dieser „kritischen Phase“, durch welche die Distorsion des Kraniosakralen Mechanismus mit den Lernproblemen verknüpft wird, welche sich erst Jahre später manifestieren?
Mitten in der Nacht wachte ich auf und machte mich daran die Antwort aufzuzeichnen. Mit der Wahrnehmung beauftragte Nervenbahnen sind komplex und enthalten viele Verbindungen mit in Wechselbeziehung stehenden Funktionen. Nur wenige davon sind bereits zum Zeitpunkt der Geburt vorhanden. Die Struktur beeinflusst nicht nur die Funktion, funktionelle Muster formen gleichermaßen sich entwickelnde Strukturen. Im gesunden Kranialen Mechanismus können präzise geometrische Muster gefunden werden. Die Achsen der Orbitae überschneiden sich über der posterioren Grenze der Sella turcica und können auf die kontralaterale posteriore kraniale Fossa über dem Tentorium cerebelli projiziert werden. Die Achsen der Partes petrosae des Os temporale überschneiden sich innerhalb der Sella turcica hinter der Überschneidung der orbitalen Achsen und erstrecken sich in den Körper des Os zygomaticum auf der gegenüberliegenden Seite. Diese Achsen können als Kraftlinien palpiert werden, die sich von einer zur anderen Hand übertragen. Die anormale Anordnung in einem lateralen Strain-Muster ist daher auch durch Palpation verifizierbar.
Abbildung 2A. (Fall 2). Das 7 ½-jährige Mädchen am 6. Mai 1973 vor der Behandlung. Beachten Sie die parallelogrammförmige Deformität des Kopfes; das linke Auge und das linke Ohr stehen höher als auf der rechten Seite und der Kopf ist auf die rechte Seite geneigt.
Abbildung 2B. Nach der Behandlung am 3. August 1973.
Abbildung 3A. (Fall 2). Ansicht von hinten vor der Behandlung, die Skoliose zeigend (linke thorakale Konkavität, rechtes Ilium höher stehend, rechte Skapula tiefer stehend)
Abbildung 3B. Nach der Behandlung, die Haltung hat sich verbessert.
Abbildung 4 veranschaulicht die orbitale Achse und die Achse der Ossa petrosa auf der Ebene der Schädelbasis in einem hypothetischen symmetrischen Kranium.
Abbildung 5 zeigt die symmetrische orbitale Achse eines freien Kranialen Mechanismus, so wie er zu palpieren ist, wenn eine Hand über dem Orbit platziert ist und die andere den kontralateralen Teiles des Hinterhaupts in der Handfläche hält.
Abbildung 6 veranschaulicht die Distorsion der orbitalen Achse mit einem sphenobasilaren Lateral-Strain. Die Achse der linken Orbita ragt in Richtung des kontralateralen Teil des Os occipitale hinaus, jene der rechten Orbita wird hingegen auf eine eher mediale Position projiziert. Manchmal liegt sie auch auf dem ipsilateralen Teil des Os occipitale.
Abbildung 7 zeigt die symmetrischen Achsen der Ossa petrosa zwischen dem äußeren Gehörgang auf einer Seite und dem Körper des Os zygomaticum auf der gegenüberliegenden Wange.
Abbildung 8 stellt die Distorsion der Achsen der Ossa petrosa bei einem sphenobasilaren Lateral-Strain rechts dar. Die Achse des linken Os petrosum wird mit einem Finger auf dem äußeren Gehörgang und der anderen Hand auf dem Körper des Os zygomaticum getastet. Die Achse des rechten Os petrosum wird zwischen dem äußeren Gehörgang auf der rechten Seite und einem Punkt auf dem Processus zygomaticus des rechten Os temporale getastet. In vielen Fällen liegt dieser Punkt knapp hinter dem gegenüberliegenden äußeren Gehörgang.
Abbildung 4. Diagramm des Schädels, orbitale Achse sowie Achse der Ossa petrosa auf der Ebene der Schädelbasis zeigend.
Abbildung 9 zeigt einen Schädel, bei dem eine solche Distorsion sichtbar und tastbar ist.
Die auf diesen klinischen und anatomischen Beobachtungen gründende Hypothese besteht darin, dass diese geometrischen Formen die sich entwickelnden Nervenbahnen bestimmen. Sind diese Formen vor Abschluss der Entwicklung besagter Nervenbahnen verzerrt, müssen sie sich folglich mit der Distorsion entwickeln und bewirken eine Irritation bezogen auf den sensorischen Input bzw. verursachen eine schlechte Bewegungskoordination. Daher bekommt die Untersuchung und Behandlung des Kraniosakralen Mechanismus beim Neugeborenen und die weitergeführte Überwachung während der ersten zwei Jahre des Lebens eine vollkommen neue Bedeutung, wesentlich größer als es bisher der Fall war.
Kann man wirklich annehmen, dass man bei einem Schulkind, welches schon mit allen Problemen der Lernschwäche konfrontiert ist, den Lauf der Dinge nicht mehr signifikant zu verändern vermag, da es dann zu spät sein kann? Die Ergebnisse in den Fällen 1 und 2 legen dagegen nahe, dass sogar bei Kindern im Alter von zwölf Jahren noch nicht alles verloren ist, insofern der Osteopath die Aufmerksamkeit auf die zugänglichen muskuloskeletalen kraniosakralen Muster legt. Dies im sicheren Wissen, dass Strukturen und Funktionen sich wechselseitig beeinflussen und dass die Verbesserung sowohl der Struktur als auch der Funktion innerhalb des Primären Respiratorischen Mechanismus die neurologische Funktion und damit auch die intellektuelle Leistung verbessert. Die nachfolgenden Fälle sollen einige Möglichkeiten veranschaulichen:
Abbildung 5. Diagramm mit den symmetrischen orbitalen Achsen, so wie sie palpiert werden.
Abbildung 6. Diagramm mit einer Distorsion der orbitalen Achse und einem sphenobasilaren Lateral-Strain auf der rechten Seite.
Abbildung 7. Diagramm mit den symmetrischen Achsen der Ossa petrosa.
Abbildung 8. Diagramm mit einer Distorsion der Achsen der Ossa petrosa und einem sphenobasilaren Lateral-Strain auf der rechten Seite.
Fall 3. Ein siebenjähriges Mädchen (Abbildung 10A) war die Ältere von zwei Geschwistern. Ihre Geburt verlief unauffällig, aber im Alter von sechs Monaten fiel sie von einer Schaukel auf ihren Hinterkopf. Der Vater hatte Probleme das Lesen zu erlernen. Sie war ein passives Kind, aber sie setzte sich, krabbelte, lief und sprach in akzeptablem Zeitraum. Sie konnte kein Puzzle zusammensetzen, weder hüpfen noch springen und hatte große Schwierigkeiten das Fahrradfahren zu erlernen. Sie erlitt viele Stürze beim Rollschuhfahren. Im Kindergarten weinte sie, weil sie nicht zurechtkam. Zur Zeit der Untersuchung war sie immer noch sehr emotional und weinte beim geringsten Anlass. Sie erschien entweder überschwänglich oder depressiv. Es war für sie schwer, Anweisungen zu folgen und sie hatte Tagträume in der Schule. Sie war zappelig und angespannt und litt an einem Aufmerksamkeitsdefizit.
Abbildung 9. Foto des Schädels, bei dem die Distorsion sichtbar und tastbar ist.
Sie wurde von einem Augenoptikeri an mich verwiesen, der mit ihr bereits zwei Einheiten Sehtraining absolviert hatte, wodurch sich ihre Fähigkeit Formen und Umrisse einschätzen zu können verbesserte.
Zum Zeitpunkt meiner ersten Untersuchung am 19. April 1972 erwies sich ihre Arm-Bein-Koordination während des Laufens als ausreichend. Ihre Haltung im Stand zeigte ein Rotationsskoliose, welches beim Einbeinstand deutlicher wurde (Abbildung 11A). Das Ilium rotierte auf der Seite des angehobenen Beines nach hinten. Es lag eine Lordosierung der Lendenwirbelsäule vor. In Rückenlage war die Sakrumbasis auf der rechten Seite angehoben. Die Symphysis sphenobasilaris zeigte eine Linkstorsion bei rechtseitiger Side-bending-Rotation. Das rechte Os temporale stand in Außenrotation. Das Os occipitale schwankte leicht um eine Sagittal-Achse und stand auf der rechten Seite höher als auf der linken. Der harte Gaumen stand hoch und auf der rechten Seite nach außen sowie auf der linken Seite nach innen gedreht. Diese Zeichen legten mehrere traumatische Einwirkungen auf den Schädel nahe.
Abbildung 10A. (Fall 3). siebenjähriges Mädchen am 19. April 1972 vor der Behandlung.
Abbildung 10B. Am 14. Juni 1972 nach der Behandlung. Beachten Sie die verbesserte Zentrierung des Kopfes auf dem Körper und die anterograde Stellung der Augen.
Abbildung 11A. (Fall 3). Rückansicht vor der Behandlung.
Abbildung 11B. Nach der Behandlung. Die tiefer stehende rechte Schulter befindet sich nun auf Höhe der linken. Die Skoliose hat sich verbessert.
Am Ende des Schuljahrs nach sechs Behandlungen des gesamten Mechanismus in wöchentlichem Rhythmus wurde berichtet, dass sie sich stark verbessert hatte; sie war ruhiger, besser gelaunt und musste keine Nachhilfestunden mehr nehmen. Man plante sogar, sie im September in eine spezielle Klasse für begabte Kinder zu schicken (Abbildung 10B, 11B). Der Augenoptiker lieferte folgende Beurteilung18:
„Das Kind hat zwei sehtherapeutische Einheiten abgeschlossen, bevor es zu Dr. Frymann überwiesen wurde. Sie war zu diesem Zeitpunkt immer noch unfähig einige visuell-motorische Aufgaben zu bewältigen und ihre Haltung sprach nicht auf das Training an. Bezogen auf die Fernsicht bestand normale Sehschärfe und Muskelbalancefindung. Bei Nahsicht zeigte sich eine geringe fusionale Rückstellung und es war nicht möglich solide Informationen von weiteren Nahpunkttests zu ermitteln.“
„Nach Beendigung der osteopathischen Behandlung waren alle Zeichen von Sehschärfe, Muskelbalance und fusionaler Rückstellung bezogen auf Fern- und Nahsicht normal. Sie hatte gelernt, einen Stock umherzuwirbeln und Seil zu springen. Ihr Körperbewusstsein und Körperbild hatte sich verbessert und ihr räumliches Vorstellungsvermögen zeigte sich effektiver.“
Fall 4: Ein 8 ½-jähriger Junge war das dritte von sechs Kindern. Sein Geburtsgewicht betrug 3,76 kg, aber man konnte sich an keine Beschwerden erinnern. Er krabbelte nie und konnte im Alter von 8 ½ Monaten laufen. Mit 15 Monaten fiel er aus seiner Wiege. Seine Augen waren dilatiert und er war sehr ruhig. In der ersten Klasse „schnitt er nicht gut ab”. Zum Zeitpunkt der Untersuchung wiederholte er gerade die zweite Klasse und zeigte gar kein Interesse am Lesen. Er ging nicht gerne zur Schule und war sehr befangen.
Die Untersuchung ergab, dass er ein großer und schlanker Junge mit einer ängstlichen bedrückten Miene war. In aufrechter Position stand des rechte Ilium superior, die rechte Schulter superior und posterior und das rechte Ohr posterior und leicht inferior bezogen auf das linke Ohr. In Rückenlage stand das Sakrum auf der linken Seite leicht höher und der sphenobasilare Mechanismus wies einen rechten Lateral-Strain mit linker Torsionskomponente auf. Das rechte Os temporale war nach innen gedreht. Die physiologische Bewegung der Schädelsphäre zeigte sich eingeschränkt. Während der Behandlungen wurde zudem ein unterschwelliger superiorer Vertikal-Strain der Symphysis sphenobasilaris entdeckt.
Nach 7-wöchiger Behandlung bemerkte die Schule eine deutliche Veränderung bezüglich seiner Einstellung und Leistung. Er war nun ein fröhlicherer, kommunikativerer Junge. Am Ende der zweiten Klasse, acht Monate später, wurde berichtet, dass er Fortschritte beim Lesen machte und dass sich seine Lerngewohnheiten verbessert hatten. Er war wesentlich fröhlicher als früher.
Zum Zeitpunkt des Berichts war er in der achten Klasse und hatte überdurchschnittliche Noten.
Fall 5: Ein neunjähriger Junge mit außergewöhnlich hohem IQ verfügte über eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und es wurde empfohlen, dass er die dritte Klasse wiederholen solle.
Die frühe Schwangerschaft war von einer Fehlgeburt bedroht. Er kam sechs Wochen zu früh auf die Welt und hatte Schwierigkeiten sofort zu atmen. Im ersten Lebensjahr zeigte er sich phlegmatisch und mit 7 ½ bekam er Asthma. In der Schule konnte er nicht still sitzen, gab sich beim Arbeiten keine Mühe und konnte nur halb so schnell abschreiben, wie man es für ein Kind in seinem Alter erwarten würde.
Sonst entwickelte er sich normal und konnte zufriedenstellend Rollschuh- und Fahrradfahren. Als kleiner Junge war er auf den Hinterkopf gefallen.
Bei der Untersuchung war er nicht in der Lage still zu halten und die Ebenen der Hüfte, Schultern und Ohren veränderten sich ständig. Beim Lauftest war er nicht in der Lage, Arme und Beine zu koordinieren. Im Stand konnte er seine Arme nicht in einem ruhigen und sich gleichmäßig verändernden Rhythmus schwingen.
Das Balancieren auf einem Bein war ungenügend. Die Hüfte senkte sich nicht auf die Seite des gehobenen Beines.
In Rückenlage stand das Sakrum auf der linken Seite superior und auf der rechten Seite posterior. Sein Kopf war dolichozephalisch geformt und vom Extensions-Typ. Die Symphysis sphenobasilaris wies einen superioren Vertikal-Strain und einen rechten Lateral-Strain mit Kompression auf. Das linke Os temporale zeigte sich in Innenrotation fixiert und der harte Gaumen stand beidseitig hoch und in Innenrotation.
Nachdem er nicht in die vierte Klasse versetzt wurde, riet man in den Sommermonaten zu einer Kombination aus Wahrnehmungstraining gleichzeitig mit osteopathischer Behandlung. In der Regel werden diese Maßnahmen nacheinander angeordnet um den spezifischen Beitrag von beiden zu evaluieren. Im zweiten Monat der vierten Klasse, nach sieben osteopathischen Behandlungen und einem sechswöchigen Intervall ohne Behandlung wurde berichtet, dass er still sitzen und lesen kann und dass seine Schrift sich „drastisch verbessert hat und nun alle Buchstaben von gleicher Größe sind.” Bis zur sechsten Klasse hatte er das Standardniveau erreicht. Die Sehschärfe ohne Hilfsmittel verbesserte sich von 20/40 auf 20/30 auf jedem einzelnen Auge sowie auf beiden zusammen.
Anmerkungen
Die Diagnose einer Lernschwäche ist leicht zu stellen, wenn die routinemäßige Anamnese Fragen über intellektuelle Leistungen und Schulleistungen einschließt. Es ist schwierig, jene Faktoren zu bestimmen, die das Lernproblem verursachen oder dazu beitragen. Allgemein zeigen Untersuchungsreihen zur Evaluation der Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen von Johnson19 eine Verbindung zwischen psychologischen und physischen Unzulänglichkeiten. Diese stammen offensichtlich aus derselben ätiologischen Quelle und rufen durch Interaktion mit den intellektuellen Problemen jenen unglücklichen Zustand hervor. Gelegentlich kann ein spezifisches Problem wie etwa eine Beeinträchtigung des Seh- oder Hörvermögens oder es können Episoden kleinerer Übel festgestellt werden, wobei die Korrektur der Probleme zu einer sofortigen und glücklichen Lösung führt. Aber solche Fälle sind die Ausnahme.
Die Absicht meines Projektes, in dem ich der Ermahnung Dr. Stills folgte, war die Ursachensuche für solche Störungen.
Ich fange mit der Befragung eines Elternteils an, vorzugsweise der Mutter alleine. Es ist eine gute Regel, die Befragung über das Kind niemals in dessen Gegenwart vorzunehmen. Die Unterhaltung mit dem Elternteil eröffnet die Gelegenheit, viel über die Situation zu Hause zu erfahren, die in Gegenwart des Ehepartners oftmals nicht in dieser Art und Weise dargestellt werden würde. Ein gründliche Erhebung des Verlaufs der Schwangerschaft und der Geburt, der frühen Entwicklung, des kindlichen Verhaltens, der Interessen und Stärken liefern Indizien der Unzulänglichkeiten in der Entwicklung jener visuellen Komplexe, die den schulischen Erfahrungen vorausgehen. Traumata, Episoden hohen Fiebers oder schwere Erkrankungen sollten erfragt werden. Nachfragen zur intellektuellen Leistungsfähigkeit, die Einstellung gegenüber der Schule und die Beziehungen zu Klassenkameraden, können bewirken, dass ein Elternteil über seine Sorgen und Ängste bezüglich eines Erziehungsproblems, für das er oder sie noch keine Lösung finden konnte, berichtet.
Die Mehrheit dieser Kinder wurden von einem Augenoptiker an mich überwiesen, der aufgrund 20-jähriger Zusammenarbeit den Wert der osteopathischen Betreuung von Kindern mit Lernproblemen zu schätzen gelernt hat.
Die Untersuchung des Kindes erfolgt immer in Gegenwart der Eltern. Zuerst werden Fotos gemacht. Einfache Tests werden in die körperliche Untersuchung integriert und tragen so zur Diagnose bei. Zu diesen Tests gehören rhythmisches Armschwingen und Arm-Bein-Koordinationsübungen sowie Marschieren. In einem anderen Test wird das Kind angewiesen in ein Kaleidoskop zu sehen, wobei es das dominante Auge benutzen wird. Gekreuzte Dominanz ist eine wichtige Beobachtung bezogen auf die Bedeutung für weitere Befunde.
In einem anderen Test soll das Kind den sich hin- und herbewegenden Finger des Osteopathen beobachten ohne dabei seinen Kopf zu bewegen. Der Osteopath achtet darauf, ob das Kind mit den Augen zwinkert oder ob die Augen zucken, sobald sie die Mittellinie überqueren. Die Unfähigkeit, die Augen zu kontrollieren, kann mit der Unfähigkeit, eine Linie nachzufahren einhergehen. Es folgten ähnliche Tests in vertikaler und diagonaler Richtung. Zudem wurde das Kind angewiesen, sich auf das Gesicht des Osteopathen und seine Bemerkungen zu konzentrieren, egal ob das Kind ein Auge dafür benutzt oder zwei. Das Kind wurde dann gefragt, ob die Nase des Osteopathen einen Schatten wirft.
Wenn mehrere dieser Tests Anomalien zeigen und die Sozialanamnese Leistungsstörungen in der Schule ergibt, sollte das Kind für eine gründliche Evaluation der Wahrnehmungsfunktion zu einem Augenoptiker des spezialisierten College of Vision Development überwiesen werden.
Beim ersten Besuch wurde die körperliche Untersuchung abgeschlossen, dazu gehört die strukturelle Evaluation des gesamten muskuloskeletalen Systems, des Kraniosakralen Mechanismus und des Zahnstatus. Diese Befunde wurden aufgezeichnet und es folgte eine diagnostische und prognostische Einschätzung.
Es folgt eine Besprechung mit beiden Eltern ohne das Kind. Die Befunde werden dargelegt. Sind weitere Tests indiziert, werden diese ebenfalls erklärt. Dann muss die Prognose beachtet werden. Als allgemeine Regel gilt, je jünger das Kind ist, desto besser die Prognose. Für einen Heranwachsenden werden die Grenzen einer möglichen Verbesserung aufgezeigt. Es wird auch verdeutlicht, dass eine Verbesserung einiger zugänglicher Faktoren, bezogen auf das Problem das gesamte Körperbild verändern kann und dem Kind erlaubt, das Optimum aus seinen Fähigkeiten zu machen. Für die meisten Eltern ist irgendeine Verbesserung besser als gar keine.
Es konnte aus langjähriger Erfahrung gelernt werden, dass signifikante Veränderungen im anatomischen physiologischen Mechanismus wöchentliche Besuche im Zeitraum über etwa sechs bis acht Wochen benötigen, um für die Eltern und das Kind nachweisbare Ergebnisse zu zeigen. Dies sollte den Eltern erklärt werden, bevor die Therapie beginnt. Es erfolgt keine Evaluation des Fortschritts während dieser Phase. Bemerken die Eltern oder das Kind vorzeitige Veränderungen, ist dies ein zusätzlicher Gewinn. Tun sie es nicht, trägt das Zeitintervall zum Schutz des Osteopathen bei. Beim letzten planmäßigen Besuch werden der Fortschritt und die Pläne für die Zukunft mit den Eltern diskutiert und es werden erneut Fotos gemacht.
Ist ein visuelles Training erforderlich, findet dieses gewöhnlich nach Abschluss der intensiven osteopathischen Betreuung statt. Der Wert eines Wahrnehmungstrainings wird äußerst kontrovers diskutiert.20 Möglicherweise kann dasselbe von der osteopathischen Betreuung behauptet werden. Man sollte jedoch das Verhältnis von Osteopath und Augenoptiker bei der Behandlung eines Kindes mit Lernschwäche mit der Beziehung zwischen einem Klavierstimmer und dem Musiklehrer bezogen auf einen jungen Musiker vergleichen.
Ganz gleich wie begabt der Musiklehrer oder das Kind sein mag, das Kind wird niemals harmonische melodische Töne produzieren können, wenn das Klavier nicht gestimmt ist. Nachdem der Stimmer herein geholt wird, um das Instrument zu stimmen, muss der Lehrer eingeladen werden, um das Kind zu trainieren und dabei auf der vorherigen Stimmung aufbauen. Die Kunstfertigkeit des Osteopathen liegt im Stimmen des Instruments. Ist dies vollendet, sollte dem Augenoptiker erlaubt werden, schlechte Angewohnheiten zu korrigieren und dem Kind eine bessere Art beizubringen, wie es seine Fähigkeiten effizient nutzen kann.
Zusammenfassung
Diese Studie, mit all ihren Einschränkungen und Unzulänglichkeiten, veranschaulicht das Bedürfnis nach einem zehnjährigen Forschungsprojekt, um zu bestimmen, ob sich die Diagnose und die Behandlung der aus perinatalen Belastungen resultierenden kraniosakralen Strains das Auftreten von Lernschwierigkeiten günstig auswirken. Gleiches gilt für die periodische Reevaluation des Kindes während seiner Entwicklungsjahre, um jedes aus einem Trauma resultierende Strain-Muster aufzulösen und somit das Auftreten von Lernschwierigkeiten zu reduzieren. Es wurden neue Fragen bezüglich der Beziehungen geometrischer Muster des Körpers und seiner physiologischen Funktionen aufgeworfen.
Es wurde gezeigt, dass bei Kindern mit und auch ohne Lernprobleme das gesamte Ausmaß an traumatischen Mustern gefunden werden kann.
Es wurde gezeigt, dass es eine kritische empfängliche Phase gibt, in welcher Strain-Muster besonders zur Lernschwäche beitragen und dass diese kritische Phase, die etwa bis zum Alter von zwei Jahren besteht, auch eine Phase der Chancen für den optimalen Gewinn durch eine Korrektur solcher Strains darstellt.
Es wurde zudem gezeigt, dass viele Kinder von einer osteopathischen Diagnose und Behandlung des Körpers im ganzheitlichen Sinn, inklusive des Kraniosakralen Mechanismus, auch lange nach dem kritischen Alter von zwei Jahren, profitieren. Dennoch sind die Ergebnisse für Kinder im Grundschulalter, besonders der unteren Klassen, besser, als für Schüler höherer Klassen. Zu dieser Zeit verläuft die Rehabilitation durch die Enttäuschungen in der Schule, dem wiederholtem Versagen bei intellektuellen Leistungen und all dem psychischen Stress, der mit der Wahrnehmungs-Dysfunktion und der Fehlkoordination des Selbst einhergeht, verlangsamt und unvollständig.
Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung eines Behandlungsprogramms ihre Zeit und Mühen wert, insofern dem Patienten dadurch ermöglicht wird, das Maximum seiner Fähigkeiten auszuschöpfen, sich zu akzeptieren und alle daraus resultierenden Vorteile zu erkennen, welche zum Auflösen seiner Einschränkungen führen können.