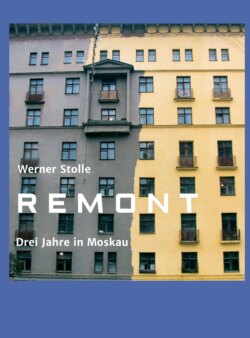Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVerbotene Stadt
2. Juni – 4. Juni 1990
Bis zu unserer Abfahrt am nächsten Vormittag bleibt unser Telefon stumm. Über den freundlichen Umgangston können wir uns kein negatives Urteil erlauben. Über den Service schon.
Jaroslawl liegt knapp dreihundert Kilometer nordöstlich von Moskau, am Zusammenfluss von Wolga und Kotorosl. Ein Bärenbezwinger hatte vor tausend Jahren den Grundstein für diese Stadt gelegt. Als ich das lese, kommt mir der Schnarchbär aus dem Zugabteil auf der Rückfahrt von Tallinn nach Moskau in den Sinn.
Wir befinden uns noch innerhalb des Autobahnrings, als wir unerwartet einen Zwischenstopp am Prospekt Mira einlegen müssen. Ein GAI belehrt uns, wir hätten eine rote Ampel übersehen. Das stimmt nicht ganz. Aus reiner Rücksichtnahme auf die mir folgenden Verkehrsteilnehmer habe ich auf eine Vollbremsung verzichtet und ihnen sogar noch ermöglicht, meinem Beispiel zu folgen. Das behalte ich jedoch für mich. Sehr kleinlich, ausgerechnet mich an den Straßenrand zu pfeifen. Ich versuche ihm zu erklären, dass ich nur Gutes im Sinn hatte und mich deshalb dem fließenden Verkehr angepasst habe. Das kann man doch nicht bestrafen! Dazu fällt ihm nichts mehr ein. Wir dürfen weiterfahren. Ständig überholen uns Fahrzeuge, die Tomatenstauden an Bord haben, sei es auf dem Schoß, auf dem Dachgepäckträger oder auf dem Hänger.
Kaum haben wir Moskau hinter uns gelassen, geraten wir im Ort Mitischi in einen Stau. Nach einer Dreiviertelstunde nähern wir uns der Stauursache. Ein Trauerzug kommt uns gemessenen Schrittes auf der Straße entgegen, angeführt von einem Mann, von dessen Gesicht nur die untere Hälfte zu sehen ist, da er den Sargdeckel auf seinem Kopf balanciert. Es folgen die kleine Trauergemeinde, viele von ihnen tragen Plastikblumen für das Grab, in der Mitte des Zuges, von vier Trägern geschultert, die Tote im offenen Sarg, am Ende ein Blasquintett, das herzerweichend traurig spielt. Ein archaisch anmutender Kontrast zu der stinkenden Autoschlange mit den überwiegend ungeduldigen Autofahrern, die mit ihren Familien auf dem Weg in ihre Datschen sind, um ihre Tomatenstauden einzupflanzen. Aber alle Fahrer verhalten sich absolut respektvoll; niemand hupt oder spielt mit dem Gaspedal.
Schon bald nimmt die Verkehrsdichte rapide ab. Hin und wieder kommt uns ein Auto oder ein Motorrad entgegen. Und in diesem Moment ein Fahrradfahrer. Diese Sensation müssen wir im Kalender festhalten. Es ist das erste Fahrrad, das wir in der Sowjetunion zu Gesicht bekommen. Radwege sind in diesem Riesenland unbekannt. Rad fahren in Moskau käme einer Kamikaze-Aktion gleich, schon allein wegen des unkalkulierbaren Straßenzustands; von den Autofahrern, denen die Straße gehört, nicht zu reden. Bei schlechtem Wetter bräuchten Radfahrer obendrein einen Ganzkörperanzug zum Schutz vor Wasser- und Schlammfontänen.
Wir fahren durch kleine Holzhaussiedlungen mit Teichen, in denen man sich der Körperpflege hingibt oder Wäsche gewaschen wird. Über Pereslawl-Saleski und Rostow-Weliki erreichen wir am Nachmittag unser Ziel. Unser Hotel, das den einfallsreichen Namen Jaroslawl trägt, liegt in der ruhigen, grünen Altstadt, nur wenige Schritte von der Wolga entfernt. Auf dem Svoboda-Platz vor dem Hotel läuft eine fernöstlich anmutende Kunstaktion ab - vor höchstens zwanzig Zuschauern.
Das Hotel hat schon glanzvollere Zeiten erlebt: großzügige breite Flure, hohe Räume, alle Decken mit Stuck verziert, Kristalllüster, große Fensterfronten – alles in einem stark angegriffenen Zustand. Uns fallen im Foyer einige Angetrunkene auf, die das Personal aber fest im Blick hat. Im Hotelrestaurant Medwed gaukelt uns die Speisekarte eine ansehnliche Auswahl vor. Wir entscheiden uns für das Tagesgericht, das einzige, was die Küche heute zu bieten hat: Fischsalat, heiße Rote Beete mit Smetana, Bœuf Stroganoff, Hähnchen; zu trinken gibt es Brause für die Kinder und Wodka für die Erwachsenen. Unter der Abschlussleiste der halbhohen Holzvertäfelung haben es sich unzählige Kakerlaken gemütlich gemacht. Das verstärkt die insgesamt heruntergekommene Atmosphäre noch. Dass wir einen Tag später eingetrudelt sind, interessiert die Damen an der Rezeption nicht.
Wir machen einen ausgedehnten Spaziergang durch die fast menschenleere Stadt bis an die Wolga und kehren nach Sonnenuntergang zurück in unser Domizil. Als wir unser Zimmer aufschließen, wird dort gerade der Rasen gemäht - denken wir. Es ist aber nur der klobige Kühlschrank, der vor sich hin dröhnt. Leider funktioniert die Toilettenspülung nicht. Wir trinken auf die Schnelle eine Saftflasche leer, die wir im Sadko gekauft haben, einem kürzlich in Moskau eröffneten russisch-schweizerischen Joint-Venture-Laden. Ich halte die Flasche unter den Hahn des Waschbeckens und fülle sie mit Leitungswasser, damit wir eine Ersatzspülung zur Hand haben, denn das eingebaute System ist wie tot. Die zuvorkommende Etagen-Deschurnaja teilt uns auf Anfrage eine kleine Ration dunkelbraunen, groben Klopapiers zu, so dass wir fürs Erste ganz gut versorgt sind. Warmes Wasser: Fehlanzeige. Schranktüren, Schubladen und Fenster sind so verzogen, so dass sie nur mit Spezialwerkzeug zu bewegen wären. Wir wussten schon vor der Reise, dass wir nicht in einem Ferienparadies landen und uns hier im Luxus aalen würden.
Wir nehmen alles gelassen hin. Ein Sonnenuntergang an der Wolga entschädigt für alles.
Bevor das gefühlte Haltbarkeitsdatum überschritten ist - in Wahrheit gibt es solche Aufdrucke gar nicht - muss ganz Jaroslawl täglich Erdbeerbrause trinken. Erst wenn die alle ist, dann gibt der Staat eine neue Sorte frei. Selbst Mineralwasser wird scheinbar so lange zurückgehalten. An jeder Ecke ist dieses klebrige Getränk im Angebot. Gestern Abend mussten die Kinder diese Brause trinken, während wir, im Gegensatz zu ihnen, eine brauchbare Alternative hatten. Heute Morgen gibt es neben Erdbeerbrause auch Tee am Frühstücksbüfett. Die Nahrungsauswahl am Büfett ist recht übersichtlich. Neben den beiden Getränken hat man bei der festen Nahrung die Wahl zwischen Brötchen und Kuchen. Wir greifen beherzt zu und laden alles zusammen auf ein Tablett, das sich leicht klebrig anfühlt. Warum, kann man sich leicht denken. Die Auswahl an freien Plätzen übertrifft das Angebot an Speisen erheblich. Wir sind die einzigen hungrigen Gäste. Alle anderen sind höchstwahrscheinlich Frühaufsteher, die schon längst die Stadt erkunden und einen weiteren Erfrischungsdrink hinter sich haben. Ein anderer Grund fällt mir nicht ein. Auf den Tischen liegen milchige Wachstücher, damit einem die unansehnlichen, schrill gemusterten Tischdecken, die wie umgearbeitete Kittelschürzen aussehen, nicht so ins Auge springen. Gut, dass es den Tee gibt, um die staubtrockenen, unbelegten Brötchen, die garantiert nicht von heute sind, aber noch ganz passabel schmecken, herunterspülen zu können. Tapfer machen wir uns über den Kuchen her. Doch das, was wie Kuchen aussieht, ist geschmacklich eher enttäuschend. Wir wollen gar nicht wissen, was das wirklich ist, sondern würgen den ersten Bissen hinunter und spülen mit Tee nach. Die Kinder spüren, dass wir das Essen nicht einstellen, weil wir gesättigt sind. Sie rühren den Kuchen nicht an. Als ich das Tablett an die Theke zurückbringen will, hebt die Wachsdecke ein wenig ab. Sergej, unser Improvisationsgenie, hat mit Sicherheit das Klebepotenzial von Erdbeerbrause erkannt, vielleicht sogar schon in seiner alltäglichen Praxis als Ersatzkleber ausprobiert.
Gestern Abend kam uns an der Wolga die Idee, mit der Rakjeta, einem kleinen Schnellboot auf Tragflächen, einen Ausflug nach Kostroma zu machen, um mehr von der schönen sanften Landschaft aufzunehmen. Jetzt stehen wir am Flussbahnhof, einem auf Pontons gelagerten kleinen Holzhaus, und kaufen ohne Probleme vier Rückfahrtbillets. Das Boot ist fast leer, obwohl heute Sonntag ist, ein Tag, an dem die Russen gern Familienausflüge unternehmen. Eine kräftige, untersetzte Frau in einer überdimensionalen Rettungsweste macht die Leinen los und zieht die Brücke hoch. Zuerst tuckert das Boot zur Flussmitte. Der Bootskörper hebt sich hydraulisch, bis die Kufen auf der Wasseroberfläche aufliegen. Bis eben haben wir noch die himmlische Ruhe genossen. Nun hebt ein Getöse an, das nur noch vom Start einer Weltraumrakete übertroffen werden kann, und schon rast das Geschoss mit über dreißig Knoten die Wolga abwärts. In neunzig Minuten soll die Strecke von einhundert Kilometern geschafft sein. Eine Unterhaltung ist nicht mehr möglich. An Deck hat man mit dem Fahrtwind zu kämpfen. Die Landschaft zieht wie ein Film an uns vorbei, weitgehend unberührte Natur, bisweilen kleine Holzhaussiedlungen mit Kirche. Kühe stehen am Ufersaum und stieren zu uns herüber. Sonntagsausflügler, die ihren halben Hausstand mitgeschleppt haben, angeln, grillen oder baden mit ihren Kindern im Fluss. Die Sowjetunion sei ein Land der extremen Gegensätze, schreibt fast jeder Journalist. Das können wir auch als Nicht-Journalisten spätesten jetzt bestätigen. Zweimal legen wir noch an. Höchstens ein oder zwei Fahrgäste steigen aus oder zu. Jeweils fünf Minuten Zeit bleiben uns bei diesen Zwischenstopps, um wieder miteinander zu kommunizieren. Unter Deck sitzt niemand. Der winzige Servicebereich ist geschlossen. Die wenigen Einheimischen greifen auf ihr Picknick zurück, das viel leckerer als unser Frühstück aussieht. Dazu gehört allerdings auch nicht viel.
Autos scheint es in Kostroma kaum zu geben. Diese Stille tut gut. Wir haben eine gute Stunde Zeit für einen Stadtrundgang. Außer den gut erhaltenen Handelsreihen mit ihren Arkaden, einem Gebäudekomplex aus dem 18. Jahrhundert, in dem heute kleine staatliche Geschäfte untergebracht sind, sehen wir weitgehend dem Verfall preisgegebene alte Bürgerhäuser und Stadtvillen, die oft nur teilweise bewohnt sind. Die Schaufenster der Läden sind oft leer oder nur spärlich dekoriert. In einer verlassenen Straße sitzt eine kräftige Frau in weißer Jacke und mit weißem Kopftuch auf einem Hocker. Neben ihr steht auf einem Plastiktisch eine alte Rechenmaschine, vor ihr ein Tank mit Kwaß, daneben ein blauer Kiosk zur kostenlosen Selbstbedienung mit Mineralwasser. Kunden sind nicht in Sicht. Aus den schon benutzten Gläsern möchte man weder Wasser noch Kwaß trinken, einen Trunk aus gegorenem Brot, der im Westen Russlands als Erfrischungsgetränk sehr beliebt ist. Heidi und mir schmeckt Kwaß auch. Aber wir müssen weiter, damit wir unsere Rakjeta rechtzeitig erreichen.
Als wir wieder vor unserem Hotel in Jaroslawl aussteigen, rät mir ein Angestellter dringend, das Auto über Nacht in der sicheren Hofgarage zu parken. Er steigt ein und führt mich über einen tiefen Schlaglochparcours in einen finsteren Hof. Seine Augen strahlen, weil er erstmals in einem Passat sitzen durfte. Er besteht darauf, den Wagen gründlich zu waschen.
Wir haben noch Zeit, um uns die Klosteranlage und die Verklärungs-Kathedrale anzuschauen. Im angegliederten historischen Museum gibt es eine interessant aufbereitete Sonderausstellung mit Dokumenten aus der Zeit der Revolution bis zu hin zum Großen Vaterländischen Krieg.
Zum Abendessen im Hotelrestaurant Jubilejnaja gibt es Wodka und Erdbeerbrause. Eine kleine lokale Band unterhält uns beim Essen mit russischer Popmusik. Auch wenn hier kein Sternekoch am Werk war: Das Essen schmeckt besser als in unserem Hotel. Zum Nachtisch gibt es als Krönung Eistorte.
Unser frisch gewaschener roter Passat erregt viel Aufsehen in der Stadt. Wir haben sicherheitshalber direkt nach dem Frühstück eine Dame vom Personal gebeten, uns das Eisentor zum Hinterhof aufzuschließen. Sie verschwindet mit einem gnädigen Kopfnicken und begibt sich auf die Suche nach dem Schlüssel. Kurz darauf kommt sie zurück und telefoniert. „Minutschko“, sagt sie dann, zu mir gewandt, das heißt, ich solle mich ein Minütchen gedulden. Wenn man die Verniedlichungsform von Minute hört, denkt man, es könne sich nur um Sekunden handeln, allerhöchstens jedoch eine ganze Minute. Dieses eine Wort umfasst hierzulande den abstrakten Zeitraum von sofort bis irgendwann, aus dem man leider keinen Mittelwert ableiten kann, um sich auszurechnen, wann in etwa das ungefähr sein könnte. Ich sehe uns schon die nächsten Tage ans Hotel gefesselt und dem monotonen Frühstücksbüfett ausgesetzt. Doch da erscheint nach angemessener Zeit der Schlüsselmann, der gestern unseren Wagen gewaschen hat. Auf dem Weg zum Eisentor äußert er sich noch einmal lobend über das Fahrzeug und deutsche Qualitätsarbeit im Allgemeinen. Für seinen Wascheinsatz gebe ich ihm ein Trinkgeld, für das Lob zusätzlich eine Schachtel Marlboro. Wieder strahlen seine Augen. Ich fahre unseren Wagen vom Hof und parke vor dem Hoteleingang. Als wir unsere Sachen einladen wollen, stehen Männer bewundernd neben dem Wagen und führen Fachgespräche. Leider müssen wir nun aufbrechen.
Rostow-Weliki gehört, ebenso wie Pereslawl-Saleski, Jaroslawl und Kostroma, zu den Städten am Goldenen Ring. Der Goldene Ring umfasst eine Anzahl altrussischer Städte mit zahlreichen goldenen Kirchenkuppeln, die an alten Handelsrouten nordöstlich von Moskau gegründet wurden und in denen die russische Kultur tief verwurzelt ist. Besonders beliebt bei Touristen sind die Städte Sagorsk, Susdal und Wladimir.
Rostow-Weliki ist eine Kleinstadt mit fast dörflichem Charakter. Sie liegt am idyllischen Nero-See. Bei Nieselregen wirkt die Stadt absolut trostlos. Der komplette Kreml mit seinen Kathedralen ist in Remont. Das dauert noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis dieser Ort sich in einen Anziehungspunkt für Touristen verwandelt haben wird. Das Zentrum ist wenig belebt. Vor den Geschäften haben sich Schlangen gebildet, um etwas von dem unansehnlichen Warenangebot zu ergattern. Vor einem verfallenen Haus verkauft eine Frau Mineralwasser, vor einem anderen, nur teilweise bewohnten Gebäude steht ein Kwaß-Tank. Weder für das eine noch das andere interessieren sich die wenigen Passanten. Seit der Errichtung der Altstadt scheint hier so gut wie gar nichts mehr instandgesetzt worden zu sein. Die wenigen Holzhäuser sind windschief und schmuddelig. Kabelgewirre veralteter Elektroleitungen wuchern aus Schächten neben schief stehenden Straßenlaternen und aus Verteilern an beschädigten Hausfronten. Wenig vertrauenerweckend sind auch die Bürgersteige, die mit Vorsicht zu betreten sind, sonst läuft man Gefahr, in einen Krater hineinzustolpern.
Eine Gruppe von Kindern umringt uns und bettelt um Kaugummi. Damit können wir nicht dienen. Kurz darauf fallen sie über die von uns verteilten Bananen her.
Uns zieht es nach Hause. Der Passat hat sich durch den Regen längst wieder an die schlammige Umgebung angepasst. Wir verlassen die Stadt der Armut. An der ersten Ampel will ein Mann während der Rotphase Geld tauschen. Das erledigen wir lieber anderswo.
Inzwischen gießt es in Strömen, so dass wir die noch kleinere Stadt Pereslawl-Saleski ohne Zwischenhalt hinter uns lassen.
Als wir von unseren Erlebnissen berichten, erfahren wir etwas, was wir gar nicht gerne hören wollen: Die Stadt Kostroma ist Sperrgebiet für Ausländer. Nun können wir nur noch hoffen und bangen, dass in den nächsten Stunden und Tagen nicht eine abgedunkelte Staatslimousine vor unserem Haus parkt, aus der zwei breitschultrige Gestalten aussteigen, um uns in Gewahrsam zu nehmen. Ausgeschlossen ist das nicht. Notfalls wird uns die Botschaft helfen.