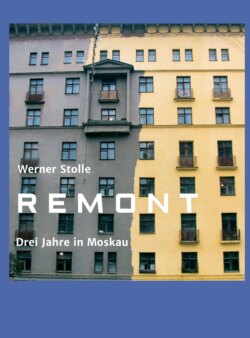Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 52
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBaden verboten
10. Juni – 28. Juni 1990
Soldaten, die in anderen Ländern stationiert waren und nun heimkehren, leiden unter der Wohnungsnot, besonders in Moskau. Zudem finden sie schwer eine Arbeit. Diejenigen, die nicht vorübergehend bei Verwandten oder Freunden unterkommen, müssen in einer der zahlreichen, schnell errichteten Zeltstädte, die vor den Toren der Städte errichtet wurden, ihr Dasein fristen. Wohnungsnot und Mangelversorgung gefährden zunehmend den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft.
Wolfgang und Christiane besuchen uns zum Abschied ein letztes Mal. Sie bringen Kaviar und Schampanskoje aus ihrer letzten offiziellen Bestellung über das GUM mit, eine Quelle, die nur für Angehörige der sozialistischen Bruderstaaten sprudelt. Sie sind aufgeregt, weil sie nicht wissen, was in Berlin auf sie zu kommt, freuen sich aber sehr darauf, endlich Westberlin kennen zu lernen.
Bis spät in die Nacht berichten sie uns detailliert, auf welch perfide Weise Menschen aus ihrem Umfeld vom DDR-Regime bespitzelt, denunziert und aus dem Verkehr gezogen wurden. So offene, kritische Worte hören wir zum ersten Mal. Aber auch ein wenig Selbstkritik zeigen sie, indem sie uns den schmalen Grat zwischen Opposition und Opportunismus vor Augen führen. Die Unerbittlichkeit, mit der das System auch die Angehörigen kritischer Geister unter Druck setzte, erbost die beiden ganz besonders. Uns auch.
Anne und Edda aus dem Nebenhaus werden nun doch nicht mit Annika auf dieselbe Schule gehen. Ihre Eltern verlassen Moskau leider auch.
Viel Resonanz findet ein Sponsorenlauf am Fuße der Leninberge, den Frau Hartmann für unsere Schule organisiert. Die Spenden sollen den Kindern von Tschernobyl zugutekommen. Die Schülerinnen und Schüler können die Strecke wahlweise zu Fuß, auf Rollschuhen oder Skateboarden zurücklegen. Am Ende kommt die erkleckliche Summe von 3800 D-Mark, 1955 Rubeln und 60 Dollar zusammen.
Auf dem Weg zur Anne-Frank-Ausstellung in der Neuen Tretjakow-Galerie am Gorki-Park zieht auf der Gegenfahrbahn in gemächlichem Tempo eine Trauergemeinde über den Leninskij, vorn und hinten durch Polizeiwagen abgesichert. Die Trauergäste folgen in Bussen und eigenen Autos einem der typischen blau-grünen Kipplaster, auf dessen Ladefläche der mit Blumengebinden übersäte Sarg des verstorbenen Menschen platziert ist.
Ziel der Ausstellung, lesen wir, sei es, vor Antisemitismus und Nationalismus zu warnen, aber auch die Expansion Nazideutschlands während des Zweiten Weltkriegs noch einmal zu veranschaulichen. Zahlreiche Fotos und Schriftdokumente zeugen vom Aufstieg und Niedergang der Hitler-Diktatur, verknüpft mit dem tragischen Werdegang der Familie Frank. Hier in Moskau schämen wir uns ganz besonders für unsere düstere Vergangenheit. Soll die Ausstellung zu diesem Zeitpunkt auch als Appell an das heutige Deutschland zu verstehen sein?
Die Miete einer einfachen Datscha im Umkreis von Moskau liegt, je nach Lage, zwischen 200 und 800 Rubeln. Datschen haben in der Regel nur ein Zimmer und keinen Wasseranschluss. Will man eine Eigentumswohnung erwerben, muss man durchschnittlich 250 Rbl/m2 (ohne Erbrecht) bis 550 Rbl/m2 (mit Erbrecht) hinblättern.
Wer lange Wartezeiten beim Autokauf scheut, kann auf dem Schwarzmarkt aus einem üppigen Angebot wählen. Wolgas kosten dort (wo immer das ist) 50 000 bis 80 000 Rubel, Ladas zwischen 20 000 und 40 000 Rubel. Wer sich lieber einen Mercedes gönnen möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Preise liegen zwischen 280 000 und 500 000 Rubeln. Eine Vertragswerkstatt hat Daimler nicht in der Sowjetunion, geschweige denn ein Autohaus. Von Ausländern eingeführte Autos müssen nach Ende der Arbeitsverträge wieder ausgeführt werden. Da stellt sich schnell die Frage, welche Vorgeschichte die ausländischen Fabrikate haben.
Die festgelegten Preise in den staatlichen Läden und die Zuteilungsmengen von rationierten Waren sind verbindlich. Es sei denn, man überzeugt das Verkaufspersonal mit einer kleinen Zugabe - das kann auch ein Geschenk oder eine Dienstleistung sein - von diesen strengen Regeln flexibel abzuweichen. Wie das Ganze am Ende eines Tages eine solide Kassenprüfung überstehen soll, bleibt mir zumindest ein Rätsel.
Offiziell herrscht an nahezu allen Stränden in der Sowjetunion Badeverbot, auch an den Ostseestränden des Baltikums und der Enklave Kaliningrad. Ganz besonders am Schwarzen Meer, nachdem kürzlich aufflog, dass vor der rumänischen Küste heimlich Giftfässer versenkt worden waren. Wer im Urlaub per Auto auf die Krim reisen möchte, muss pro Tag zehn Rubel löhnen. Nur wer seinen Pass vorzeigt, darf sich am Strand niederlassen. Ob das strikte Badeverbot überwacht wird, und wenn ja, mit welchen Strafen zu rechnen ist, darüber erfährt man in den Medien nichts. In einem Land, wo sich an jeder Wasserstelle die Badekultur hemmungslos Bahn bricht und wo die Menschen mit Spitzhacken Löcher ins Eis schlagen, um sich zu erfrischen, haben diese Verbote allenfalls eine Alibifunktion. Der schönste Strand soll - und das ist kein Witz - in Wladiwostok sein. Dort darf man noch baden, sogar ohne Passkontrolle.
Seit Jahren schließt die Deutsche Schule traditionell das Schuljahr mit einem Tagesauflug zur Buchta Radosti ab, auf Deutsch Freudenbucht, ein hügeliges, üppig bewachsenes Gebiet am Kljasma-Stausee, etwa 45 Kilometer nordöstlich von Moskau, in der Nähe der Stadt Sorokino. Ein idealer Ort, um sich zu erholen! Auf dem Hinweg fährt die eine Hälfte mit Schulbussen dorthin, die andere mit der Metro zum Wasserbahnhof und steigt auf eine Rakjeta um, weil heute angeblich nur eine einzige Rakjeta in die Bucht fährt, obwohl der Fahrplan etwas anderes sagt. Auf der Rücktour wechseln dann die Teams. Nach einer Stunde Fahrt über den Moskwa-Wolga-Kanal sind wir am Ziel. Unser Strand liegt an einem Nebenarm der Moskwa, der in einer Sackgasse an einem Steilufer, dicht bewaldet, mit vielen kleinen, verlockenden Badenischen, endet. Auch hier soll die Wasserqualität nicht die beste sein, nachdem man in der Nähe illegal entsorgte Säcke mit medizinischen Abfällen gefunden hat. Das Badeverbot durchzusetzen, ist bei dieser siedenden Sommerhitze nicht ganz einfach. Fußbäder tolerieren wir großzügig.
Neben uns haben sich an einer fest installierten Holzsitzgruppe vier kräftige Damen in unterschiedlich aufregenden Kittelschürzen niedergelassen, um ihr Picknick zu vertilgen. Um bequemer zu sitzen, haben sie als Polster ihre nassen Handtücher untergelegt. Sie tragen Schuhe und Strümpfe oder Socken. Als Sonnenschutz dienen ihnen unterschiedliche Kopfbedeckungen: ein dunkles Kopftuch mit Blumenmuster, ein weiß-rosa gemusterter Hut in Topfform, eine weiße Sportkappe und eine hellblaue, in Form gebrachte und im Nacken verknotete Plastiktüte. Sie breiten auf dem Tisch ihre mitgebrachten Lebensmittel aus, füllen aus einer Thermoskanne ihre Plastikbecher und lassen es sich gut gehen.
Was den Spaß am heutigen Tage ein wenig trübt: Wir beklagen einige Leichtverletzte, die in Glasscherben und geöffnete Fischdosen getreten sind, die weniger geübte Strandbesucher lieber mit einer dünnen Sandschicht bedeckten, anstatt sie in einen der riesigen Holzmülleimer zu schmeißen, die man wirklich nicht übersehen kann. Nun wissen wir, warum man hier mit Schuhen durch das Gelände geht. Nach der Erstversorgung fährt ein Schulbusfahrer die Kinder sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus.
Statt mit der Rakjeta geht es, wie abgesprochen, nun erst mit dem Bus zurück zum Wasserbahnhof und von dort mit der Metro nach Hause. Metro zu fahren, ist unkompliziert, effektiv und immer ein Erlebnis der besonderen Art. Mit einem Fünf-Kopeken-Chip entsperrt man das Drehkreuz und steuert auf die längsten Rolltreppen der Welt zu. An der Station Barrikadnaja, nahe des Zoos, wo wir umsteigen, sind die Rolltreppen so steil angelegt, dass man denkt, der Gegenverkehr kommt direkt senkrecht von oben. Obwohl sie ziemlich schnell vor sich hin rattern, dauert eine Treppenfahrt bisweilen über zwei Minuten, wenn man sich nicht von seiner Treppenstufe wegrührt. Wer sich so verhält, muss rechts stehen, damit die Überholspur frei bleibt für die eiligen oder sportlichen Fahrgäste. Wer diese eiserne Regel nicht befolgt, handelt sich neben brutalen Rempeleien obendrein den Ärger mit einer Deschurnaja ein. Oft gibt es zwei Ebenen, auf denen die Züge ein- und auslaufen. Entsprechend lange dauern die Rolltreppentouren, wenn man ganz tief in den Untergrund abtauchen muss.
Die Züge fahren alle 90 Sekunden, so dass man nicht in Stress gerät, wenn einem mal ein Zug vor der Nase wegfährt. Da der Fahrplan absolut akribisch eingehalten wird, kommt es nur dann zu einer gewissen Unruhe, wenn das Kommando ertönt, dass die Türen sich automatisch schließen und man sich gerade in diesem Augenblick zwischen den Schiebetüren befindet. Die schlagen nämlich blitzschnell und gnadenlos zu. Wer sich da noch in den Wagen zwängen will, muss im ungünstigsten Fall den Verlust eines Körperteils in Kauf nehmen. Hat man einen Sitzplatz ergattert, dann ist man auf der sicheren Seite. Stehende Fahrgäste sollten sich mit beiden Händen absichern, da die Züge mit hoher Geschwindigkeit über die weitgehend veralteten Gleise brettern. Ausgenommen von diesem Geheimtipp sind die Einheimischen, die die Metro niemals ohne Lektüre betreten würden. Sie lesen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Sozusagen bis zum Umfallen. Von den 6,5 Millionen Metronutzern pro Tag lesen mindestens 90 Prozent. Die restlichen 10 Prozent haben in der morgendlichen Hektik wahrscheinlich ihre Bücher oder Zeitungen zu Hause vergessen oder sind Ausländer. Analphabeten gibt es in der Sowjetunion nicht.
Wer keine Lektüre dabei hat, kann an fast jeder Station immer wieder etwas Neues, Aufregendes in den hell erleuchteten, aufwändig gestalteten Marmorpalästen des Untergrunds entdecken.
Ein Handtaschenschlitzer hat Heidi aus ihrer Umhängetasche das Portmonee geklaut. Eurocard, Scheckkarte, 100 Rubel und ihre Kartotschka, eine Art Wohnberechtigung, sind weg; eine saubere Arbeit, von der sie überhaupt nichts mitbekommen hat. Der Dieb muss einen günstigen Augenblick im Stoffladen am Leninskij genutzt haben, um seine Rasierklinge einzusetzen. Denn dort herrschte am Nachmittag großes Gedränge. Wir versuchen, mit unserem maroden Telefon die Botschaft zu erreichen, doch das Gerät hat heute einen ganz schlechten Tag. Also fahren wir hin. Eine Mitarbeiterin schafft es nach einer Stunde, über ein Durchwahltelefon zur Zentrale der Deutschen Bank durchzudringen, um die Karten sperren zu lassen.
Am nächsten Nachmittag folgt dann der lästige Papierkram. Heidi stellt einen neuen Kartotschka-Antrag. Die Botschaft schickt zur Sicherheit noch ein Telex an die Bank und nimmt die Diebstahlsanzeige auf, um sie nach der Übersetzung an die russischen Behörden weiterzuleiten. Das alles läuft unkompliziert und zügig ab.
Nun können wir uns unbeschwert auf den Abend freuen. Herr Knötzsch hat zu seinem Abschied das Kollegium nach Ilinskoje ins Restaurant Russkaja Isba eingeladen, ein zweistöckiges rustikales Holzhaus in den Farben Dunkelrot, Dunkelgrün und Hellbraun, dessen schmale Erker mit filigranen Holzschnitzereien verziert sind. Wir nehmen an einer langen Tafel Platz, die an der Stirnseite an einen repräsentativen, blauweiß gekachelten Ofen heranreicht. Das Dekorfliesenmuster setzt sich an beiden Seiten des Ofens halbhoch an den Wänden fort. Dieses Prachtexemplar besitzt selbstverständlich auch eine landestypische Ofenbank für die besonders kalten Wintertage. Eine Vier-Mann-Band sorgt für angenehme Unterhaltung während des ausgezeichneten Essens.
Die angebrochenen Wodkaflaschen nehmen wir mit ans Ufer der Moskwa. Gegen die Mückenschwärme hilft das sonst so hochgelobte Heilwasser nicht.
In der Nacht notiere ich mir Stichpunkte für die beiden Reden, die ich morgen halten soll: eine zur Verabschiedung unseres Schulleiters und eine zur Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler, deren Eltern Moskau verlassen.