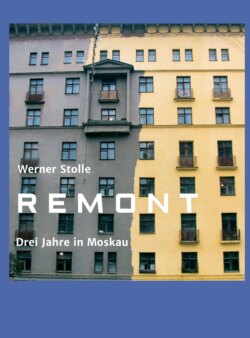Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 51
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEin wohlüberlegter Brief
5. Juni – 9. Juni 1990
Nirgendwo vergeht die Zeit schneller als in Russland, lese ich gerade in Turgenjews „Väter und Söhne“. Ist schon wieder ein halbes Jahr verstrichen? Denn heute gibt es kein warmes Wasser. Sollte eine spontane Zwischenperiode eingeschoben worden sein, sind wir ziemlich aufgeschmissen. Heute wird unser Herd aus der Küche entfernt und in mein Arbeitszimmer geschoben. Die Frage nach dem Warum darf man in diesem Land grundsätzlich nie stellen, weil die Antwort - wie vorprogrammiert - immer lauten würde: Es ist so! Kochen im Arbeitszimmer ist ohne Anschluss ebenso unmöglich wie Wasser zu erhitzen, falls man mal warmes Wasser für irgendetwas brauchen sollte. Aber wir haben ja noch den Einflammer, den die UPDK-Handwerker uns vorausschauend als Leihgabe mitgebracht haben. Leider ist auf dem Weg zu uns die Schnur mit einem speziellen Flachstecker verloren gegangen. Als Hellmuth und Roswitha das Gerät hatten, weil kein Herd in ihrer Wohnung stand, war das Set noch komplett. Wir können uns nur schwer vorstellen, dass Hellmuth als Hobbykoch ein weiteres - heimliches - Hobby hat, nämlich das Sammeln von antiken Flachsteckern. Obendrein muss das Wasser phasenweise auch noch ganz abgestellt werden. In welchen Phasen Wasser läuft, muss man ausprobieren. Informationen dazu gibt es keine. An diesem Tag hätten wir eine Exkursion in unsere Wohnung anbieten können zum Thema: Leben im Mittelalter.
Es gibt noch ein weiteres Phänomen. Das Telefon hatte schon häufiger Aussetzer, die ohne Reparaturen wieder vorübergehend verschwanden. Sobald wir uns jedoch über den schleppenden Remont bei Herrn Ost am Telefon beklagen, quittiert es unmittelbar danach für zwei Stunden seinen Dienst. Das ist kein Zufall, sondern hat System. Im oberen Fach unseres eingebauten Wandschranks auf der Diele haben wir ein kleines Loch in der Wand zum Treppenhaus gefunden. Michael, der sich gut darin auskennt, behauptet, dahinter verberge sich eine Abhöranlage. Solche Wanzen, das wissen Ausländer, gibt es nicht nur in allen Ausländerwohnungen, sondern auch in Firmenbüros, Botschaften und Hotels. Wenn man die findet und zerstört, muss man sich nicht wundern, auf einmal ausgewiesen zu werden.
Die beiden Ingenieure, die ohne Ankündigung hereinschneien - sie wissen natürlich von der Zentrale, dass wir zu Hause sind - begutachten den Arbeitsfortschritt, wiegen bedenklich ihre Köpfe und machen sich Notizen. Einer von ihnen, ein sympathischer Lockenkopf, legt einen schwarzen Koffer auf seinen Oberschenkeln ab, klickt ihn auf und dreht ihn in unsere Richtung. Keine gebündelten Banknoten, keine Akten, sondern eine einsame Wandfliese, rutschfest eingebettet wie ein Schmuckstück, präsentiert sich uns. Ein Muster für unser Bad. Vor einiger Zeit war doch schon einmal eine Frau mit einer Fliesenprobe bei uns, oder habe wir das geträumt? Es muss stimmen, denn es geschieht äußerst selten, dass zwei Menschen zur gleichen Zeit den gleichen Traum haben. Der Lockenkopf entnimmt dem Koffer die Fliese und hält sie im Bad neben die noch an der Wand befestigten anderen. Ob es uns sehr störe, dass die Musterfliese einen anderen Farbton habe, fragt er anstandshalber. „Nitschewo“, antworten wir wie aus einem Munde - wie damals auch.
Einen Tag später findet ein Großeinsatz in unserer Wohnung statt. Gleich zwei Teams rücken an. Zwei UPDK-Männer machen sich im Bad zu schaffen. Herr Sadowski und ein Schreiner, beide aus der Botschaft, werkeln in der Küche herum. Herr Sadowski prüft alle elektrischen Anschlüsse und bringt sie auf den neuesten Stand der Technik, und der Tischler nimmt Maß für das Zuschneiden der Arbeitsplatte und der Aussparung für die Spüle. Später wird getauscht, denn auch im zukünftigen Wäscheraum müssen die Anschlüsse gängig gemacht werden. Herr Sadowski setzt dazu an, die schmale Badezimmertür aus den Angeln zu heben, damit die Maschinen bequemer durchpassen; schon hat der verdutzte Mann einen Türgriff in der Hand, der aus dem trockenen Holz gebrochen ist. Derweil arbeitet in der Küche einer der beiden Russen, ein netter, humorvoller Mann, der den ganzen Nachmittag am Stöhnen ist, wenn es nicht so gut läuft, und laut singt, wenn die Arbeit vorangeht. Beim Abnehmen der Fußleisten in der Küche singt er. Die Leisten sind genagelt. Die ellenlangen Nägel fanden nie den rechten Halt, weil sie hinter der dünnen Putzschicht ins Nichts stießen. Daher kann der gute Mann die Leisten tatsächlich ohne Werkzeug und Kraftaufwand abnehmen. Beim Zurechtstückeln und Anpassen der alten Leisten an die neuen Gegebenheiten stöhnt er.
Die Türfüllung ist immer noch zu schmal, als dass eine der Maschinen hindurchpasst. Doch die deutschen Handwerker sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Sie haben sich einiges vom Improvisationstalent ihrer russischen Kollegen abgeguckt. Ein fachmännischer Blick, und schon setzt der Tischler seine Säge an. Er schneidet auf gleicher Höhe links und rechts jeweils ein Stück Zarge heraus, so dass die Maschinen nun problemlos in das Kabuff transportiert werden. Den zweiten Türgriff entfernt er ganz vorsichtig. Dann greift er zur Stichsäge und schneidet das unschön zersplitterte Holz sauber heraus. Das ist praktisch, denn die Maschinen können bei dieser Luftzufuhr von außen genauso gut arbeiten, wenn nicht noch besser.
Ziemlich viel Zeit verbringen die beiden damit, den verstopften Abfluss frei zu bekommen. Kräftige lange und biegsame Drähte mit Widerhaken verschwinden tief im Rohr, um Widerstände aufzuspüren und ihnen den Garaus zu machen. Fehlt noch das Waschbecken. Am ursprünglichen Ort ist dafür in dieser engen Kammer kein Platz mehr. Die Wasserentnahme geht nur über den Schwenkhahn, der ehemals der Badewanne gedient hat. Gut, dass der nicht mit abmontiert wurde! Und genau dort hängt nun das kleine Waschbecken, voll funktionsfähig, nachdem der undichte Abfluss noch kurz repariert wurde – ein Waschbecken, vor dem man niederknien muss, wenn man seine Hände waschen will. Was nun noch fehlt, sind die Feinarbeiten des Fliesenlegers. Und die Reparatur der Bad-Lüftung. Ach ja, und der WC-Spülung. Auf beides warten wir seit Dezember. Wahrscheinlich stammen sämtliche Schwimmer dieses Riesenreichs noch aus der Zeit der Industrialisierung in den Zwanzigerjahren. Überraschung: Sergej hat versprochen, demnächst das Fernsehgerät an die Hausantenne anzuschließen. Mal sehen, was er sich da zusammengebastelt hat, damit das endlich funktioniert!
Das wichtigste Ergebnis dieses ereignisreichen Tages: Nach knapp zehn Monaten hat unsere Spülmaschine ihren ersten Einsatz: Ende der lästigen Handarbeit!
Meine eigenen Heimwerkerarbeiten sind nicht gerade von Erfolg gekrönt. Zuerst rutscht mir beim Zusammenmontieren ein Hängeschrank vom Tisch. Wenig später beim Anbohren der Vorrichtung für den Duschvorhang fällt mir eine Wandfliese entgegen. Erschütterungen mögen diese Fliesen gar nicht.
Noch existiert keine offizielle Mitteilung über eine Zusammenlegung der beiden deutschen Schulen zum 1. September. Beide Kollegien sprechen sich dafür aus, die bisherige behutsame Annäherung weiter zu vertiefen. Seit Monaten gibt es gegenseitige Unterrichtsbesuche, Gespräche unter Fachkollegen, gemeinsame Klassenfeste, Schülerdiskos und einen gemeinsamen Mathematikwettbewerb. Wenn es zu einer vernünftigen, gleichberechtigten Planung und Zusammenarbeit kommen soll, brauchen wir viel mehr Zeit. Noch haben wir die einmalige Chance, ein Konzept zu entwickeln, das an anderen Stellen als Vorbild dienen könnte. Nichts wäre ungünstiger, als den DDR-Kolleginnen und -Kollegen das Gefühl zu geben, es sei längst beschlossene Sache, sie in Kürze unseren westdeutschen Standards zu unterwerfen. Vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften liegen beide Systeme inhaltlich weit auseinander. Ähnlich sieht es bei den Erziehungsgrundlagen, Erziehungszielen und den methodisch-didaktischen Konzepten aus. In den Gesprächen wird deutlich, dass die Vorstellungen von Ordnung und Disziplin sowie beim Lehrer-Schüler-Verhältnis stark voneinander abweichen. Interessant wird es, wie wir mit den Erfahrungen des polytechnischen Unterrichts umgehen.
In vierzig Jahren sind auf beiden Seiten Vorbehalte und Vorurteile, unterschiedliche Traditionen und Wertvorstellungen gewachsen, die sich nicht mit einem bürokratischen Federstrich überwinden lassen.
Diese Überlegungen und Sorgen fassen wir am Ende einer langen Lehrerkonferenz in der Ulitsa Tschaikowskowo in einem ausführlichen Brief zusammen, den wir an die beiden deutschen Innenminister, die beiden Botschaften in Moskau und an die Schulleitung der DDR-Schule senden - mit dem Ziel, die Zusammenlegung zu vertagen.
Die staatlichen Läden wurden verstärkt dazu aufgefordert, Waren nur noch gegen das Vorzeigen des Ausweises herauszugeben. Vor allem Lebensmittel werden zunehmend rationiert, zum Beispiel Butter auf 300 Gramm, Mineralwasser je nach Status auf 3-5 Flaschen. Kriegsveteranen haben grundsätzlich einen privilegierten Status. Vor dem GUM und dem Kaufhaus Moskwa sieht man nur noch kleinere Schlangen, weil die großen Warenhäuser inzwischen fast leergekauft sind.
Ein besonderer Engpass zeichnet sich seit längerer Zeit im Bereich Glühbirnen ab. Wenn Glühbirnen im häuslichen Umfeld kaputt gehen, genau das passiert wegen der schwankenden Stromspannung öfter als bei uns in Deutschland, und dann kein Ersatz vorhanden ist, kann sich das, besonders an kurzen Wintertagen, trübe auf das familiäre Klima auswirken. Weitsichtige Bürger gehen deshalb dazu über, Glühbirnen am Arbeitsplatz herauszuschrauben und sie durch ein von zu Hause eingeschleustes durchgebranntes Exemplar zu ersetzen. Die Büroleuchte hellt dann zu Hause die Stimmung schlagartig wieder auf. Wenn das in großem Stil Schule macht, stehen der sowjetischen Volkswirtschaft allerdings finstere Zeiten bevor. Wenn auf dem Schwarzmarkt nun auf einmal funktionstüchtige Glühbirnen ohne Verpackung auftauchen, muss es sich demnach um Hehlerware handeln.
Bei Stockmann werden wir unverhofft Zeugen eines gescheiterten Kreditkartenbetrugs. Ein Kartendieb wird dingfest gemacht, als er zur gleichen Zeit an einer Nebenkasse steht wie der Karteneigentümer und weil die Kassiererin zufällig den echten Kartenbesitzer kennt. Der Wachdienst ist augenblicklich zur Stelle. Dazu passt, dass die Mafia, wer immer damit auch gemeint sei, angeblich den Sadko leer geräumt hat, der deshalb nur noch sporadisch öffnet.
Als wir in unserem Produkti Butter kaufen wollen, müssen wir keinen Ausweis vorzeigen. Vielleicht, weil man uns inzwischen kennt? Als wir fragen, welche Ration uns zusteht, zuckt die Verkäuferin die Schultern, wirft einen Klotz Butter von einem Kilo auf die Waage und legt ihn für uns beiseite, bis wir mit dem Zahlungsbeleg zurück sind. Beim Auswickeln aus dem Packpapier erwartet uns eine böse Überraschung: Der Butterklumpen ist stark angeschimmelt und landet sofort im Müll. Diese Verkäuferin merken wir uns.
In der Nacht auf Samstag gibt es das erste Mal seit 1899 in Moskau im Juni Nachtfrost.