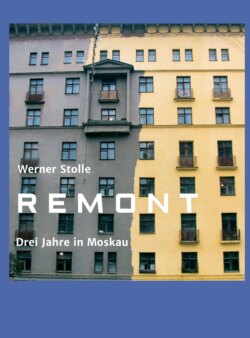Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление95 Oktan
29. Juni – 2. Juli 1990
Einen Abend später besuchen uns Lena und Wolodja. Gegen Mitternacht stößt Wassilij noch dazu, leicht angeheitert. Er kommt von einem Empfang der deutschen Botschaft, wo er seit kurzem die Dolmetscher beim Small Talk der Gäste unterstützt und sich damit ein kleines Zubrot verdient. Als Geschenk überreicht er uns ein fein gearbeitetes Holzmodell der Basilius-Kathedrale, knapp zwanzig Zentimeter groß.
Die drei wünschen sich eine engere Bindung an Deutschland, träumen von Reisefreiheit und Demokratisierung im eigenen Lande. Vom neuen Moskauer Bürgermeister Popov erhoffen sie sich, dass er die Stadt zu einer weltoffenen Metropole macht. Boris Jelzin können sie noch nicht richtig einschätzen.
Wir sehen der Entwicklung in Deutschland mit gemischten Gefühlen entgegen. Heute, am 1. Juli, tritt die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen den beiden deutschen Staaten in Kraft. Das selbstherrliche Getue unseres Kanzlers, der ständig den Mantel der Geschichte bemüht, geht uns ziemlich gegen den Strich, zumal wir beinahe täglich hören, mit welchen Widrigkeiten heimkehrende DDR-Bürgerinnen und -Bürger zu kämpfen haben und wie skeptisch viele von ihnen in die Zukunft schauen.
Die Tschechoslowakei verlangt als erstes sozialistisches Land ab heute kein Visum mehr für Westeuropäer. Am Abend siegt die BRD gegen die Tschechen im WM-Viertelfinale mit 1:0. Müssen wir deshalb fürchten, von der neuen Reiseerleichterung wieder ausgeschlossen zu werden? Das Fußballergebnis habe ich mir aus dem Weltempfänger erarbeitet. Das russische Fernsehen hat das Spiel zwar live übertragen, aber außer dem ständigen Rauschen wurde der Sehgenuss zusätzlich dadurch getrübt, dass Spieler und Ball drei Schatten hatten, die sich natürlich ständig mit bewegten. 44 Spieler, 4 Bälle und 12 Schiedsrichter – das wurde selbst mir zu viel.
Die sowjetischen Spieler hätten bei einem Einzug ins Achtelfinale 1500 Rubel bekommen, bei einem Sieg im Viertelfinale 2000, im Halbfinale 4000 und im Endspiel 8000 Rubel. Vielleicht sind diese Prämien ein Grund dafür, dass die Mannschaft schon in der Vorrunde ausgeschieden ist.
Wenn das Benzin im Tank zur Neige geht, sucht man eine nahe gelegene Tankstelle auf und lässt das Auto von einem freundlichen Tankwart volltanken, oder man bedient sich selbst. Der Zahlungsvorgang verläuft ohne Komplikationen. Tanken ist so alltäglich wie Zähneputzen – in Deutschland.
In Moskau an Benzin heranzukommen, ist ein reines Vabanque-Spiel. Deshalb läuten bei jedem Autofahrer bereits die Alarmglocken, wenn der Tank noch halb voll ist, beziehungsweise halb leer. Jetzt gilt es, alles daran zu setzen, die fehlende Menge an Benzin so bald wie möglich zu ergänzen. Für eine Weltstadt wie Moskau ist die Tankstellendichte vergleichbar mit Mali, mit dem Unterschied, dass es in Mali Hinweisschilder auf Tankstellen gibt und der Tankvorgang ähnlich abläuft wie fast überall auf der Welt. Die wenigen Tankstellen, die meist versteckt in Hinterhöfen liegen und erst auf den zweiten Blick als solche identifiziert werden können, weil sie so unscheinbar sind, muss man sich von einem Eingeweihten zeigen lassen. Ein besonders gutes Werk tut der Eingeweihte, wenn er einem Anfänger beim Tanken und Zahlen hilft, denn einen Tankwart oder anderes Servicepersonal wird man hier vergeblich suchen.
Ausländer können nur dann Benzin erhalten, wenn sie vorher Taloni, Benzingutscheine, in ihrer Botschaft gekauft haben. Auf so einem Talon steht die Literzahl, die dieser Gutschein wert ist. Es gibt fast nur 20-Liter-Scheine, was die Lage zusätzlich erschwert, da man den Tank in den seltensten Fällen mit so großen Einheiten ganz voll kriegt. Man hat natürlich die Option, das Fahrzeug vollzutanken und, falls noch einige Liter Guthaben auf der Säulenanzeige stehen, den Rest in einen Benzinkanister zu füllen. Es gibt entweder Diesel oder Benzin mit 95 Oktan.
Und so tankt man richtig:
Man fährt an eine freie Tanksäule heran und steigt aus, um den Tankrüssel in den Tank zu schieben. Wenn man das nicht zuerst macht, wird man auf der Stelle über ein Mikrofon von einer Tankwartin angeraunzt. Hat man zu Beginn alles richtig gemacht, geht man zu einem vergitterten Kiosk, der in Bauchhöhe eine Öffnung besitzt, über der sich ein kleines, mit milchiger Gaze verhängtes Sprechloch befindet. Man beugt sich tief herunter und schiebt die Taloni in die Öffnung. Eine Hand schnappt danach. Nach einem gegrummelten Okay aus dem Sprechloch ist die Säule freigeschaltet. Mehr als die Hand der Tankwartin bekommt man nicht zu Gesicht. Aber ihre Stimme kann noch einmal besonders unangenehm über das Gelände schallen, wenn ein Tropfen kostbaren Benzins auf den Boden fällt. Hier ist höchste Konzentration angesagt, damit man nicht vor den anderen Tankkunden niedergemacht wird.
Leider läuft es nicht immer so geschmiert wie es sein sollte. Manchmal weigert sich die Tankwartin, einen Benzincoupon anzunehmen – ohne Begründung. Sie schmettert einem einfach ein kurzes, hartes Njet entgegen. Das war’s. Es ist schon sehr frustrierend zu sehen, wie aus allen anderen Schläuchen das Benzin fließt und man selbst seinen Rüssel umsonst eingehängt hat. Hat man zufällig eine Blumenstrauß, eine Tafel Schokolade oder eine Leerkassette dabei, lässt sich die gewissenhafteste Tankwartin erweichen und gibt Benzin in beliebigen Mengen ab, selbst gegen Rubel und wenn es nicht anders geht, auch gegen Dollar oder D-Mark.
Und wegen dieser Unwägbarkeiten ist der Adrenalinausstoß an Tankstellen höher als bei Grenz- oder Polizeikontrollen.
Es ist 7 Uhr 15. Unser Taxifahrer Boris ist auf die Minute pünktlich. Er soll uns zum Flughafen Scheremetjewo fahren, denn heute fliegen wir nach Lissabon. Es heißt, er sei Journalist und arbeite für eine geheime Behörde. Durch solche Touren bessert er sein Monatseinkommen auf. Es gibt in Moskau hunderte solcher Privattaxis, die auf Kundenfang in der Stadt unterwegs sind. Michael hat uns Boris Telefonnummer gegeben. Er hat gute Erfahrungen mit ihm gemacht.
Nun steht Boris rauchend unten vor dem Haus. Ich gebe ihm vom Balkon aus ein Zeichen, dass wir gleich unten sind. Ein freundlicher, älterer Mann mit dicken Brillengläsern und Nikotinfingern kommt uns rauchend entgegen, um uns Gepäck abzunehmen. Er wirkt aus irgendeinem Grunde leicht gestresst. Die Kofferraumhaube seines hinten eingedetschten Schigulis rührt sich nicht, als ich sie öffnen will. Für Boris kein Problem. Er rüttelt und zerrt ein wenig an der Haube herum, und schon springt sie auf. Wahrscheinlich hat Boris keinen Keller, denn um einen völlig blanken Reservereifen verteilt sich allerhand undefinierbares Geraffel. Boris taucht kurz in den Kofferraum ab und sortiert einige Sachen so um, dass ein Koffer gerade hineinpasst. Die Reisetaschen und das Handgepäck sollen wir mit nach vorn nehmen, sagt Boris. Die fehlenden Türfüllungen haben den Vorteil, dass Heidi, Annika und Ingmar hinten etwas mehr Beinfreiheit haben. Ich fädele mich auf dem Beifahrersitz ein, was nicht ganz einfach ist, weil ich nicht auf Anhieb einen festen Untergrund finde, auf dem ich meine Füße platzieren kann, denn dort liegt auch so einiges herum. Die Reisetasche auf meinem Schoß ist gerade so groß, dass ich noch freie Sicht nach vorn habe, sofern ich an einem mit Klebeband abgedichteten langen Riss in der Frontscheibe vorbeischaue. Boris zündet sich seine nächste Zigarette an. Eigentlich ist für eine ausgerauchte Zigarette kein Platz mehr im völlig überlasteten Bordaschenbecher. Am fleckigen Plastikhimmel dominiert die Farbe nikotingelb. Nach geschätzten 30 Jahren unablässigem Gequalme ist das kein Wunder.
Immerhin springt der Wagen sofort an.
Das Benzin sei fast alle, sagt Boris und dämpft unsere Freude über das sonore Motorengeräusch. Aber zum Glück gebe es ja Tankstellen, sagt er mit ironischem Unterton in gebrochenem Englisch und schnippt die brennende Kippe aus dem geöffneten Fenster. Nun ist uns auch bewusst, warum er die ganze Zeit über so nervös wirkt.
Die erste Tankstelle am Vernadskowo, die er ansteuert, verweigert ihm den Zugang zur Säule. Die sei nur für staatliche Fahrzeuge, habe die Tankwartin ihm gesagt. Für Ausländer offensichtlich auch, denn hier tanken wir immer, wenn es genehm ist, obwohl unser Passat keine Staatslimousine ist. Obwohl heute früh niemand außer uns Benzin begehrt, werden wir abgewiesen. In der Türkei hatte ich aus Versehen die russischen Benzincoupons dabei. Vor dieser Reise habe ich sie extra aus meinem Portmonee genommen. Wer weiß, ob die mitleidslose Person für Diplomaten bestimmtes Benzin in einen alten, klapprigen Schiguli gelassen hätte. Um sich etwas zu beruhigen, zündet Boris sich eine weitere Zigarette an. Zum Glück ist das kein Machorka, den er raucht, sonst wären wir längst erstickt.
Die nächste Tankstelle, die wir nach kleineren Umwegen anlaufen, hat heute geschlossen. Die dritte Tankstelle, die wir nach weiteren Umwegen erreichen, hat geöffnet. Zwölf Fahrzeuge stehen noch vor uns in der Warteschlange, zähle ich. Alle haben ein bis zwei 20-Liter-Kanister dabei, die auch noch gefüllt werden sollen. Wie mag ein Kettenraucher wie Boris wohl an diesem Ort, wo strengstes Rauchverbot herrscht, auf Nikotin-Entzugserscheinungen reagieren, frage ich mich. Außerdem frage ich mich, ob wir nicht in ein richtiges Taxi umsteigen sollten. Wenn nicht ein Wunder geschieht, ist hier unsere Fahrt mit Boris beendet.
Er nähert sich dem Kiosk der Tankwartin, um mit ihr in gebückter Haltung durch das Sprechloch zu kommunizieren. „95 Oktan? Njet!“, gellt es so laut aus dem Mikrofon, dass jetzt auch der letzte Anwohner aus dem Schlaf gerissen wird. Als sich unerwartet die Kiosktür öffnet, keimt noch einmal Hoffnung auf. Kommt es doch noch zu einer gütlichen Einigung? „Njet!“, hören wir sie auch ohne Mikrofon toben. Sie knallt ihm die Tür vor der Nase zu.
Aber unser Boris gibt nicht so schnell auf. Noch einmal will er mit ihr verhandeln, jetzt wieder in gebückter Haltung. Da presst die unbarmherzige Frau ein selbst geschriebenes Pappplakat an die Glasscheibe. „95 njet“, steht dort geschrieben. Nun haben wir es schriftlich, dass für unseren Fahrer heute kein 95-ger Benzin ausgeschenkt wird. Darunter steht, etwas kleiner: nur mit Talon.
Verzweifelt wendet Boris sich an die wartenden Autofahrer. Wer lässt uns vor, wer hält seinen Schlauch für fünf Liter in den Schigulitank, wer kann einige Liter aus seinem vollen Kanister abzweigen? Er hat Erfolg. Wir wollen ihm nicht unterstellen, dass er dem freundlichen Helfer im Flüsterton wissen ließ, dass er Mitarbeiter einer geheimen Behörde sei. Jedenfalls kommt der nette Mensch mit seinem gerade frisch gefüllten Kanister und gießt einen Teil davon in unseren Tank. Gott sei Dank, denken wir. Nun kann er rauchen, so viel er will. Hauptsache, wir erreichen den Flughafen noch rechtzeitig.
Boris steigt erleichtert ein, entschuldigt sich mehrfach bei uns, wischt mit grobem Krepppapier seine beschlagene Brille ab, zündet sich eine Zigarette an und gibt Gas. Er muss sich sehr gut auskennen, denn wir rasen durch ein Labyrinth von Nebenstraßen, ohne Rücksicht auf Schlaglöcher oder Straßenbahnschienen. Wir haben inzwischen längst jede Orientierung verloren. Boris freut sich offenbar, uns zeigen zu können, welche verborgenen Kräfte in einem robusten, alten Schiguli schlummern. Die Frontscheibe hält bis zum Flughafen durch. Strahlend parkt Boris in der Parkverbotszone und besteht darauf, unseren Koffer bis zum Check-In-Schalter zu bringen. Jetzt hat sich die Anspannung auf beiden Seiten sichtbar gelöst. Bis zum nächsten Mal, heißt es zum Abschied.
Das ist mal wieder typisch. Während der Fahrt mit Boris hatten wir das Gefühl, den Flughafen gar nicht oder viel zu spät zu erreichen. Nun sind wir doch einigermaßen pünktlich in Scheremetjewo und lesen auf der Anzeigetafel, dass der Flug um eine Stunde verschoben wird, und zwar wegen eines schon vor Wochen angekündigten Generalstreiks (was wir längst wieder vergessen hatten).
Die Aeroflot-Maschine ist bis auf den letzten Platz gefüllt, aber nicht überbucht, was einem bei Turkish Airlines durchaus passieren kann. Bei den mitreisenden, durchweg bestens gelaunten Sowjetbürgern scheint es sich um einen Ketteraucherklub zu handeln; es wird gequalmt, was das Zeug hält. Im Duty-Free-Shop-Prospekt kann ich durch die Rauchschwaden hindurch gerade noch den folgenden Satz entziffern: „Die Preise sind in russfachen Rubeln“, heißt es auf Deutsch und ist doch nicht auf Anhieb verständlich. Es kann nur bedeuten, dass die Preise in Goldrubeln und nicht in Holzrubeln ausgezeichnet sind. Zahle ich also per Kreditkarte, wird der offizielle Rubelkurs zugrunde gelegt, und der liegt mindestens zehnmal so hoch wie der Straßenkurs. Wir haben, wie alle anderen auch, eine Quelle, die uns mit Rubeln versorgt. Wenn Michael und Sabine bei uns zum Essen eingeladen sind, fällt im Laufe des Abends der Satz: „Lass uns mal eine rauchen!“ Auf dieses listige Signal hin greifen wir zu unseren Plastiktüten und gehen auf den Balkon, wo es zum Tütentausch kommt. Mich interessiert nur Michaels Rubeltüte, nicht seine Quelle. Im Gegenzug erhält er von mir Dollars oder D-Mark. Nach dieser Aktion gehen wir wieder rein und rauchen eine; Michael eine Zigarette, ich eine Pfeife. Das Thema Geldtausch ist in geschlossenen Räumen grundsätzlich tabu.
Vor uns kämpft ein Fluggast mit dem Klappmechanismus des ausziehbaren Tischchens. Nachdem er die Arretierung gelöst hat, stellt die ungeduldige Stewardess das hübsche, kugelförmige, mit Wasser gefüllte Glas darauf ab. Sofort rutscht es von der schiefen Ebene direkt auf den Schoß des Passagiers. Es ist ja zum Glück nur Wasser. Die Aeroflot-Tische sind bekannt dafür, dass sie sich nicht gerade ausrichten lassen. Wir nehmen die Gläser von Hand zu Hand an und platzieren sie auf der zuvor aus Papier gefalteten Ausgleichsfläche, so dass sie einigermaßen sicher stehen. Zu essen gibt es diesmal ein halbes Hühnchen mit Kartoffeln als Beilage. Das Essen ist lauwarm, so dass keine schwerwiegenden Schäden angerichtet werden, sollte einem der Teller auf die Hose rutschen. Bei der Essensausgabe kleckert mir eine Stewardess die Schulter voll. Es tut ihr wirklich leid, das sieht man ihr deutlich an. Sie möchte die kleine Panne mit einem netten Gespräch überspielen. „Mittelasien feiert“, sagt sie leicht entschuldigend mit Blick auf den Raucherklub, der sich massiv mit Wodka und Schnaps eingedeckt hat und immer mehr in Stimmung gerät. Später stellt sich heraus, dass die Reisegruppe aus Murmansk stammt.
Mit dem üblichen Bordbesteck, das aus Sicherheitsgründen klein, unhandlich und stumpf ist, lassen sich die Kartoffeln ganz gut verarbeiten, das halbe Huhn nicht. So sieht man im ganzen Flugzeug Menschen vornübergebeugt und mit zehn Fingern Hühnerfleisch abnagen. Nach der Mahlzeit wünscht man sich nichts sehnlicher als ein kleines Reinigungsfeuchttuch. Das fehlt heute auf dem Tablett.
Von Lissabon aus fahren wir mit unserem Leihwagen, einem Opel Corsa, entlang dem Tejo nach Nordwesten. In Caldas da Rainha biegen wir ab Richtung Atlantik. Unser Ziel ist der winzige Ort Foz do Arelho, der an einer Lagune liegt. Wir können alles ruhig angehen lassen, da wir durch die Zeitverschiebung drei Stunden gewonnen haben. Auf einer Anhöhe, von der eine Treppe zum Strand führt, liegt ein kleines braunorangefarbenes Hotel mit weiß eingefassten Fenstern, das uns sofort anspricht, obwohl es nicht im allerbesten Bauzustand ist. An den Außenwänden bröckelt der Putz, an der hohen Eingangstür ist ein großer Teil der weißen Farbe abgeblättert. Über der Holzbank neben dem Eingang kreischt pausenlos ein Ara. Wahrscheinlich ist ihm sein Käfig zu eng. Im kleinen, mit antikem Mobiliar eingerichteten, gemütlichen Foyer fallen einem sofort mehrere Porzellanhunde in allen Größen ins Auge. Es riecht leicht muffig. Dennoch übt dieses heruntergekommene Ambiente einen Reiz auf uns aus, dem wir nicht widerstehen können. Hinzu kommen die Traumlage am Meer, der Blick auf die von hohen Felsen umsäumte Bucht und der überaus freundliche Empfang durch die Dame an der Rezeption. Hier bleiben wir vorerst.
Nach einem erfrischenden Bad im nicht zu warmen Atlantik gehen wir im Strandrestaurant essen. Bei der Bestellung gibt es Kommunikationsprobleme, weil wir kein Portugiesisch sprechen und die etwas schlecht gelaunte Bedienung mit Englisch wenig anzufangen weiß. Da hilft nur noch Zeichensprache. Überraschenderweise serviert sie uns die dreifache Menge an Speisen. So großen Hunger haben wir nicht, da das Aeroflot-Hühnchen recht lange vorgehalten hat. Immerhin zeigt sie sich durch ihre Handlung einsichtig, nicht aber in ihrer Überzeugung, alles richtig gemacht zu haben. Unwillig zieht sie mit den nicht bestellten Gerichten ab.