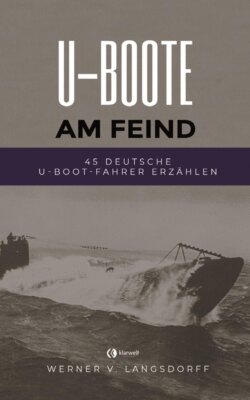Читать книгу U-Boote am Feind - Werner von Langsdorff - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kriegsfahrt zu den Senussi - Von Hans Fechter
ОглавлениеIm Oktober 1915 bekam U 35 Befehl, aus einer verschwiegenen Bucht des Golfes von Kos türkische Offiziere und Munition und einen Schleppzug mit gleicher Last nach Afrika zu den Senussi zu bringen. Wir nahmen 2 Trabakel in Schlepp. In der Straße von Skarpanto sahen wir im Mondschein einen anderen sonderbaren Schleppzug: Ein Fischdampfer schleppte einen dunklen Gegenstand, den wir nur für ein U-Boot halten konnten. Später erfuhren wir, dass es tatsächlich ein solches gewesen ist. Am folgenden Morgen erschien nämlich ein Fischdampfer in jener verschwiegenen Bucht, in der wir unsere Ladung an Bord genommen hatten, und setzte ein Landungskorps an Land. Der deutsche Offizier bereitete ihm aus einer Flankenstellung mit seiner aus drei deutschen und zwölf türkischen Soldaten bestehenden Streitmacht einen so warmen Empfang, dass er sich mit mehreren Toten und Verwundeten sofort wieder an Bord zurückzog. Nun wurde von dem Fischdampfer aus das Feuer erwidert und gleichzeitig tauchte mitten in der Bucht ein U-Boot auf, das uns wohl abschießen sollte. Also wieder Verrat! Indes ärgerten wir uns reichlich über die Trabakel-Führer, die keine Seeleute waren. Ihre Schleppleine geriet uns in die Schraube, so dass ich mich schließlich trotz der Dünung, die alle Augenblicke über das Heck lief, der Länge nach hinlegen musste, um die Schraube klar zu bekommen. Inzwischen segelten unsere Trabakel davon. Am nächsten Morgen fanden wir statt ihrer einen englischen Dampfer, der sich nach ein paar Schüssen ergab. Wir schlugen den türkischen Offizieren vor, ihn als Prise nach Port Bardya zu bringen, das nur einen halben Tag entfernt war. Aber sie wollten nicht und wir selbst konnten niemanden entbehren. So mussten wir das Schiff versenken. Nachmittags schossen wir auf einen Dampfer, der floh und dann in der Dunkelheit zu entkommen suchte. Unser Mündungsfeuer blendete so, dass wir ihn nach jedem Schuss erst suchen mussten. Plötzlich war er dicht bei uns. Er war in der Dunkelheit auf uns zugelaufen, wohl um uns zu rammen. Wir mussten schleunigst abdrehen und die Jagd aufgeben. Die Türken konnten wir nicht alle auf den Turm oder auch nur in die Zentrale lassen. Dazu war ihre Anzahl zu groß. Ich ließ jeden aber einmal durch das Sehrohr sehen. Mit rollenden Augen und fast schäumendem Mund fragten sie mich: „Warum ergibt er sich nicht? Was werden Sie mit ihm machen? Ich würde ihn töten!“ Meine Antwort, dass wir ihn erst einmal haben müssten, schienen sie beinahe als persönliche Kränkung aufzufassen.
Am nächsten Morgen standen wir vor Port Bardya. Die Türken warnten uns, mit unseren Marinemützen an Deck zu gehen, denn die Araber schössen auf jeden Träger einer solchen. Sie liehen uns freundlich ihre Schakals (Lammfellmützen). Trotzdem wurden einige Schüsse vom Ufer auf unser Boot abgefeuert. Erst als der türkische Major mit dem Dingt an Land fuhr und dabei die grüne Flagge des Propheten entfaltete, gingen die Schüsse in ein Freudenschießen über. Und dann war der Empfang ganz afrikanisch herzlich. Als der Dingi-Gast wieder an Bord kam, wischte er sich dauernd beide Backen. Ich fragte ihn, was er habe. Da erzählte er, dass sie ihn an Land abgeküsst hätten, nicht nur einmal, sondern alle der Reihe nach.
Das Ausladen unserer Ladung war schwierig, da nur unser Dingi, keine Brücke zur Verfügung stand. Da im nahen Solum drei englische Kreuzer liegen sollten, öffneten wir zurzeit nur immer ein Luk, um möglichst tauchklar zu bleiben. Oben auf dem Berge neben der Einfahrt wurde ein Araberposten aufgestellt, der mit bloßem Auge das Auslaufen der Kreuzer aus Solum hätte sehen können. Kaum standen die ersten Kisten an Land, da kamen die Araber in hellen Scharen. Jeder nahm eine Munitionskiste auf die Schulter und zurück ging es im Laufschritt. In 5 Stunden war die Arbeit geschafft.
Inzwischen war der Oberkommandierende des türkischen Heeres Nuri Pascha an Bord gekommen, mit Stab, darunter der später ermordete Rittmeister Mannesmann. Sie baten unseren Kommandanten, Kapitänleutnant Kophamel, um ständige U-Boot-Verbindung mit den Mittelmächten und der Türkei. Die Araber ließen es sich trotz ihrer Lebensmittelknappheit nicht nehmen, uns zwei lebende Hammel zu schenken. Als die Arbeit fertig war, sprang alles außenbords, denn trotz des 4. November war das Wasser 29 Grad warm. Viele Schwammen dem Land zu, um dort das Schlachten der Hammel zu beobachten oder, was ich noch eher glaube, ein Auge auf die Arabermädchen zu werfen, die unverschleiert am Lande standen. Da krachte ein Schuss. Niemand kümmerte sich zunächst darum. Die Araber hatten am Morgen so oft in die Luft geknallt. Erst als schreiend und winkend ein Araber den Berg herabstürzte, begriffen wir, dass die englischen Kreuzer kamen. Alles schwamm eiligst an Bord. In Badehosen wurde das Boot tauchklar gemacht und wir sahen uns nach den Kreuzern um, konnten aber bis zum Dunkelwerden nichts finden. So ankerten wir im Eingang der Bucht. Es war eine herrliche Nacht, so ruhig und still, so warm und milde. Anfangs saßen wir zu vieren im Turmluk, der Kommandant mit seinen drei Offizieren. Aus dieser abendlichen Unterhaltung wuchs langsam der Plan, die drei englischen Kreuzer abzuschießen. Tiefer und tiefer sank die Nacht und der Inhalt der letzten Wermutflasche nahm in gleichem Maße ab. Ein Wachoffizier löste den anderen ab, der Kommandant ging auch schlafen, nur ich wachte als letzter dem Morgen entgegen. Von Land wurde mit bewundernswerter Ausdauer die ganze Nacht nach uns hin gemorst. Es waren türkische Signale, wir sollten wohl den Major abholen. Aber wir waren zufrieden, endlich wieder einmal unter uns sein zu können.
Um 5 Uhr früh standen wir vor dem Hafen Solum. Ein Blick durch das Sehrohr zeigte dem Kommandanten, dass im Hafen nur zwei kleine Fahrzeuge lagen, die er eines Torpedoschusses nicht für wert hielt. Aber wir unten in der Zentrale hielten Nichtschießen für unvereinbar mit dem Ansehen der deutschen Flagge bei den Arabern und Türken. Der Kommandant ließ sich erweichen, aber beim Heranfahren kamen wir auf Dreck. Bei so flachem Wasser hätte ein Torpedo beim Einsteuern zu leicht vor unserem Bug in den Grund gehen können. Also kehrt. Bald trafen wir einen Dampfer mit zwei Schornsteinen und zwei Masten, den wir torpedierten. Die Besatzung wollten wir in Afrika als Gefangene lassen. Viele hatten nichts am Leibe, denn Sie waren unmittelbar aus der Koje ins Wasser gefallen. Ohne irgendwie aufgefordert zu sein, verteilten unsere Leute ihr eigenes Zeug unter die Gefangenen, damit Sie nicht der südlichen Sonne zu sehr ausgesetzt wären. Auch Tabak und Zigaretten wurden, ohne lange zu fragen, geteilt. Es war der englische Hilfskreuzer „Tara“, 6322 Tonnen. Nach Abgabe der Gefangenen bekamen wir eine Quittung über 15 Offiziere, 79 Mann, 7 Tote. Sie wollte Nuri Pascha dem Groß-Senussi schenken, um ihn damit endgültig auf seine Seite zu ziehen. Ehe wir abfuhren, bat uns Nuri Pascha, in Solum die beiden Schiffe und das Haus des englischen Konsuls zu vernichten. Auch sonst war seine Kriegsführung von keiner Humanität angekränkelt. So sagte er, als wir ihm erzählten, die Araber hätten anfangs auf uns geschossen: „Wieviel soll ich töten lassen?“ Auf die Erklärung, dass wir das ja gar nicht wollten, erwiderte er erstaunt: „Warum erzählen Sie es mir denn?“
Wir fuhren also wieder nach Solum und eröffneten das Feuer mit unserem Geschütz, jeden Augenblick zum Tauchen bereit, auf die Kanonenboote. Mit Schnellfeuer schossen wir uns bald ein. Die Kanonenboote erwiderten keinen Schuss, ja ihre Besatzung stieg sogar in Feuerlee in die Boote und ruderte eiligst an Land. Treffer auf Treffer schlug drüben ein und was bei der leisen Bewegung des Bootes drüber wegging, das fiel von selbst an die rechte Stelle, in das Haus des englischen Konsuls, das pompös und repräsentativ den Hafen überragte. Der Engländer hat es ja von jeher verstanden, mit derartigen verhältnismäßig kleinen Mitteln großen Eindruck auf die Fremdvölker zu erzielen. Für uns war die Lage dieses Hauses eine moralische Beruhigung, denn Solum war nicht befestigt. Wir gingen dann noch näher heran und nach dreiviertel Stunden waren die Kanonenboote versackt.
Dann suchten wir die Trabakel, fanden aber statt ihrer nur einen Tankdampfer, den wir innerhalb zwei Stunden niedergekämpft hatten. Die Besatzung ging in die Boote. Die Leute des einen schickten wir an Bord zurück. Sie sollten das Geschützrohr abschrauben und uns bringen. Noch heute ist es mir rätselhaft, warum sie uns, die wir jetzt unmittelbar in ihrer Nähe lagen, nicht einfach unter Feuer nahmen. Unser Geschütz war freilich auf sie gerichtet. Sobald wir das Rohr, es war das erste durch ein U-Boot erbeutete, an Bord hatten, schossen wir auf den Dampfer. Mit jedem Treffer kam er aber höher heraus, statt tiefer zu gehen, denn das Heizöl lief in hellen Strömen aus den Schusslöchern und verbreitete sich auf dem Wasser. Bei jedem Schuss spritzte ein Springquell von Heizöl und Wasser hoch empor und ergoss sich über die Zuschauer bei uns an Deck. Auch die schöne neue Uniform unseres türkischen Majors wurde über und über mit dieser übelriechenden Tunke bespritzt, aber er ließ sich nicht stören, sondern machte eine Aufnahme nach der anderen. Mittags kenterte der Tankdampfer. Zwei weitere Dampfer versenkten wir bald danach. Am nächsten Morgen versenkten wir einen Pferdetransport. Das fiel uns nicht leicht, denn was hatten die armen Tiere uns getan? Nur der kalte Verstand zwang uns. Nachmittags setzte sich ein müdes Vögelchen an Deck nieder und ließ sich in seiner Ermattung ohne weiteres einfangen. Die ganze Besatzung bemühte sich um sein Wohl. Es war, als ob sie wieder gutmachen wollte, was Sie notgedrungen an der armen Kreatur, den Pferden, hatte verüben müssen.
Am nächsten Morgen flog der Vogel davon. Wir haben dann noch mehr Dampfer versenkt. Als wir einmal gerade einen Dampfer jagten, schossen zwei Fischdampfer auf uns. Ihr Feuer lag in bedenklicher Nähe dicht um uns herum. Obwohl wir jeden Augenblick einen Treffer bekommen konnten, wartete der Kommandant so lange mit dem Torpedoschuss, bis das letzte Beiboot abgelegt hatte und nicht mehr in Gefahr war, mit dem Torpedo in die Luft zu fliegen. Dann mussten wir tauchen. — Als wir nach 32 Tagen, trotz vieler Maschinenschäden, nach Cattaro zurückkehrten, hatten wir 59 000 Brutto-Registertonnen versenkt und unsere Aufgaben fast restlos gelöst. Die Trabakel hatten wir allerdings nicht gefunden. Sie sind niemals angekommen. Eins von ihnen lief eine Woche später wieder einen türkischen Hafen an, während das zweite in die Hände der Engländer fiel, ein Ausgang, der bei etwas mehr seemännischem Geschick unserer Bundesgenossen sicherlich zu vermeiden gewesen wäre.