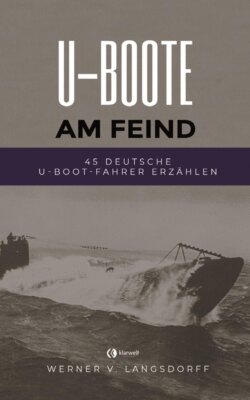Читать книгу U-Boote am Feind - Werner von Langsdorff - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aus 3 Jahren U-Boot-Krieg - Von Lothar v. Arnauld de la Periére
ОглавлениеVor dem Kriege Wachoffizier auf der „Emden“, war ich ausgerechnet bei Kriegsausbruch Adjutant des Admiralstabschefs, des Admirals v. Pohl. In einer Zeit, wo meine Alterskameraden auf Luftschiffen, Torpedobooten und U-Booten am Feinde waren, musste ich im Großen Hauptquartier hinter der Front sitzen, in einer zwar ehrenvollen, mich aber in keiner Weise befriedigenden Stellung. Heraus wollte ich da, und zwar bald, denn sonst kam man womöglich noch zu spät. Nach allem, was ich sah und hörte, hatten bei der Marine nur Luftschiffe und U-Boote Aussicht, an den Feind zu kommen. Ich meldete mich zu den Luftschiffern, wurde aber wegen Überfüllung nicht angenommen. Erst im Frühjahr 1915 gelang es mir, zur Unterseeboot-Waffe zu kommen. Bis zum Herbst dauerte die Ausbildung als Unterseeboot-Kommandant, und endlich wurde dann Ende 1915 ein Front-U-Boot für mich frei, und zwar U 35 im Mittelmeer. Ich übernahm U 35 von Korvettenkapitän Kophamel, der die Mittelmeerflottille führen sollte.
Da war noch einer bei uns, den litt es auch nicht im Hauptquartier. August Haiungs aus Dithmarschen. Groß, hager und sehnig. Viel Worte machte er nicht. Aber man wusste, was man an ihm hatte. Er quälte mich, ich solle ihn mitnehmen. Er ging als mein Bursche mit, sollte meine paar Sachen in Ordnung halten und spezialisierte sich auf das Entern der Schiffe. Wie kein anderer kletterte er an Bord, um die Ladungen festzustellen und die Sprengpatronen anzulegen. Er hat mich bis Kriegsende begleitet.
Meine erste Frontfahrt begann Anfang Januar 1916, in einer Zeit, wo der uneingeschränkte U-Boot-Krieg wegen der amerikanischen Proteste bereits wieder eingestellt worden war. Handelsschiffe durften nicht mehr ohne vorherige Warnung versenkt werden.
Als Operationsgebiet war mir das Seegebiet zwischen Malta und Kreta zugewiesen. „Versenken brauchen Sie nichts, die Hauptsache ist, dass Sie das Boot von Ihrer ersten Fahrt heil zurückbringen.“ Mit diesen Worten entließ mich unser Flottillenchef in Cattaro. —
Am 17. Januar 1916 hielt ich meinen ersten Dampfer, den Engländer „Sutherland“, an und versenkte ihn durch Geschützfeuer. Alles ging glatt und nun war der Bann gebrochen. Der nächste, der in Sicht kam, war ein bewaffneter Engländer, der auf unseren Warnungsschuss abdrehte und das Gefecht annahm. Während der Verfolgung erschien ein weiterer Dampfer, unter holländischer Flagge, der unseren Kurs schneiden musste. Mir blieb also nichts anderes übrig, als ihm einen Schuss vor den Bug zu setzen, und von dem anderen zunächst abzulassen. Auf das Signal „Boot schicken“ wurde ein Boot zu Wasser gelassen. 4000 Meter lagen zwischen uns und dem Dampfer; ehe das Boot herankam in der offenen See, konnte es Abend werden. Also musste ich heran. Eingedenk all der guten Lehren meiner Kameraden tat ich das sehr vorsichtig in getauchtem Zustand, das Sehrohr weit ausgefahren. Wir umkreisten den Dampfer in 100 Meter Entfernung. Nichts regte sich bei ihm an Bord. Am Bug stand der Name „Melanie“. Die Besatzung war in den beiden Schiffsbooten, die, wie üblich, 800 Meter hinter dem Heck lagen. sehr genau sahen wir uns den Dampfer an, durch das eine Sehrohr ich, durch das andere abwechselnd mein Wachoffizier Oberleutnant z. S. Steinbauer und mein Obersteuermann Neumann, die beide schon manche Fahrt hinter sich hatten. Wir waren uns einig: der war harmlos, wir können also zur Untersuchung auftauchen. Schon will ich die erforderlichen Befehle dazu geben, da habe ich ganz instinktiv eine Hemmung, mein Misstrauen ist wieder da. Wohl werde ich auftauchen, aber nicht hier, 100 Meter querab von dem Dampfer, sondern da hinten bei den beiden Schiffsbooten. Habe ich die beiden erst längsseits, kann er nicht schießen, ohne seine eigenen Leute zu gefährden. Ich fuhr also hin und gab Befehl zum Auftauchen und Besetzen der Kanone. Oben waren wir schon, noch 30 Meter von den Booten entfernt, die Geschützbedienung wollte gerade das Geschütz besetzen, als vom Dampfer her ein Höllenfeuer losbrach. Klappen fielen, hart über unseren Köpfen sausten die ersten Granaten, andere peitschten uns das Wasser an Deck, dazwischen rasendes Maschinengewehrfeuer.
„Fluten“, „Schnelltauchen“, „rein mit der Geschützbedienung“! Hinter mir polterten die braven Geschützleute durchs Turmluk, einer riss es zu. Schon wollte ich auf Tiefe gehen, da schrie einer von den Leuten: „Leutnant Lauenburg ist nicht unten!“ Unseren Wachoffizier konnte ich doch nicht ertrinken lassen, also nochmal hoch, Turmluk auf und schon kam er mit einem ordentlichen Schuss Wasser herunter. Nun aber weg! Wir sackten gleich weg bis auf 50 Meter. Das war noch mal klar gegangen! Warum? Es ist nur so zu erklären, dass der Engländer sein Feuer einstellen musste, weil wir in der hilflosen Situation, nämlich beim Schnelltauchen, uns gerade zwischen den englischen Schiffsbooten befanden.
Unser zweimaliger Versuch, einen Torpedo anzubringen, misslang, weil der Engländer, nunmehr gewarnt, den Torpedo ausmanövrieren konnte.
„Trotz aller Anstrengungen wurde ‚unglücklicherweise‘ das U-Boot nicht versenkt“, sagt mein damaliger Gegner, der Kommandant des Q-Schiffs „Margit“, einer englischen U-Boot-Falle, lieutenant commander G. L. Hodson in seinem Bericht. „Glücklicherweise wurden wir nicht versenkt“, konnte ich melden. Ein Gutes hatte dieser Vorfall für uns, es war eine heilsame Lehre, die uns der Feind gegeben hatte. Ausgestattet mit einem unfehlbaren „Riecher“, sind wir von nun an rangegangen und haben Dampfer auf Dampfer sinken lassen. Es war meine erste und wertvollste Kriegserfahrung, die konnte man durch keine Theorie, nur durch die Praxis gewinnen. —
Einer der zähesten Leute, mit denen ich aneinandergeriet, war der Kommandant des englischen U-Boot-Jägers „Primula“. Es war ein völlig neuer Schiffstyp, der mit der „Primula“ im Mittelmeer auftauchte, dazu bestimmt, die „U-Boot-Pest“ auszurotten. Sah aus wie ein Kreuzer, war gut armiert, hatte Wasserbomben, dazu wenig Tiefgang, damit man sie unterschießen sollte, außerdem gute Unterwassereinteilung. Sie konnte schon manches Torpedo vertragen. Aber das alles wussten wir nicht, als wir mit ihr anbanden. Mein erster Torpedo traf sie im Vorschiff, so dass der Vormast nach vorn umkippte. Da sie nicht mehr vorwärtsfahren konnte, fuhr sie mit äußerster Kraft rückwärts, um uns zu rammen, so dass wir schleunigst verschwinden mussten. Dabei schoss Sie wie wild, wenn ich mein Sehrohr zeigte — und das musste ich schon, denn so schnell durfte ich den Kampf nicht aufgeben. Was man angefangen hat, muss man auch zu Ende führen! Ich griff an und schoss zum zweiten Mal, traf aber nicht, denn mein Gegner manövrierte den Torpedo geschickt aus. Genau so ging es mir mit dem dritten Torpedo. Ich hatte mich aber so verbissen, dass ich niemals aufgegeben hätte. Schweren Herzens opferte ich einen vierten Torpedo, der endlich (der Kampf hatte vier Stunden gedauert) die „Primula“ im Achterschiff traf und sie manövrierunfähig machte. Jetzt hatte sie genug, das sah ich, so dass ich beruhigt davonfahren konnte. Aus den Zeitungen ersahen wir, dass nach weiteren drei Stunden das Schiff gesunken und dass seine Besatzung gerettet worden war. —
Nicht gerade angenehm war immer der Durchbruch durch die Straße von Gibraltar, aber er musste gewagt werden, um den atlantischen Handel zu fassen. Auf dem Gibraltarfelsen standen starke Scheinwerfer, die dauernd die Enge nach U-Booten absuchten, dazu kamen dann U-Boot-Jäger und Zerstörer, welche uns jagen und zum Tauchen zwingen sollten. Saß man erst unter Wasser, dann kam man mit der geringen Geschwindigkeit gegen den Stetig von draußen nach innen setzenden starken Strom nicht an, außerdem wusste man nicht, was der Feind unter Wasser für Schweinereien vorbereitet hatte. Deshalb ging ich nachts immer über Wasser durch und nahm die ekelhaft hellen Scheinwerfer in Kauf. Wenn nicht gerade ein Zerstörer in der Nähe war, war es ja nicht schlimm. Am besten ging es noch hart unter der afrikanischen Küste: einmal war der Strom nicht so stark, außerdem hatte man von dort nach der Straße hin gegen die hellen Scheinwerfer einen guten Überblick.
So hatte ich wieder einmal den Vorstoß nach dem Atlantik beschlossen, weil das westliche Mittelmeer abgegrast war und da, wo ich war, niemand mehr fuhr. Fünf englische Dampferkapitäne führte ich als Gefangene mit, sie sollten später in Cattaro abgegeben werden. Ihr Schicksal war mit dem unsrigen verknüpft. Ihr Leben hing davon ab, wie ich mein Boot führte. Kein Wunder, dass wir einander näherkamen. Während sie sonst viel Bridge spielten, wurden sie unruhig, als es durch die Straße ging, denn sie mussten ja die Gefahren kennen, vielleicht besser als ich. — Die Sonne war hinter dem vorspringenden Felsen von Gibraltar versunken, als wir uns bei Ceuta unter die afrikanische Küste klemmten. Nach der Straße zu war es klar und übersichtlich, was aber links von uns unter den drohenden dunklen Küstenbergen verborgen lag, konnten wir nicht sehen. Die Wache vor mir auf dem Turm war besetzt mit den besten Augen, die wir hatten: rechts vor mir der ältere Wachoffizier, Oberleutnant z. S. Loycke, links die seemännische Nr. 2, Bootsmannsmaat Timm. Hinter mir zwei weitere Seeleute. Die gesamte Besatzung auf Gefechtsstation, bereit, jedes Kommando ohne Zögern auszuführen. Die Motoren, liebevoll betreut durch den Leitenden Ingenieur, gaben ihr Äußerstes her und machten in der ruhigen Nacht einen Höllenlärm.
„Zerstörer zwo Strich an Backbord, ganz nahe bei!“ schreit Timm. Und schon braust der schwarze Schatten heran, es sieht aus, als ob er uns rammen will, und dann zieht er sich etwa 50 Meter vor unserem Bug vorbei. Wie ein riesiges Gespenst. So nahe, dass wir seine Ventilationsmaschine, ja sogar englische Kommandoworte hörten. Uns blieb die Spucke weg. Die Hauptgefahr war nun vorüber, also blieb ich oben und tauchte nicht. Offenbar hatte der Zerstörer unter der Küste auf der Lauer gelegen, uns vielleicht kurz im Scheinwerferlicht gesehen, sicherlich aber unsere Motoren gehört und hatte uns dann im Rammangriff verfehlt. Jetzt hob er sich klar gegen die Straße ab, so dass wir ihn gut sehen konnten, wie er suchend umherraste. Als ich mich umdrehte, sah ich an Backbordseite gegen die dunkle Küste ein zweites Fahrzeug, das anscheinend dem Zerstörer unseren Aufenthalt signalisierte, aber wohl zu Anker lag, denn es kam nicht und begnügte sich damit, uns mit seinem Scheinwerfer zu beleuchten, dem wir aber leicht ausweichen konnten. Als der Morgen graute, lag die Gibraltarstraße hinter uns, der Atlantische Ozean nahm uns auf, wo wir gute Beute machten. —
Es war ein Sonntagnachmittag. Wir befanden uns auf dem Rückmarsch und standen bei schönem Wetter südlich Sardinien. Gerade wollten wir uns im Bugraum zu einem Sonntagskaffee niedersetzen, den unser tüchtiger „Schmut“ Bölts aus erbeuteten guten Bohnen gebraut hatte, als mir ein großer Dampfer mit drei Schornsteinen gemeldet wurde. Er kam sehr schnell heraus, musste also hohe Geschwindigkeit laufen. Zickzackkurse lief er auch, hatte aber keine Sicherung dabei. Getaucht machte ich seine Bewegungen mit, hatte aber Trefferaussichten nur dann, wenn er in meiner Nähe vorbeikam. — Der Angriff war insofern schwierig, als wir nur noch einen Torpedo hatten, und zwar ausgerechnet im Heckrohr. Wir mussten schon viel Glück haben, wenn wir ihn anbringen konnten. Der Kasten kam rasch näher, er war grau gemalt, war ein Passagierdampfer mit großen Promenadendecks. Und die durften wir ja nicht abschießen, es konnte ja vielleicht ein Amerikaner an Bord sein. Auf jeden Fall führte ich den Angriff durch, die letzte Entscheidung, ob schießen oder nicht, wollte ich von meinem letzten Eindruck abhängig machen. Schon glaubte ich, es würde nichts werden mit dem Schuss, da ich bei seinen Zickzackkursen nicht in Schussstellung kam. Da plötzlich drehte er in unsere Nähe. Allerdings auf normalem Wege war der Torpedo nicht anzubringen, nur noch als Winkelschuss, d. h. er musste nach dem Ausstoßen entsprechend dem vorher eingestellten Winkel drehen und seinem Ziel zu jagen.
Alles ging nun sehr schnell. Letzter Eindruck war: doch Truppentransporter, obwohl keine Truppen an Deck zu sehen waren. Es war wieder Instinkt. Auf 900 Meter Abstand kam er vorbei. Zielen war schwierig. „Torpedo los!“ Das Boot vibriert beim Ausstoß. Ich beobachte. Der Torpedo macht vorschriftsmäßig seine Drehung und läuft in Richtung auf den Dampfer. Unten zählt einer die Sekunden mit. Im Boot kann man eine Stecknadel fallen hören. Es ist enttäuschend, wenn der Mann da immer weiterzählt und nichts erfolgt. Hier aber nach 40 Sekunden ein scharfer metallischer Schlag — die Gefechtspistole — dann das Krachen der Detonation. Ein schallendes „Hurra!“ tönt von unten herauf. Durch das Sehrohr sehe ich eine hohe Sprengwolke stehen, erst 10 dann 50 Meter hinter dem Heck, so dass ich einen Augenblick glaube, der Feind habe eine Wasserbombe geworfen. So schnell fuhr das Schiff. Erst allmählich verliert es seine Geschwindigkeit und fängt ganz langsam an, achtem tiefer zu tauchen. Ich kann noch immer nicht glauben, dass dieses Riesenschiff mit einem Torpedo genug haben sollte.
Nun entsteht an Deck des Schiffes ein furchtbares Durcheinander. Massen von Menschen quellen an Oberdeck, ein Teil versucht noch in letzter Pflichterfüllung Geschütze klarzumachen, viele stürzen in die zahlreichen Boote. Diese werden überhastet heruntergeworfen, so dass sie falsch ins Wasser kommen und vollschlagen. An den Bootstaljen hängen die Menschen. Jeder will zuerst ins Boot. Es war grausig anzusehen. Ich hatte genug, ließ einzeln meine Leute in den Turm kommen und einen Blick durchs Sehrohr werfen. Einige starren unbeweglich, auf anderen Gesichtern malt sich Entsetzen. Neugierig und hastig kamen sie nach oben, nachdenklich und ernst nahm jeder wieder seinen Platz ein.
Immer tiefer sank hinten das mächtige Schiff, bis es, sich gegen den glutroten Abendhimmel abhebend, senkrecht den glänzenden Bug gegen den Himmel aufrichtete, vielleicht 1—2 Minuten so stand, um dann kerzengerade in die Tiefe zu schießen. Ein großartiges und grausiges Bild, das ich lange nicht loswerden konnte. 20 Minuten nach dem Torpedoschuss war nichts mehr übrig als ein Trümmerfeld mit einer Anzahl überfüllter Rettungsboote, zu deren Rettung ich nichts tun konnte. Wir fuhren auf 30 Meter Wassertiefe davon, jeder seinen Gedanken nachhängend.
Als wir in den nächsten Tagen einliefen, hörten wir Näheres. Es war die „Gallia“, der größte französische Truppentransporter, mit höheren Stäben und Truppen für die Saloniki-Front unterwegs. 1852 Mann verloren. „Frankreichs größte Schiffskatastrophe seit Kriegsbeginn“, schrieben die französischen Zeitungen. Eine Schlacht gegen Frankreich war gewonnen. Erst jetzt gewann die Freude über unseren Erfolg die Oberhand. — Besonders stolz war der Obersteuermann Neumann mit seiner Wache, welche das Schiff zuerst gesehen hatte und daher den Erfolg für sich buchen konnte. Denn es herrschte ein reger Wettbewerb zwischen den drei Wachen, die eifrig Buch über die Schiffe führten, deren Sichtung zur Versenkung führte.
Eines Tages wurde ich, während mein Boot noch in Reparatur lag, nach Berlin berufen und erhielt einen außergewöhnlichen Auftrag: U 35 sollte ins westliche Mittelmeer gehen und in Cartagena einlaufen mit einem kaiserlichen Handschreiben an den König von Spanien als Dank für die gute Behandlung der in Fernando Po internierten Kamerunkämpfer und mit 35 Kisten Chinin und anderen hochwertigen Medikamenten für diese. Auf anderem Wege war es nicht möglich, den Kamerunkämpfern Hilfe zukommen zu lassen. Auch sollte erprobt werden, wie sich die Alliierten einem neutralen Land gegenüber verhalten würden, wenn dieses einem der damaligen Weltmeinung nach außerhalb jeden Völkerrechtes stehenden U-Boot den normalen völkerrechtlichen Schutz gewähren würde. Selbstverständlich sollte ich keinesfalls die international vorgeschriebene Aufenthaltsdauer von 24 Stunden überschreiten. Größte Vorsicht beim Ein- und Auslaufen war mir anempfohlen. Im Hafen sollte ich auf Sabotageakte der feindlichen Spionage gefasst fein.
Auf dem Hinweg wurde noch recht gute Beute gemacht. Einen Tag vor dem vorgesehenen Einlaufstermin hörten wir auf mit Kriegführen und brachten das Boot, so gut es ging, in einen besuchsmäßigen Friedenszustand. Es war ein eigentümliches Gefühl, als wir für einen Tag das raue Kriegshandwerk niederlegten und uns zu einer reinen Friedenmission mitten im Kriege anschickten. — Der spanische Hafenlotse war etwas erstaunt, als U 35 bei Hellwerden am 21. Juni 1916 überraschend zwischen den Molenköpfen des Hafens auftauchte und in den Hafen von Cartagena hineindrehte, um gleich längsseits des dort festliegenden deutschen Dampfers „Roma“ anzulegen. Feindliche Kriegsschiffe waren nicht im Hafen. Eine Sorge war mir damit genommen. — Als um 8 Uhr unser Landessalut von 21 Schuss über den Hafen rollte — der erste und einzige, den je ein U-Boot geschossen hat —, waren die Medizinkisten bereits unauffällig an die „Roma“ abgegeben und unser Marineattaché aus Madrid nach Cartagena unterwegs, um das Handschreiben in Empfang zu nehmen. Schnell waren die offiziellen Besuche bei den örtlichen Würdenträgern abgewickelt, die je nach ihrer persönlichen Einstellung herzlich oder kühl verliefen. Unser deutscher Konsul Dr. Tell begleitete mich. Er hat es mir nicht übelgenommen, dass ich beim Mittagessen in seinem Hause völlig übermüdet einfach einschlief.
Das spanische Volk war voll herzlicher Freundschaft für Deutschland. Bis in die tiefe Nacht umsäumten Menschenmassen den Hafen, um U 35 zu sehen. Mit Genehmigung der Behörden hatte ich mich dann längsseits des spanischen Kreuzers „Cataluna“ gelegt, wo ich vor Sabotageakten sicher war. Bei der reichen Gastfreundschaft, die uns geboten wurde, musste ich den wenigen Deutschen, aber auch den vielen spanischen Offizieren die Besichtigung des Bootes gestatten, wobei scharfe Kontrolle und strenge Absperrung gegen Annäherung unbekannter Boote durchgeführt wurde. Mit Gastgeschenken wurde die Besatzung überschüttet. Um 2 Uhr morgens nach 22stündigem Aufenthalt warf U 35 los und verließ unter brausenden Hochrufen der spanischen Matrosen und den Sympathiekundgebungen der noch immer ausharrenden Menge den Hafen. — Da man draußen das Leuchten vieler Scheinwerfer sah, wurde jetzt ein spannender Kampf erwartet. Außerhalb der Molenköpfe ließ ich die Lichter abstellen und ging unter Wasser, um uns nach dem Trubel dieses anstrengenden Tages erst mal etwas Ruhe zu gönnen. Und da unsere Feinde allerhand aufgeboten hatten, um uns vor dem Hafen abzufangen, gelang es uns erst am Spätnachmittag, wieder aufzutauchen, um den Rückmarsch anzutreten. —
Neben dem grimmigen Ernst des Krieges erlebten wir aber auch manche launige Abwechslung. Zur Aufbesserung unserer Stimmung war das verdammt notwendig. Einfach unbezahlbar für diesen Zweck war unser Bordaffe Fips, zur Gattung der Meerkatzen gehörig. Wir holten ihn im letzten Augenblick vom verlassenen Abendbrottisch eines sinkenden Dampfers, dessen Besatzung längst das Weite gesucht hatte. „Obermüller, gehen Sie nochmal an Bord und retten Sie den Affen“, rief ich dem Wachoffizier zu. Der Affe wollte aber gar nicht weg von seinem leckeren Mahl. Das Klettern auf der Jakobsleiter die senkrechte Bordwand herab schien ihm gar nicht zu gefallen. Und so biss er den armen Obermüller, der ihn hinter sich herzog, dauernd in die Hand, bis dieser ihn, unten im Dingi angekommen, mal kräftig ins blaue Meer tunkte, was sichtlich beruhigend auf Fips wirkte.
Schnell wurde Fips wegen seiner lustigen Streiche und seiner Anhänglichkeit der Liebling an Bord. Als Quartier wurde ihm der Hecktorpedoraum angewiesen, da war er ganz in der Nähe des Küchenchefs Bölts, dem er manches für Spiegeleier bestimmte Ei aus der Hand stahl. — Seitdem Fips an Bord war, war immer etwas los. Mit Vorliebe beehrte er auch meinen Raum mit seinem Besuch, fraß meine Bleistifte, zerriss meine Funkmeldungen und trank ab und zu das Tintenfass leer. Selbst die Wache an Deck ging er oft mit, und zwar in der Seitentasche von Obermüllers ledernem Wachjackett, aus der sein Köpfchen possierlich herausschaute. Böse Zungen behaupteten, dass es in dieser molligen Tasche auch ab und zu feucht gewesen sein soll.
Mit unserem „Funkenpuster“, dem Oberfunkgast Weichler, lebte er auf Kriegsfuß. Fips soll nämlich, und zwar in der ersten Nacht, noch nicht ganz vertraut mit den an Bord herrschenden Manieren, auf seiner Torpedolaufschiene genau über Weichlers Kopf sitzend, diesen längere Zeit in andächtiger Bewunderung beobachtet haben. Dann soll ihn, sagt die Fama, angeregt durch das den ganzen Raum erfüllende Schnarchen des Schläfers, eine menschliche Rührung überkommen haben, wofür wiederum Weichler keinerlei Verständnis aufzubringen vermochte. Jedenfalls gab es einen Mordskrach, wobei Fips den Kürzeren zog, was er dem Weichler niemals vergessen hat.
Bei schönem Wetter turnte Fips an Oberdeck herum, wo er seine sonnigen Schlupfwinkel hatte. Oft fürchteten wir, er würde glatt versaufen, wenn wir Hals über Kopf tauchen mussten. Aber er war so mit dem U-Boot-Dienst verwachsen, dass er, wenn die Luft aus den Schnellentlüftungen rauschte, mit einem Satz im Turmluk war und nach unten verschwand. Nachts schlief er meist auf der Alarmkoje bei unserem Leitenden Ingenieur, Marine-Oberingenieur Fechter, mit dem er besonders befreundet war.
Fast ein Jahr fuhr Fips auf U 35. Als er dann Husten bekam, brachte Haiungs ihn in den Berliner Zoo. Dort habe ich ihn nach dem Kriege mal besucht, ohne dass Fips seiner Freude darüber sichtbaren Ausdruck verlieh. Er war inzwischen Großmutter geworden, sagte der Wächter. —
Zwei Jahre, von Ende Januar 1916 bis März 1918, führte ich mit U 35 Krieg im Mittelmeer. Offiziere, Deck- und Unteroffiziere wechselten stark, weil immer mehr U-Boote gebaut wurden. Der übrige Teil der Besatzung blieb im Wesentlichen zusammen. Wir dachten nur noch in Tonnen. Im Lloyds-Register (Verzeichnis aller Handelsflotten) waren wir zu Hause. Zwar wären uns Kriegsschiffe lieber gewesen. Sie fuhren aber spärlich. Und es war besonderes Glück, wenn man auf eins stieß. Unendlich viel wichtiger für den Kriegserfolg war aber die Vernichtung der für den Feind fahrenden Tonnage. Das war uns allen klar. „Immer runter von der See!“ war die Losung. Rastlos durchsuchten wir alle Winkel des Mittelmeers. Spürten das Wild auf, wo es sich auch versteckte. Dehnten unsere Fahrten aus bis in den Atlantik. Passten unsere Kampfmethoden denen des Feindes an. Fuhr er einzeln auf bestimmten, überwachten Routen, so jagten wir ihn dort, bis er diese wechselte. Fuhr er im Geleitzug, so hingen wir tagelang daran, bis er zersprengt war. Steuerte er tagsüber in neutralen Gewässer, so wurde er nachts außerhalb derselben überfallen.
Einmal versenkten wir auf einer Reise von vier Wochen 56 Schiffe mit 90000 Tonnen. Nicht einen Torpedo, keine Granate, auch nicht eine Sprengpatrone hatten wir noch an Bord. Und so blufften wir noch einen Dampfer mit ein paar auf Cartagena übriggebliebenen Salutpatronen, die nur knallten, und versenkten ihn durch öffnen der Ventile. Kein Wunder, dass wir uns nach neunmonatiger Kriegführung hinsichtlich der Versenkungsziffer bis an die dritte Stelle hochgearbeitet hatten, um sehr bald darauf an erster Stelle zu führen. An Auszeichnungen war vergeben, was zu vergeben war. Da wurden Anfang 1918 die neuen U-Kreuzer fertig, die den Krieg an die amerikanische Küste tragen sollten. Dort reizte eine neue Aufgabe. Im Mai 1918 ernannte mich mein Oberster Kriegsherr durch persönliches Handschreiben zum Kommandanten des U-Kreuzers U 139, der den Namen meines gefallenen Freundes und Kameraden „Kapitänleutnant Schwieger“ führen sollte. Und so schloss ich meine Tätigkeit auf U 35 im März 1918 ab mit einer Strecke von 200 Schiffen mit einem Tonnengehalt von 500000 Tonnen, die größtenteils namentlich festgelegt waren. Das schlimmste stand mir aber noch bevor: das war die Trennung von meinem braven Boot und von einem Teil meiner Männer. Wir sahen ein, dass einige zurückbleiben mussten, um U 35 aktionsfähig zu halten. Die Hälfte meiner Besatzung durfte ich mitnehmen. Niemals werde ich diesen Abschied am 17. März 1918 vergessen. Viel Worte wurden nicht gewechselt, aber manchem von uns harten Seeleuten wurde das Auge nass.
U 139 war kein Boot mehr, sondern ein richtiges Unterwasserschiff von mehr als 2000 Tonnen Wasserverdrängung mit 8 Offizieren, 100 Mann Besatzung, zwei 15-Zentimeter-Kanonen, 1000 Granaten und 20 Torpedos. Vier Monate konnte es in See bleiben, ohne Brennstoff und Vorräte auffüllen zu müssen. Nach dreiwöchiger stürmischer Ausreise standen wir am 1. Oktober 1918 in der Biskaya, um dort ein Abenteuer zu erleben, wie wir es noch nie erfahren hatten. Wir hatten einen Geleitzug von 10 Dampfern erwischt, der von zwei Hilfskreuzern und einem Schwarm von kleinen Bewachern geschützt wurde. Da mein schweres Schiff unter Wasser nicht so schnell manövrierte, wie der Geleitzug zickzackte, saß ich plötzlich mitten im Geleitzug und mein Torpedo ging vorbei. Dies war misslungen. Wozu aber hatte ich schließlich meine großen Kanonen? Also wollte ich es über Wasser nochmal versuchen. Der Geleitzug fuhr über mich weg. Als er 5000 Meter ab war, tauchten wir auf, und zum ersten Mal sausten unsere schweren Brocken dem Feind entgegen. Nun ging aber auch bei ihm ein Höllenfeuer los. Aus allen Knopflöchern ballerten sie. Um uns herum stiegen die Wassersäulen hoch. Gottlob, ohne zu treffen. Nun brauste aber auch schon der Führerkreuzer heran, so dass ich von den Dampfern ablassen und mich auf ihn konzentrieren musste. Er hatte uns bald eingedeckt. Ich erwischte noch den richtigen Augenblick zum Tauchmanöver. Kaum war das Wasser über dem Turm zusammengeschlagen, ein Knall. Die letzte Salve des Hilfskreuzers war am Turm eingeschlagen. Kraftlos klatschten die Granatsplitter gegen den Turm. Das war noch einmal gut gegangen. Über die paar Wasserbomben, die folgten, lachten wir. Die Hauptsache war, er ließ von uns ab und folgte seinem entschwindenden Geleitzug. Mein Entschluss stand fest. Nachgeben jetzt? Kommt nicht in Frage. Also zum dritten Mal angreifen, diesmal aber gut vorbereitet mit gut angewärmten Dieselmotoren, um unsere Geschwindigkeit mit in die Waagschale zu werfen.
Es war Mittagszeit. Der Besatzung erst mal etwas in den Magen. Inzwischen Stand der Geleitzug an der Kimm. Dann hoch und mit äußerster Kraft hinterher. Hand über Hand holten wir auf. Der Geleitzug sieht uns wohl kommen, er läuft auch, was er kann, und zieht sich breit auseinander. Alles steht bei uns klar zum Feuern, 40 Mann sind allein auf Gefechtsstationen an Oberdeck, die alle herunter müssen, wenn der Feind uns zum Tauchen zwingt. Auf meinen Befehl „Feuererlaubnis“ knöpft sich der Artillerieoffizier Kapitänleutnant Pistor den nächsten Dampfer vor. Nach wenigen Schüssen Treffer und schon dreht er, anscheinend manövrierunfähig, bei, setzt Boote aus, ein Zeichen, dass er aufgibt. „Zielwechsel!“ auf den nächsten. Auch da dauert es nicht lange, da sackt er achteraus. Das wäre so weitergegangen, wenn nicht wieder der Hilfskreuzer mich in ein Feuergefecht verwickelt hätte, wobei er einige Treffer abbekam, ich aber doch auf die Dauer den Kürzeren zog. Ich musste also wieder verschwinden. Er verzichtete zunächst auf weitere Verfolgung. Er musste wohl zur Unterstützung der beiden havarierten Schiffe. Ich folgte, durchs Sehrohr die Vorgänge beobachtend. Denn eines stand für mich fest: hier muss ganze Arbeit geleistet werden. Keinesfalls durften die beiden Brüder etwa eingeschleppt werden. Der Sorge um den einen war ich bald enthoben, er sank während meiner Annäherung. Der andere lag mit leichter Schlagseite auf dem Wasser. Von der französischen Küste war Hilfe gekommen. Jedenfalls schwirrte ein Schwärm U-Boot-Jäger wie Hornissen um ihn herum, um mir einen Angriff unmöglich zu machen.
Seit 10 Uhr waren wir in Tätigkeit. Jetzt fing es an zu dunkeln. Gelang es mir jetzt nicht dem Havaristen einen Fangschuss zu verabfolgen, würde er in der Nacht mit Sicherheit eingeschleppt. Und so fuhr ich wohl meine 4—5 Anläufe. Immer, wenn ich gerade in Schussentfernung war, sauste so ein Biest von U-Boot-Jäger über uns weg und ich musste nach unten ausweichen. Inzwischen war es völlig dunkel geworden. — Die Männer der Freiwache saßen beim Abendessen. Beteiligt war ja nur die Wache des Maschinenpersonals, des Torpedopersonals, das Personal der Tiefensteuerung und bei mir im Turm mein tüchtiger Obersteuermann, der Gefechtsrudergänger Obermatrose Otto und der Maschinentelegraphposten Ob. F. T.-Gast Plate.
Und so kam der letzte Anlauf. Schraubengeräusche nähern sich. Tiefer gehen. Wieder hoch. Vor mir die schwarze Wand des Dampfers. „Erstes Bugrohr los!“ Und der Torpedo braust ab. Ich lasse beschleunigt auf Tiefe steuern und sage noch nach unten in die Zentrale: „Etwas nahe dran. Hoffentlich fällt er nicht auf uns drauf.“ Da ertönte die wohlbekannte Detonation und von unten ein Hurra, das in einem fürchterlichen Krachen und Bersten über mir erstickt. Die Sehrohre schlottern durcheinander. Das Licht erlischt. Gleichzeitig legt sich der Kasten schwer nach Backbord über, Wassermassen stürzen über uns in den Turm, und nur langsam richtet er sich wieder auf. Und dazwischen hinein hört man um uns herum das Krachen der Wasserbomben.
Das eben torpedierte Schiff muss im Sinken auf uns gefallen fein, ist mein erster Gedanke. Da ein so schnelles Sinken eigentlich selten vorkommt, muss der Dampfer durch Granatlöcher schon viel Wasser gesogen haben.
Das Licht geht wieder an. Die Pumpen werden angestellt. Der Zeiger des Tiefenmanometers wandert unablässig tiefer. Immer stärker wird der Wasserschwall, der durch die Lecks in der Turmdecke und durch das aufgesprungene Turmluk auf uns herabstürzt. Der Wasserspiegel im Sehrohrschacht steigt langsam höher. „Die Pumpen schaffen das Wasser nicht mehr“, meldet der „Leitende“, Marine-Oberingenieur Fechter, aus der Zentrale. Also sinken wir. Der absackende Dampfer reißt uns mit in die Tiefe! Bei 1000 Meter Wassertiefe keine angenehme Aussicht! Die Haare standen mir zu Berge bei diesen Gedanken. Bleibt nur die andere Möglichkeit, unser letztes Mittel: mit Pressluft nach oben und unser Leben so teuer wie möglich verkaufen. Bestenfalls winkt einem Teil meiner Männer die Gefangenschaft. Aber das Hirn arbeitet fieberhaft an einem anderen Ausweg. Einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer habe ich doch noch. „Der Leitende Ingenieur in den Turm.“ — „Wir werden mit Pressluft das Schiff an die Oberfläche bringen. Gelingt dies, so werden wir sofort wieder tauchen, aber nur so tief gehen, dass nur wenige Zentimeter Wasser über der Turmdecke find. Und dann will ich versuchen, mich so aus dem Schlamassel herauszuziehen.“ Es folgen die Kommandos: „Pressluft auf alle Tanks!“ — „Beide Maschinen alle Fahrt voraus!“ — „Auftauchen!“
Meine Augen saugen sich am Tiefenmanometer fest. Wird das Schiff gehorchen? Werden diese letzten Mittel wirken? Einige bange Sekunden folgen, jetzt steht der Manometerzeiger auf 40 Meter, dann hebt sich über unseren Köpfen ein fürchterliches Rucken, Reißen, Schleifen, Schurren an, als ob etwas von unserem Turm abgleitet. Unser Schiff legt sich einen Augenblick nach Steuerbord über. Und plötzlich steigen wir hoch wie ein Ballon. Der Wassereinbruch ließ langsam nach. Man konnte aufatmen, wenn auch um uns herum noch Wasserbomben krachten. Jetzt durchstießen wir die Oberfläche, nun Schleunigst wieder herunter, unser Schiff abfangen, Schnellentlüftungen auf. — Auf 10 Meter gehen! — Endlich konnten die Pumpen das eindringende Wasser halten. Die Sehrohre hingen durcheinander, waren unbrauchbar. Wir waren blind. — Eben unter der Wasseroberfläche schlichen wir von dannen, jeden Augenblick gewärtig von einem der herumtosenden Wachfahrzeuge über den Haufen gerannt zu werden. Langsam verstrich Minute um Minute. Die Detonationen der Wasserbomben wurden immer schwächer und hörten schließlich ganz auf. Nach einer Stunde tauchten wir auf. Tiefe Nacht umfing uns, Gott sei Dank! Nichts war zu sehen, nur im Süden, da wo wir herkamen, fingerten einige Scheinwerfer durch die Nacht.
Jetzt konnten wir unser Schiffchen etwas näher besehen. Die Brückenaufbauten waren zertrümmert, die Einbeulung des Dampferbugs genau erkennbar. Das Oberdeck verbeult. Das Turmluk verbogen, ließ sich nicht öffnen, und das Schlimmste: alle drei Sehrohre waren umgebogen und hingen herunter wie abgebrochene Spargel. Das ganze Oberdeck war übersät mit Granatsplittern und Schrapnellkugeln. — Vor mir stand die bange Frage: wie sollte ich unseren U-Kreuzer mit seinen braven Männern in diesem Zustand heil nach Hause bringen? Würden wir je wieder herauskommen an den Feind bei der gegenwärtigen Kriegslage? Wir alle mussten erst mal schlafen jetzt. Die bis zum Zerreißen angespannten Nerven mussten sich erholen. Dann wollte ich weiter sehen.
Der nächste Tag sah schon freundlicher aus. Er brachte uns gleich morgens einen kleinen Segler, auf dem wir zweierlei fanden: einen für Cardiff bestimmten ausgezeichneten Portwein als Nervenstärkung und ein Fass Zement. Mit letzterem gelang es dem Leitenden Ingenieur Fechter mit seinem braven Maschinenpersonal alle Risse und Lecks in der Turmdecke pottdicht zu betonieren, so dass wir wenigstens wieder ohne Lebensgefahr tauchen konnten. Blind blieben wir allerdings unter Wasser.
Kein Mensch dachte mehr an Heimreise. Wenn wir eben unter Wasser nicht mehr kämpfen konnten, dann wollten wir wenigstens über Wasser unsere 1000 Granaten an den Mann bringen und herunterholen, was herunterzuholen war. Unser Lebensmut war ungebrochen. Wenn nur nicht die trostlosen Funknachrichten aus der Heimat gewesen wären, um die unsere Gedanken kreisten!
Bei den Azoren hatten wir noch ein heißes Gefecht. Wir jagten einen großen Dampfer, der aber schneller war und uns entkam. Dafür griff uns sein Begleiter, ein kleines portugiesisches Kanonenboot an, das uns artilleristisch weit unterlegen war. Trotzdem focht es mit beispielloser Tapferkeit, ohne sein Schicksal abwenden zu können. Die Hälfte der etwa 40 Mann starken Besatzung mit dem Kommandanten war gefallen. Die Überlebenden nahmen wir auf, verbanden sie und sorgten für ihre ungehinderte Heimkehr. Dem verwundeten ersten Offizier konnte ich nur meine Hochachtung vor ihrem heldenhaften Kampf aussprechen.
Das war unser letzter Kampf. Am 21. Oktober kam funkentelegraphisch die Nachricht von der Einstellung des U-Boot-Krieges. Schweigend mussten wir die Waffe aus der Hand legen. Gern gingen wir nicht nach Hause. In Kiel wehten die roten Lappen der Revolte, als wir am 14. November 1918 einliefen. Das war das bittere Ende.