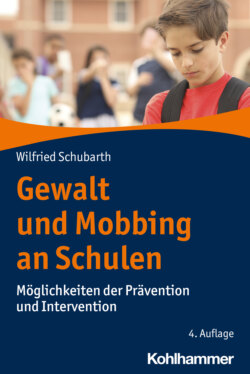Читать книгу Gewalt und Mobbing an Schulen - Wilfried Schubarth - Страница 11
b) Welche Rolle spielen Cybermobbing und Hate Speech?
ОглавлениеWenn man über Gewalt an Schulen spricht, kommt man an der gewachsenen Bedeutung der Sozialen Medien nicht vorbei. Kinder und Jugendliche wachsen heute ganz selbstverständlich mit den Neuen Medien auf, sind somit »Digital Natives«. Die Digitalisierung der Kindheit schreitet immer weiter voran. Bereits die Hälfte der Neunjährigen besitzt ein Handy, mit 13 Jahren sind es über 90 %. Besonders Whats App ist den Kindern sehr wichtig (Kinder-Medien-Studie 2018). Die neuen Medien bringen viele Chancen, aber auch neue Risiken mit sich.
Laut JIM-Studie von 2017 bestätigt jeder fünfte Jugendliche (12–19 Jahre), dass über ihn schon einmal falsche oder beleidigende Inhalte im Netz oder über das Handy verbreitet wurden. 8 % wurden im Internet schon einmal fertig gemacht, Jungen wie Mädchen gleichermaßen. 11 % der 6–13-Jährigen habe nach der KIM-Studie 2016 im Internet schon Dinge gesehen, die ihrer Meinung nach nicht für Kinder geeignet waren.
Eine Studie des »Bündnisses gegen Cybermobbing« (2017) ergab, dass 13 % der Schülerinnen und Schüler bereits von Cybermobbing betroffen waren, vor allem durch Beschimpfungen und Beleidigungen. Ca. 13 % waren auch Täter von Cybermobbing-Attacken, wobei Täter- und Opferrollen zum Teil fließend sind. Die parallele Elternstudie erbrachte, dass 11 % der Kinder bereits Opfer von Cybermobbing waren. In der Lehrerstudie gaben über die Hälfte der Lehrkräfte an, schon Fälle von Cybermobbing bei ihren Schülern erlebt zu haben. Die Studie ermittelte zugleich, dass nur eine Minderheit der Schulen systematisch präventive Maßnahmen durchführt.
Zu ähnlichen Befunden kommen auch andere Studien. So berichteten in einer repräsentativen Befragung von Porsch und Pieschl (2014) 6 % der Jugendlichen von Opfer-, 7,5 % von Täter- und 1,2 % sowohl von Täter- auch als von Opfererfahrungen. Eine repräsentative EU Kids Online-Erhebung in 25 europäischen Ländern ermittelte 6 % Opfer und 3 % Täter (Livingstone et al. 2011). Dabei zeigte sich, dass deutlich mehr Heranwachsende offline gemobbt werden als online (traditionelles offline-Mobbing: 19 % Opfer und 12 % Täter).
Wie die Studien zeigen, ist Cybermobbing (auch Cyberbullying) unter Jugendlichen recht verbreitet. Cybermobbing kann dabei als ein aggressives Verhaltensmuster verstanden werden, bei dem eine einzelne Person oder eine Gruppe elektronische Medien verwendet, um eine schwächere Person oder Gruppe wiederholt und mit voller Absicht zu schädigen (Wachs u. a. 2016). Vier Formen sind hierbei zu unterscheiden: a) Belästigungen: Versenden von anstößigen, beleidigenden, verletzenden und bedrohenden Textnachrichten, Bild- oder Videobotschaften an das Opfer, b) Verunglimpfungen: Verbreitung von Textnachrichten, Ton- oder Videomaterial mit dem Ziel, die sozialen Beziehungen und das Ansehen des Opfers zu zerstören, c) Verrat: Veröffentlichung und Verbreitung von intimen Informationen über das Opfer und d) Ausschluss: Ausgrenzen, Herausekeln oder Verstoßen aus Online-Gemeinschaften und Online-Gruppen.
Bei der Frage, ob Cybermobbing zugenommen habe, gibt es unterschiedliche Befunde. Eine in den Jahren 2013 und 2015 durchgeführte, niedersachsenweit repräsentative Schülerbefragung ermittelte einen Anstieg des Anteils Jugendlicher mit Opfererfahrungen um ca. ein Sechstel (Bergmann u. a. 2017). Bei der Studie des »Bündnisses gegen Cybermobbing« (2017) verweisen die Eltern im Vergleich von 2013 und 2017 auf einen leichten Anstieg der Opfererfahrungen von 7 % auf 11 %, während die Schülerschaft einen leichten Rückgang von 17 % auf 13 % berichtete.