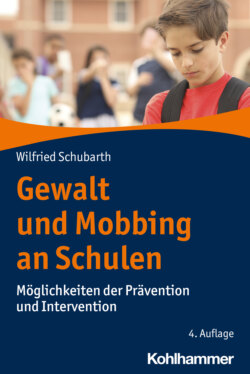Читать книгу Gewalt und Mobbing an Schulen - Wilfried Schubarth - Страница 6
ОглавлениеVorwort
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses im Grundgesetz verbriefte Grundrecht gilt auch für die Institution Schule und zwar für Schüler1 und Lehrer. Gleichwohl weiß jeder aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, diesem Recht Geltung zu verschaffen – auch und gerade in der Schule. Neben eigenen Erfahrungen stammt das meiste, was wir über die Schule zu wissen glauben, aus den Medien. Und diese sind beim Thema »Jugend und Gewalt« wahrlich nicht zimperlich, versprechen doch groß aufgemachte Berichte über extreme Gewaltvorfälle, z. B. Amokläufe, erhöhte Aufmerksamkeit und ökonomischen Gewinn. Sich über die Situation an Schulen selbst ein realistisches Bild zu machen, ist deshalb praktisch unmöglich. So bleiben die Fragen, die solche Medienberichte provozieren, weitgehend offen: Wie sicher sind unsere Schulen? Wie viel Gewalt, wie viel Mobbing gibt es an Schulen? Hat die Gewalt zugenommen? Haben wir bald amerikanische Verhältnisse? Was sind Ursachen für Gewalt und Mobbing? Und vor allem: Was kann gegen Gewalt und Mobbing getan werden? Welche Präventionsansätze gibt es und welche haben sich besonders bewährt?
Antworten auf all die Fragen gibt die schulbezogene Gewalt- und Mobbingforschung, die insbesondere seit den 1990er Jahren ihre Forschungsaktivitäten intensiviert hat. Diese haben ein differenziertes Bild von der Situation an Schulen gezeichnet und Folgerungen für die Prävention und Intervention abgeleitet. Zugleich wurden in den letzten Jahren zahlreiche Präventions- und Interventionsprogramme gegen Gewalt bzw. gegen Mobbing entwickelt und erprobt, so dass sich die Ausgangsbedingungen für die Präventionsarbeit, zumindest in dieser Hinsicht, verbessert haben.
Das vorliegende Buch vereint beide Aspekte: Zum einen wird eine kompakte Übersicht über die Hauptergebnisse der schulbezogenen Gewalt- und Mobbingforschung gegeben (Teil I) und zum anderen werden wichtige Konzepte sowie Programme zur Prävention und Intervention von Gewalt bzw. Mobbing dargestellt und bewertet (Teil II). Ein kurzer Ausblick auf Perspektiven der Gewaltprävention rundet das Buch ab (Teil III). Durch die Verknüpfung von Forschungsergebnissen und Präventionsmöglichkeiten versteht sich das Buch als Einführung und Grundlegung zum Thema »Gewalt und Mobbing an Schulen« und ist für alle an der Thematik Interessierten geeignet, z. B. Lehrer, Studierende, Sozialpädagogen, Erzieher, Forscher, Fortbilder, Vertreter von Schulbehörden usw.
Das vorliegende Buch knüpft an mein Buch »Gewaltprävention in Schule und Jugendhilfe« (2000) an und wurde in großen Teilen überarbeitet und ergänzt. So wurden z. B. neue Themen wie Mobbing, Cyberbullying, Happy Slapping oder Amokläufe, die in den letzten Jahren das Spektrum der Gewalt an Schulen erweitert haben, aufgenommen. Außerdem erfolgt eine systematische Darstellung, Bewertung und Einordnung der in den letzten Jahren sehr zahlreich gewordenen Präventions- und Interventionsprogramme. Auf diese Weise versucht der Band, eine Brücke von der Analyse zur (Präventions-)Praxis zu schlagen.
Bedanken möchte ich mich bei Herrn Dr. Klaus-Peter Burkarth für das Publikationsangebot und für die umsichtige Betreuung des Bandes, bei Frau Elisabeth Krüger für das aufwändige Korrekturlesen und insbesondere bei meiner Frau Gisela für die allseitige Unterstützung. Möge das Buch Anregungen geben für die weitere Zivilisierung und Humanisierung der Schule.
| Potsdam, im Herbst 2009 | Wilfried Schubarth |
Vorwort zur 3., aktualisierten Auflage
Seit dem Erscheinen der 2. Auflage (2013) sind einige Jahre vergangen. Jahre, in denen sich in der bundesdeutschen Gesellschaft – wie auch in anderen Teilen der Welt – tiefgreifende Veränderungen vollzogen haben. Vor allem die »Flüchtlingskrise« und der Rechtspopulismus haben das gesellschaftliche Klima verändert und soziale wie kulturelle Konflikte offengelegt. Fremdenhass, Misstrauen gegenüber dem »Establishment«, neue und alte Feindbilder sind allenthalben spürbar, ebenso eine Verrohung der Sprache oder ein respektloser Umgang miteinander. Dahinter verbergen sich oft persönliche Probleme, auch Ängste, rationale wie irrationale. Ängste vor Veränderungen, vor Statusverlust, Wertepluralismus oder Globalisierung. Neue Kommunikationsformen, die Sozialen Medien, haben mit ihren »Echokammern« und »Filterblasen« großen Anteil an diesen Veränderungen und die Struktur der öffentlichen Meinungsbildung ins Wanken gebracht. Cybermobbing und Hate Speech als beinahe alltägliche Begleiterscheinungen sind neue Herausforderungen. »Die Würde des Menschen ist unantastbar« – dieses Grundrecht gewinnt angesichts solcher Herausforderungen weiter an Bedeutung.
Die skizzierten Veränderungen sind an der Schule nicht spurlos vorbeigegangen, zumal sich die Institution Schule in den letzten Jahren selbst mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert sah: Inklusion, Integration von Flüchtlingen, Unterrichtsausfall, Lehrkräftemangel, teilweise hoher Krankenstand, Quereinsteiger, Sanierungsbedarf usw. sind nur einige Stichworte. Hinzu kommen neue inhaltliche Anforderungen wie digitale bzw. Medienbildung, Sprachbildung, Gesundheits-, Ernährungs-, Demokratie- oder Wertebildung. Eine der größten Herausforderungen ist dabei eine veränderte, heterogene Elternschaft, mit denen Schulleitungen und Lehrkräfte zu kooperieren haben. Etliche Schulen, vor allem in sozialen Brennpunkten, fühlen sich von all dem überfordert wie zahlreiche »Brandbriefe« oder andere Überlastungsanzeigen belegen.
Die vorliegende dritte Auflage greift diese vielfältigen Veränderungen in Gesellschaft und Schule auf. Diese dienen als Folie, auf der die Gewaltdebatte der letzten Jahre nachgezeichnet wird. Deshalb ist der neuen Auflage ein Abschnitt zur aktuellen Entwicklung von Gewalt und Mobbing vorangestellt. Dabei geht es vor allem um Fragen wie: Haben Gewalt und Mobbing, einschließlich Gewalt gegen Lehrkräfte, zugenommen? Welche Rolle spielen Cybermobbing und Hate Speech? Und: Welche neueren Erkenntnisse gibt es zur Intervention und Prävention?
Mit diesen Fragen und Themen soll der Gewaltdebatte der letzten Jahre Rechnung getragen werden. Zugleich wird damit die bisherige Debatte um weitere Facetten ergänzt. Unsere Annahme dabei ist, dass ein verändertes gesellschaftliches Klima und vermehrte schulische Aufgaben wie Inklusion, Integration usw. auch neue Anforderungen stellen, insbesondere an das Schulklima und an eine gewaltfreie Kommunikation unter bzw. zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern, was – bei ungünstigen Voraussetzungen – zu einer höheren Gewaltbelastung an Schulen führen kann. Eine der Konsequenzen wäre deshalb, mehr in Bildung und Schule zu investieren und Schulen besser personell und sachgerecht auszustatten. Ansonsten werden Gewalt und Mobbing auch in Zukunft ein Dauerthema bleiben. Das heißt aber auch, dass alle Lehrkräfte grundlegende Kompetenzen beim Umgang mit Gewalt und Mobbing erwerben sollten – am besten schon in der Ausbildung. Der vorliegende Band will dazu einen Beitrag leisten.
Das Erscheinen der dritten Auflage gibt mir zugleich die Gelegenheit, mich bei Herrn Dr. Klaus-Peter Burkarth für die langjährige, kontinuierliche Zusammenarbeit herzlich zu bedanken.
| Potsdam, im Januar 2019 | Wilfried Schubarth |
1 Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung wird in der Regel die neutrale bzw. männliche Form verwendet. Diese gilt für alle Geschlechtsformen (weiblich, männlich, divers).