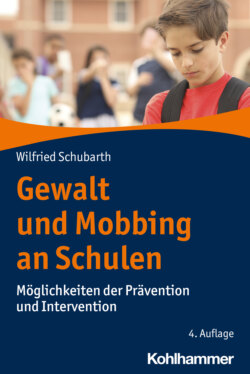Читать книгу Gewalt und Mobbing an Schulen - Wilfried Schubarth - Страница 12
Wie sollte mit Cybermobbing umgegangen werden?
ОглавлениеMittlerweile gibt es zahlreiche Konzepte, Programme und Ratgeber zum Umgang mit Cybermobbing. Für den konkreten Umgang mit Cybermobbing wird Kindern und Jugendlichen vor allem Folgendes empfohlen (vgl. Wachs/Schubarth 2017): Das Risiko, Opfer von Cybermobbing zu werden, kann verringert werden, indem man nicht zu viel über sich selbst online verrät. Vorsicht ist zudem bei dem Umgang mit Zugangsdaten ratsam. Passwörter sollten nicht mit anderen Personen geteilt werden und regelmäßig verändert werden. Online-Streitigkeiten sollten möglichst vermieden werden. Durch die Verwendung elektronischer Medien kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Wird man von einem Cybermobber belästigt, sollte man diese Person gezielt sperren. Opfer sollten sich nicht selbst die Schuld für Attacken geben und Gleichaltrige und Erwachsene um Hilfe bitten. Auf keinen Fall sollten verletzende Bilder oder Videos selbst geteilt werden. Man sollte sich selbst fragen, ob man gerne hätte, dass solche Informationen, Bilder oder Videos über einen selbst verbreitet werden. Wenn man sich nicht traut, direkt in das Geschehen einzugreifen, sollte man auf das Opfer zugehen und Hilfsbereitschaft signalisieren. Sich zu verbünden und den Täter zurück zu mobben, ist nicht empfehlenswert. Meistens führen Rachehandlungen zu einer weiteren Eskalation des Konflikts. In jedem Fall sollten Cybermobbing-Vorfälle dokumentiert werden. Dies kann mithilfe von Screenshots und dem Speichern von u. a. E-Mails, SMS, Posts, Bildern und Informationen geschehen. Bei gravierenden Fällen von Belästigungen, Verunglimpfungen und groben Persönlichkeitsrechtsverletzungen sollte die Polizei informiert werden.
Eltern, Lehrkräften und Erziehern wird Folgendes empfohlen: Damit sich Opfer von Cybermobbing den Erwachsenen anvertrauen, bedarf es regelmäßig Gespräche über die Online-Aktivitäten von Kindern. Wenn sich die Betroffenen hilfesuchend an Erwachsene wenden, sollte auf Schuldzuweisungen verzichtet und Verständnis gezeigt werden. Das Opfer sollte aktiv in den Lösungsprozess einbezogen werden. Ein Verbot, elektronische Medien zu nutzen, ist nicht ratsam, denn gerade die Angst vor einem Nutzungsverbot veranlasst viele Opfer, nicht mit Erwachsenen zu sprechen. Erwachsene können aber den Betroffenen helfen, die Übergriffe zu dokumentieren (z. B. Anfertigen von Screenshots, Speichern von Nachrichten) und ggf. diese Informationen an die Schule weiterleiten, denn oft kennen sich Täter und Opfer aus der Schule.
Sucht man nach speziellen Programmen gegen Cybermobbing, sind insbesondere die Programme »Surf Fair« und »Medienhelden« zu empfehlen, die kurz vorgestellt werden sollen.
Das Programm »Surf-Fair« (Pieschl/Porsch 2012) ist ein Trainings- und Präventionsprogramm gegen Cybermobbing für die Klassen 5 bis 7 und deren Lehrkräfte. Das Hauptziel besteht in der Vermittlung von Medienkompetenz und Medienkritik. Das modular aufgebaute Programm enthält 17 Übungsbausteine unter Einbeziehung aller Rollen (Täter, Opfer, Verstärker usw.). Die Übungen umfassen jeweils ein bis zwei Doppelstunden. Das Programm kann im Fachunterricht, in Projektwochen oder Arbeitsgemeinschaften, aber auch außerhalb der Schule eingesetzt werden. Es kann auch für jüngere und ältere Schüler adaptiert werden. Das Methodenspektrum ist breit, z. B. Filme, Videos (»Anchored-Instruction«), Brainstorming, Rollenspiele, Gedankenspiele, Erarbeiten von Klassenregeln usw. Bisherige Evaluationen konnten positive Effekte bei Motivationen, Einstellungen und Verhalten nachweisen.
Auch das Programm »Medienhelden« (Schultze-Krumbholz u. a. 2012), gefördert vom Weißen Ring, ist ein Präventionsprogramm gegen Cybermobbing, das vor allem die Medienkompetenz fördern will. Konkret geht es um das Erkennen von Konflikten, das Vermeiden von Missverständnissen und das Erlernen von Handlungsalternativen. Das Programm richtet sich an ältere Schüler (Klassen 7 bis 10) und kann sowohl im Schulunterricht als auch an einem Projekttag durch Lehrkräfte oder externe Multiplikatoren durchgeführt werden. Es ist auch für »Risikoschüler«, z. B. Schüler mit negativen Peerbeziehungen oder mangelnder Empathie, geeignet. Das Curriculum umfasst 15–17 Schritte (jeweils 45–90 Minuten) in acht Modulen über einen Zeitraum von ca. zehn Wochen. Der Medienhelden-Projekttag hat vier Themenblöcke (jeweils 90 Minuten). Die Palette der eingesetzten Methoden ist sehr breit, z. B. Information und Aufklärung, Fragebogenerhebungen, Filmvorführungen, Brainstorming, (Klein-) Gruppenarbeiten und Plenumsdiskussionen, Arbeiten im Stuhlkreis, Aufstellen von Klassenregeln, Mindmap, Meinungslinie, Identifikationskreis, Postererstellung, Reflexion, Feedback, Hausaufgaben, Rollenspiele, Arbeiten mit Standbildern, Peer-to-Peer-Tutouring, Peer-to-Parent-Ansatz, Übungen im Medienraum (»learning by doing«), Elternabend usw. Positive Wirkungen des Programms konnten nachgewiesen werden.
Darüber hinaus gibt es viele Vereine und Initiativen gegen Cybermobbing. Neben dem Bündnis gegen Cybermobbing, s. https://www.buendnis-gegen-cyber mobbing.de/, soll abschließend auf die von der EU geförderte Initiative »Klicksafe« verwiesen werden, s. https://www.klicksafe.de/. Die Initiative »Klicksafe« bietet vielfältige Informationen für Schüler, Lehrkräfte und Eltern rund um das Thema »Internet«, u. a. zahlreiche kostenlose Unterrichtsmaterialien und Broschüren sowie Ratschläge zu vielen Themen, z. B. »Knowhow für junge User«, »Was tun bei Cybermobbing« oder zum sicheren Umgang mit dem Internet (Wie sollte ein sicheres Passwort aussehen?). Daneben gibt es Verweise zu anderen Initiativen und Ansprechpartnern.