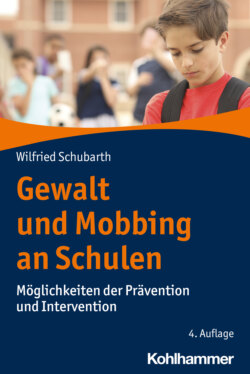Читать книгу Gewalt und Mobbing an Schulen - Wilfried Schubarth - Страница 9
Gewaltrückgang bis 2014, Trendwende seit 2015/2016?
ОглавлениеBei der Frage nach der Entwicklung von Gewalt und Mobbing ist – entsprechend der Studienlage – die Situation zweigeteilt. Bis etwa zum Jahre 2014 lassen die wenigen Vergleichsstudien eher auf eine Gewaltabnahme schließen. Seit 2015/16 ändert sich das Bild: Seitdem gibt es vermehrt Anzeichen für eine Zunahme von Gewalt, wenngleich die Datenlage nicht einheitlich ist.
So verweist unsere eigene Replikationsstudie von 2014 im Vergleich mit unserer Studie von 1996 insgesamt auf einen leichten Rückgang von Gewalt an Schulen bis zum Jahre 2014. Dieser leichte Rückgang bezieht sich größtenteils auf die Täteranteile. Zugenommen hat dagegen der Anteil der Opfer psychischer Gewalt, während der Anteil der Opfer von verbaler Gewalt konstant geblieben ist (Bilz/Schubarth/Dudziak u. a. 2017). Ähnliche Trends wurden auch durch die HBSC-Studien im Zeitraum von 2002 bis 2014 ermittelt. Danach gab es bis 2010 eine deutliche Gewaltabnahme, die sich dann bis 2014 leicht fortsetzte (Melzer/Schubarth 2016).
Dieser rückläufige Trend für Schulen steht auch im Einklang mit weiteren Befunden (vgl. z. B. Pfeiffer/Beier/Kliem 2018): So ermittelte das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) unter Neuntklässlern im Bundesland Niedersachsen von 1998 zu 2015 einen Rückgang des Anteils Jugendlicher, die angaben, eine Körperverletzung begangen zu haben, von 18 auf 5 % und bei Raubtaten einen Rückgang von 5 auf 0,4 %, wobei sich der Rückgang auf Schüler beiderlei Geschlechts, unterschiedlicher Schulformen und unterschiedlicher ethnischer Herkunft bezog. Auch die Statistik der Unfallversicherung verweist bis zum Jahre 2015 auf einen deutlichen Rückgang der Raufunfälle und zwar von 15 (pro 1000 Schülerinnen und Schüler) im Jahre 1999 auf neun Raufunfälle im Jahre 2015. Und schließlich registrierte auch die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKZ) zwischen 2007 und 2015 eine Halbierung der Tatverdächtigungsbelastungszahl (TVZ) im Bereich der Gewaltkriminalität bei 14- bis unter 18-Jährige und zwar von 1.266 auf 628 pro 1.000.000 Personen einer Altersgruppe.
Während somit bis etwa zum Jahre 2014 eine tendenzielle Abnahme von Gewalt an Schulen nachweisbar ist, scheinen die Jahre 2015/16 eine Trendwende darzustellen. Seitdem mehren sich die Anzeichen, dass Gewalt und Mobbing an Schulen zunehmen. Dafür sprechen folgende Befunde, wobei sich aufgrund der schwierigen Befundlage kein klares Gesamtbild ergibt.
Die von den Landeskriminalämtern zum »Tatort Schule« erhobenen Statistiken für 2017 haben folgende Ergebnisse und Trends erbracht: Aus den Lagebildern zum »Tatort Schule« im Jahre 2018 geht hervor, dass die Kriminalität an Schulen in zehn Bundesländern zugenommen hat. Die Steigerungsraten reichen von drei Prozent in Nordrhein-Westfalen, 14 % in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, 32 % in Niedersachsen bis zu 114 % im Saarland. Während die Schulkriminalität bis 2013 zurückgegangen war, ist jetzt in zehn Bundesländern eine Trendwende zu beobachten. Besonders deutlich fällt diese Trendwende bei körperlicher und verbaler Gewalt aus. Hier registrierten alle Bundesländer ab 2013 einen Gewaltanstieg, am deutlichsten bei schweren Körperverletzungen: 10 % in Nordrhein-Westfalen, 19 % in Bayern, 21 % in Hessen, 24 % in Rheinland-Pfalz, 39 % in Sachsen-Anhalt, 40 % in Brandenburg, 41 % in Baden-Württemberg, 60 % in Mecklenburg-Vorpommern und 69 % in Berlin. Ein weiteres Indiz für die Klimaverschlechterung an vielen Schulen sei die Zunahme von Bedrohungen, die zwischen 2013 und 2017 z. B. in Baden-Württemberg um 20 %, in Brandenburg um 30 % und in Berlin um über 50 % gestiegen sei (Welt am Sonntag 22.07.2018).
Die Arbeitsstelle Jugendgewaltprävention beim Berliner Senat verweist in ihrem Bericht von 2017 auf folgende Befunde (Lüter/Schroer-Hippel/Bergert/Glock 2017): Erstmals seit dem Jahre 2010 sind an Berliner Schulen im Jahre 2016 deutlich mehr schulische Gewaltvorfälle polizeilich registriert worden, wobei sich das Ausmaß zwischen den Stadtbezirken stark unterscheidet. Auch beim Notfallmeldesystem der Berliner Bildungsverwaltung ist in den Jahren 2015 und 2016 ein deutlicher (noch stärkerer als in der Polizeistatistik) Anstieg von Gewaltvorfällen an Schulen registriert worden, insbesondere bei Beleidigungen, Drohungen und Tätlichkeiten. Neben den Grundschulen werden seit 2015 auch wieder vermehrt Gewaltvorfälle aus den Integrierten Sekundarschulen gemeldet. Im Zehnjahresvergleich ist der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger für polizeilich registrierte Schulgewalt von 2010 bis 2014 kontinuierlich gesunken, 2015 und 2016 jedoch leicht auf 23 % angestiegen.
Diese schulbezogenen Statistiken passen auch zu Entwicklungstrends bei Jugendgewalt insgesamt. Im Gutachten von Pfeiffer, Baier und Kliem (2018) wird festgestellt, dass es im Jahre 2016 zu einem merklichen Anstieg der Jugendgewalt gekommen sei. Die Tatverdächtigenbelastungszahl bei 14- bis unter 18-Jährigen habe sich auf 705,6 und damit um 12,3 % erhöht. Dieser Anstieg sei primär bei nichtdeutschen Tatverdächtigen zu beobachten, womit die Bedeutung der Integration von Migrantinnen und Migranten im Allgemeinen und von Flüchtlingen im Besonderen unterstrichen werde. Darüber hinaus verweist das Gutachten auf Probleme des politischen Extremismus: Etwa jeder fünfte deutsche Jugendliche sei ausländerfeindlich eingestellt. Etwa jeder 14. Jugendliche habe linksextreme Orientierungen und jeder neunte muslimische Jugendliche islamisch fundamentalistische Einstellungen.
Im Gegensatz dazu können einige Studien jedoch keinen generellen Gewaltanstieg an Schulen bestätigen. So kommt die Studie »Jugend in Brandenburg 2017«, die sich auf Trendanalysen seit Mitte der 1990er Jahre beziehen kann, zu folgenden Aussagen (Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung 2018): Der Anteil der Jugendlichen, die sich oft oder manchmal an Schlägereien beteiligen, ist leicht gesunken (1996: 13,0 %; 1999: 8,9 %; 2001: 8,3 %; 2005: 10,4 %; 2010: 10,9 %; 2017: 8,1 %). Jungen beteiligen sich nach wie vor häufiger an Schlägereien (2017: 12,0 %) als Mädchen (2017: 4,0 %). Dieser rückläufige Trend gilt auch für Gewalterfahrung außerhalb der Schule. Allerdings ist auch ein geringer Anstieg beim Anteil derer zu verzeichnen, die oft geschlagen wurden (2010: 0,9 %; 2017: 1,2 %). Umgekehrt ist der Anteil der brandenburgischen Jugendlichen, die sich nie an gewalttätigen Aktionen beteiligen, angestiegen (1996: 52,0 %; 1999: 59,5 %; 2001: 65,0 %; 2005: 59,8 %; 2010: 61,2 %; 2017: 68,5 %) und erreicht den höchsten Wert in der Zeitreihe seit 1996. Allerdings stellt die Studie einen klaren Anstieg von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit unter Brandenburger Jugendlichen fest (Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung 2018).
Auch im Gutachten für den 23. Deutschen Präventionstag 2018 (Baier 2018) wird für das Bundesland Niedersachsen von 2013 bis 2015 auf einen Rückgang der Schülergewalt verwiesen, sowohl bei der Gesamt-Opferrate als auch bei Sachbeschädigung und verbalen Aggressionen. Ähnliches gilt für das Begehen von Körperverletzungen mit Waffen, inklusive Messer. Jedoch wird von 2013 zu 2015 ein Anstieg des Anteils von Jugendlichen festgestellt, die Messer bei sich führen (männlich: von 27 % auf 29 %; weiblich: von 6 % auf 7 %), was problematisch sei.