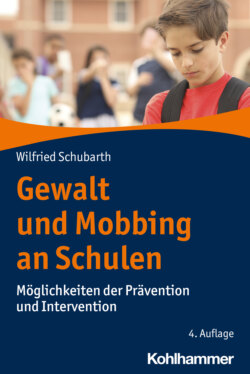Читать книгу Gewalt und Mobbing an Schulen - Wilfried Schubarth - Страница 16
Welche Interventionsstrategien sind erfolgreich?
ОглавлениеUnsere Studie (Bilz/Schubarth/Dudziak u. a. 2017) liefert auch Antworten auf die Frage, wie und mit welchem Erfolg Lehrkräfte in Gewalt- und Mobbingsituationen agieren. Die mit Abstand häufigste Interventionsform ist das Gespräch mit den beteiligten Schülerinnen und Schülern. Mit deutlichem Abstand folgen kleinere Interventionen wie Gesten oder Mimiken, Maßnahmen auf Klassenebene oder Disziplinierungsmaßnahmen. Dagegen sind Kooperationen mit anderen Personen, emotionale Unterstützung oder langfristige Maßnahmen auf Klassen- bzw. Schulebene eher selten. Diese Befunde sind im pädagogischen Kontext ambivalent zu sehen: Einerseits sind Gespräche immer ein probates pädagogisches Mittel, Konflikte zu regeln; andererseits lässt die geringe Orientierung an kooperativen Ansätzen auf fehlendes kollegiales Zusammenwirken und folglich auf eine ungenügende Reichweite der Maßnahmen schließen.
Probleme aufgrund einer mangelnden pädagogischen Professionalität beim Umgang mit Gewalt und Mobbing werden auch bei einem Vergleich von Lehrer- und Schülerperspektive deutlich. So berichten Schülerinnen und Schüler – im Vergleich zu Lehrkräften – deutlich häufiger davon, dass bei Gewalt- bzw. Mobbingfällen autoritär-strafend eingegriffen wird, also z. B. mit Drohungen, Sanktionen und Disziplinierungen. Mehr als jeder vierte Schüler berichtet von solchen autoritär-strafenden Interventionen; bei den Lehrkräften ist dies nur etwa jede sechste Lehrkraft. Fremd- und Selbstbild gehen bei der Art der Inventionen offenbar ein Stück weit auseinander – Anlass genug, sich über unterschiedliche Wahrnehmungen auszutauschen.
Der relativ hohe Anteil autoritär-strafender Maßnahmen ist zum Teil problematisch; autoritär-strafende Maßnahmen sind beim Umgang mit Gewalt und Mobbing meist nicht zielführend. Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler gelingt es Lehrkräften mit unterstützend-kooperativen Interventionen (z. B. Kollegen hinzuziehen, Peer-Mediation, die gesamte Klasse einbeziehen) deutlich häufiger, das Mobbinggeschehen zu beenden als mit unterstützend-individuellen Interventionen (z. B. Gespräche mit den unmittelbar Beteiligten) und auch mit autoritär-strafenden Mitteln. Will man Gewalt und Mobbing nachhaltiger begegnen, müssten somit unterstützend-kooperative Interventionen aus- und im Gegenzug autoritär-strafende Maßnahmen abgebaut werden. Hier können Fortbildung und Schulentwicklungsprozesse ansetzen.
Bei der Bewertung des Interventionserfolges ergeben sich weitere Differenzierungen , z. B. nach dem Status im Mobbinggeschehen. So bewertet die Gruppe der Unbeteiligten den Erfolg am höchsten, gefolgt von den Mobbingopfern und den Mobbingtätern. Der harte Kern, die Gruppe der Täter-Opfer, die sowohl Täter- als auch Opfererfahrungen machen, bewertet den Erfolg am niedrigsten. Hier bedarf es weiterer Überlegungen, wie mit dem harten Kern umgegangen werden kann. Offenbar ist diese Gruppe mit den bisherigen Strategien nur schwer zu erreichen.