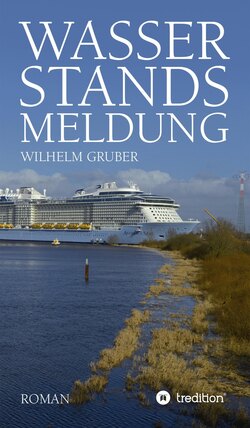Читать книгу Wasserstandsmeldung - Wilhelm Gruber - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление… furzen, wenn’s donnert …
An den folgenden Wochenenden blieb ich in Hannover und genoss es, allein zu sein in meinem geräumigen Apartment ohne mütterliche Gesellschaft.“
„Was war mit Ihrem Vater?“, fragt Dr. Patolak.
„Er schaltete sich nach einiger Zeit als Vermittler ein, schriftlich mit dem Briefkopf seiner Kanzlei und wies mich freundlich darauf hin, dass allein die Miete bei weitem den Betrag überstieg, der mir für den Unterhalt während des Studiums zustand. Er bat mich, meiner Mutter doch nachzusehen, dass sie sich möglicherweise ein klein wenig überfürsorglich verhalte.
Ich bedankte mich schriftlich, versprach ihm Nachsicht mit meiner liebenswürdigen Mutter und informierte ihn darüber, dass ich nach Ablauf des Mietvertrages ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft beziehen würde. Die Miete dort sei nicht halb so hoch; sicher auch in seinem Sinne.
Das war zu viel für meine Mutter. ‚In einer Kommune würde sie mich nicht mehr besuchen‘, so antwortete sie, ebenfalls schriftlich. Endlich verhängte sie die Höchststrafe. Genau das war mein Ziel.
Dafür tat sich eine neue Verbindung zu meinem Vater auf. Es entstand ein Briefwechsel zwischen mir und ihm. Ich schrieb an seine Kanzlei und damit war meine Mutter vom Zugang ausgeschlossen. Bald bekamen wir auch einen telefonischen Brückenschlag zustande. Ich wusste, wann er im Büro am besten zu erreichen war und rief von der Telefonzelle an. Nie zuvor hatte ich von ihm zwei Sätze im Zusammenhang gehört, ohne dass meine Mutter dazwischen keilte. Am Telefon unterbrach uns niemand. Das schien auch mein Vater zu genießen; er litt unter seiner Frau, genau wie ich unter meiner Mutter. Wir sprachen nicht über sie. Aber ungesagt herrschte Übereinstimmung. Wir waren geheime Verbündete. Offensichtlich freute es ihn, dass seine Tochter nicht nach der Mutter geraten war. Wenn er mich früher Fußball spielen sah, ließ er gern den altväterlichen Spruch fallen: ‚An dir ist wohl ein Junge verloren gegangen.‘ Das fand ich peinlich. Aber eine Frau wie meine Mutter zu werden, wäre für mich und für ihn gleichermaßen ein Albtraum gewesen. Ohne sie war ich jetzt auch endlich frei für einen ganz anderen Kampf; die Änderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse duldeten keinen Aufschub mehr.
In der Wohngemeinschaft war einiges anders. Ich gewöhnte mich erst langsam daran. Die Zimmer hatten keine Schlüssel. Nicht mal das Badezimmer ließ sich abschließen. Die Handtücher wurden scheinbar von allen benutzt, ich nahm meine zur größeren Sicherheit mit aufs Zimmer. Die Matratzen lagen direkt auf dem Boden; von den einengenden Bettgestellen hatte man sie befreit.
In der Küche gehörte allen alles, aber etwas Essbares war nur selten zu finden. Vor dem Essen empfahl es sich, erst mal zu spülen. Fast immer war ich es, die sich erbarmte, den Müll auszutragen, weil der Eimer so voll war, dass sich nicht mal mehr die Aschenbecher darin entleeren ließen.“
Frau Buchholz nimmt einen Schluck Kaffee. Ganz so heiß dürfte er nicht mehr sein. Es scheint sie nicht zu kümmern.
„Die Genossinnen und Genossen der Wohngemeinschaft hatten schon auf mich gewartet. Das Bewusstsein für Veränderung stand mir auf die Stirn geschrieben. Sie nahmen mich sofort in die Pflicht. Die Fachschaft Tiermedizin sei nicht hinreichend mit fortschrittlichen Vertreterinnen und Vertretern besetzt. ‚Kampf den reaktionären Kräften in den Fachschaften’, hieß ihre Parole zur anstehenden Wahl.
Jetzt ging es los, so wie ich es mir gewünscht hatte. Von einem Tag zum anderen stand ich auf Platz eins der ‚Liste Fortschritt’. Ich war Studentin der Tiermedizin, erst im zweiten Semester, von nichts auch nur eine Prise Ahnung, aber das richtige Bewusstsein, immerhin. Eigentlich hätte ich über mich selbst lachen müssen, aber vor lauter Aktionismus kam ich nicht dazu. Die Arbeit in den Gremien hatte Vorrang und Lachen gehörte nicht zum Geist der Zeit; zur revolutionären Gesinnung trug man ein grimmiges Gesicht.
Dafür aber lachten andere über mich. Was sie bei den Vorstellungsrunden der Kandidatinnen und Kandidaten auch fragten, ich hatte immer nur dieselben Phrasen von historischen Notwendigkeiten parat. Dass es doch jetzt darum ginge, die etablierte Gesellschaft zu verändern und das System zu überwinden. Es hagelte Spott, Hohn und Gelächter. Die Studenten der Tiermedizin und auch die wenigen Studentinnen dort waren geerdet. Viele kamen vom Bauernhof, standen fest mit beiden Beinen auf der Scholle, wussten, wohin sie gehörten und was sie wollten. Noch genauer wussten sie, wen sie wählten und wen nicht. Die meisten kümmerten sich nicht um die Wahl, weil sie das ganze Affentheater nicht ernst nahmen; Affentheater und Tiermedizin gingen nicht zusammen. Die Wahlbeteiligung war dementsprechend niedrig. Mich jedenfalls wählten sie nicht.
Ich holte kaum eine Stimme, die sich nicht in unsere kleine Szene zurückverfolgen ließ, und bekam kein Mandat, auch nicht im Nachrückverfahren. Durchgefallen. Die gesamte ‚Liste Fortschritt’ ging leer aus. Ich zog mir den Zorn meiner Mitbewohner zu. Sie gehörten zu den Altvorderen der sogenannten Bewegung in Hannover.
‚Nicht engagiert genug gekämpft, zu wenig Leidenschaft’, legte mir Diethard, unser Alphamännchen, zur Last. Das Pöbelhafte in seiner Stimme sagte alles; auf die Inhalte brauchte ich gar nicht zu achten, es waren immer die gleichen gebetsmühlenhaften Parolen.
Mit dem Telefonhörer am Ohr analysierte und diskutierte er das Wahlergebnis, am anderen Ende der Leitung vermutlich ein Genosse höheren Ranges aus seinem Kader. ‚Wir brauchen Aktionen! Unsere jungen Kandidaten müssen kämpfen lernen!’, donnerte er ins Telefon.
‚Eine Finte‘, raunte mir meine Mitbewohnerin Almut zu, ‚warte ab, gleich macht er eine Flasche Amselfelder auf und will dich trösten.‘
‚Furzen, wenn’s donnert’, dachte ich und sah sie gleichgültig an. ‚Solange er am Telefon den Brüllaffen macht, hört er nicht, was du sagst. Gleich, wenn er auflegt, spielst du wieder das unterwürfige Weibchen und hältst schön still.‘
Es dauerte nicht lange, bis ich erkannte, dass diese Wohngemeinschaft für mich nicht das Richtige war, und kündigte zum nächstmöglichen Termin. Niemand sollte bei mir den Tröster der Betrübten spielen, erst betrüben und dann trösten.
Noch am selben Abend ließ ich mir einen Schlüssel für meine Zimmertür anfertigen. Der Kerl vom Schlüsseldienst zockte mich gehörig ab, in bar, ohne dafür eine Rechnung auszustellen.
‚Egal‘, dachte ich, ‚dann gibt es bis zum Monatsersten nur noch Toast und Knäckebrot’. Ich schloss jetzt regelmäßig meine Zimmertür ab und war damit endgültig in Ungnade gefallen, ins Lager der Reaktionäre zurückversetzt; Klassenziel nicht erreicht. Man schnitt mich, wo immer nur möglich. Allein Almut tauschte ab und zu einen Blick und manchmal auch ein paar belanglose Worte mit mir; ich verbuchte es als Geschlechtersolidarität.
Zur Sicherung meiner Privatsphäre ging ich noch einen Schritt weiter, diesmal etwas preiswerter. In einem Laden für Werkzeuge und Baubeschläge besorgte ich mir einen Türkeil und einen kleinen Hammer. Vor meinem nächsten Wannenbad versperrte ich damit die Tür. Hammer und Keil waren ab jetzt feste Bestandteile in den Taschen des Bademantels.
Einige Zeit später meldete sich die designierte Nachmieterin. Sie hatte das Casting durchlaufen und war von den Genossinnen und Genossen der Wohngemeinschaft auserlesen, mein Zimmer zu übernehmen. Sie war mir nicht unsympathisch, auf ihrer Stirn stand nichts von Opposition oder Revolte. Ob sie hier am richtigen Platz war? Was scherte es mich? Eine Warnung steckte ich ihr lieber nicht, so etwas wie: ‚Mädchen, mach keinen Fehler’ oder Ähnliches. Sicher würde sie besser klarkommen. Sie hieß Susanne. Ich dachte sofort an ‚Susanna im Bade’ und bot ihr an, dass sie gern meinen Zimmerschlüssel übernehmen könnte, Hammer und Keil erwähnte ich nicht.
Sie schien schon davon gehört zu haben und schüttelte lächelnd den Kopf. ‚Aber wie wäre es, wenn du mir deine neue Adresse gibst?’, fragte sie.
Darauf schüttelte ich lächelnd den Kopf. Auch wenn Susanne mir sympathisch war, wollte ich mit dem Rest der Wohngemeinschaft abschließen; meine neue Adresse behielt ich für mich.
Bald konnte ich mein Zimmer im Studentenwohnheim beziehen und kam allmählich zur Ruhe. Nachdem ich genesen war von all den Verwundungen, die ich mir an der Front gegen die reaktionären Kräfte zugezogen hatte, ‚friendly fire‘ inbegriffen, stellte ich ernüchtert fest, dass ich nicht einmal die Hälfte der vorgesehenen Leistungsnachweise geschafft hatte. Damit war mein zweites Semester danebengegangen. Alles war aufzuholen, nichts zu spät, aber es hieß nun, hinter den versäumten Scheinen her zu hecheln und die Semesterferien zu opfern, um den Stoff nachzubüffeln.