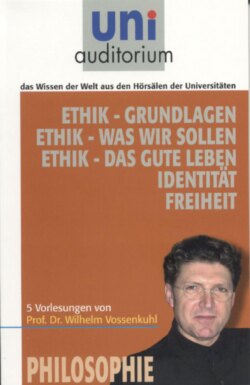Читать книгу Ethik - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Selbstbestimmung
ОглавлениеIch habe erklärt was sittliche oder normative Tatsachen sind. Eine dieser Tatsachen ist uns heute sehr wertvoll geworden, nämlich die Selbstbestimmung. Sie ist ein typisches Produkt der letzten 200 Jahre. Nicht, dass die Menschen davor auch schon Interessen dieser Art gehabt hätten, nämlich das zu tun was sie selber wollen. Aber Selbstbestimmung als gesetzlich geschützter, ja sogar staatsrechtlich geschützter Anspruch hatte es in der Vergangenheit nicht gegeben. Das ist etwas ganz modernes.
Dieser Anspruch auf Selbstbestimmung spielt in einem Bereich eine Rolle der ethisch sehr brisant ist, nämlich in der Medizinethik. Ich sprach schon vom Tötungsverbot. Was haben Selbstbestimmung und Tötungsverbot miteinander zu tun? Scheinbar gar nichts. Und doch: Stellen Sie sich vor, eine Person, vielleicht sogar jemand, den Sie gut kennen, ist sterbenskrank, leidet sehr stark, hat starke Schmerzen. Die Ärztinnen und Ärzte, die sich um sie oder ihn kümmern, haben keine große Hoffnung mehr. Nun gibt es heute – gottseidank – die Palliativmedizin, die Menschen hilft, würdig und ohne Schmerzen zu sterben – so gut es jedenfalls geht.
Aber wie ist es, wenn eine Patientin oder ein Patient seine
Schmerzen, seinen Zustand einfach nicht mehr aushält und sterben will? Da haben wir schon den Zusammenhang zwischen Selbstbestimmung und Tötungsverbot. Die Frage ist: Darf dieser Patient getötet werden, wenn er es will?
Man könnte sagen, im Rahmen der Selbstbestimmung ist nichts normaler als das. Es ist ein extremer Wunsch – zugegeben, aber es ist doch auch eine Frage der Selbstbestimmung. Kann ich denn nicht über meinen eigenen Tod entscheiden? Natürlich kann ich das. Wenn ich mich selbst töte, gibt es dagegen keine rechtlichen Einwände. Es ist kein strafbarer Tatbestand. Früher war das einmal anders. Aber wie ist es, wenn dieser Patient sich nun nicht selbst töten kann, also nicht Suizid begehen kann, sondern dabei Hilfe braucht. Dürfen Ärzte ihm dabei helfen?
Ein heute außerordentlich umstrittenes Problem. Wir haben zwei unableitbare, grundlegende Forderungen die hier miteinander in Konflikt geraten, nämlich das Selbstbestimmungsrecht auf der einen Seite und das Tötungsverbot auf der anderen. Das Selbstbestimmungsrecht betrifft natürlich diesen Patienten und das Tötungsverbot betrifft nicht den Patienten, sondern die Ärzte oder das Pflegepersonal und natürlich auch die Angehörigen.
Wie ist dieses Problem also zu lösen? Nun, die Selbstbestimmung hat bei uns in der Bundesrepublik Deutschland eine Grenze, dort, wo man vom „Töten auf Verlangen“ sprechen kann. Der Patient kann zwar verlangen, durch eine Spritze oder durch ein Medikament getötet zu werden, aber die Ärzte dürfen ihm dabei nicht helfen.
Ich werde gleich versuchen zu erklären, warum, aber zunächst einmal – um den Sachverhalt ethisch genauer zu beschreiben – noch einige Aspekte: Wenn sich der Patient selbst töten kann, dürfen ihm Ärzte dabei indirekt helfen. Sie dürfen ihn nicht töten, aber sie können ihm zum Beispiel Tabletten geben, die er selbst schluckt. Das ist erlaubt und dagegen gibt es auch keine rechtlichen Bedenken. Die Hilfe ist also möglich. Da es kein Straftatbestand ist, sich selbst zu töten, ist auch die Hilfe, die dabei geleistet wird, kein strafbarer Tatbestand.
Nun werden viele sagen: Aber wie ist es denn mit der Ethik? Ist es nicht ethisch doch umstritten oder vielleicht sogar verboten, einem Menschen, der wegen seiner Schmerzen aus dem Leben scheiden will, zu helfen? Nein, auch ethisch ist dagegen nichts einzuwenden. Nur das aktive Töten ist ethisch und auch rechtlich verboten.
Warum? Das hat mir der Frage zu tun, was Selbstbestimmung im Angesicht des Todes eigentlich genau bedeutet. Oder anders gefragt: Dürfen wir Menschen, die im Sterben liegen, mit der Verantwortung für das „getötet werden“ belasten?
Das klingt ein wenig wie „Wortklauberei“, aber tatsächlich ist es die genaue Beschreibung dessen, was ein Patient wünscht. Er möchte getötet werden. Wie zuverlässig ist dieser Wunsch? Dürfen wir ihn wörtlich nehmen? Wenn wir den Patienten gut kennen, werden wir wissen wie er das meint. Aber es ist doch so, dass starke Schmerzen – jeder, der einmal starke Zahnschmerzen hatte, weiß, was ich meine – unser Bewusstsein verändern. Wenn wir unter einem starken Schmerz stehen, ist unsere Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt. Vielleicht sogar erheblich eingeschränkt, das kommt auf die Art des Schmerzes an. Wenn das jedoch so ist, dann fehlt die Bedingung, unter der Selbstbestimmung ernstzunehmend und anerkennenswert ist. Selbstbestimmung ist nämlich genau dann nicht anerkennenswert, wenn sie unter einem Zwang steht. Sei es der Zwang von Schmerzen, sei es der Druck von anderen Menschen.
Sie sehen, dieses Problem ist gar nicht so einfach. Und es gibt auch gar keine generelle ethische Lösung für dieses Problem. Solange der Patient sich selbst die Tabletten geben kann, solange ist das Problem lösbar. Aber wenn er das nicht kann, zum Beispiel bei völlig gelähmten Menschen – sogenannten ALS-Patienten, dann ist das Problem sehr groß.
Wir haben gesehen, dass Selbstbestimmung ein Grundanspruch ist, der genau wie das Tötungsverbot unableitbar ist. Beide sind unableitbar, aber sie können in Konflikte miteinander treten.
In der früheren Fragestellung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass das Verhältnis der Sitte zur Ethik problematisch werden kann. Es kann auch da Konflikte geben, ähnlich den Konflikt, den ich gerade beschrieben habe. Denken Sie doch einmal an die Frage der Menschenwürde und die Frage der Unableitbarkeit der sittlichen Grundlagen. Ich habe bereits erwähnt, dass nicht alle diese Grundlagen ethisch anerkennenswert sind.