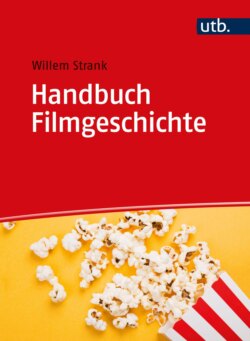Читать книгу Handbuch Filmgeschichte - Willem Strank - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bewegte Bilder
ОглавлениеDie bereits erwähnte Beschleunigung der Massenproduktion im 19. Jahrhundert geht mit drei weiteren gravierenden Veränderungen einher: Es ist erstens ein Zeitalter der Reduktion von Distanzen, was sich unter anderem in der Erfindung des Telefons 1876 und des Automobils in den 1880er-Jahren niederschlägt. Zweitens beginnt in jenen Jahren nicht nur mit der Fotografie 1826 die Ägide der Aufzeichenbarkeit des Visuellen, sondern ebenfalls des Auditiven: Seit 1877 gibt es den Phonographen. Drittens ermöglichen Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel die massenhafte Verbreitung vormals ausschließlich höheren Schichten vorbehaltener Künste. Gelegentlich gibt es im Zuge dessen vereinfachte, populärere Varianten – zum Theater gesellt sich das Varieté, zur Oper die Operette –, aber mithin werden auch die großen Vorbilder immer bezahlbarer und zugänglicher.
Man könnte sagen, dass es anhand dieser drei Faktoren nicht überraschen mag, wenn bewegte Bilder zu einem besonderen Anliegen des 19. Jahrhunderts avancieren, liegen sie doch an der Schnittstelle von Distanzabbau, Konservierbarkeit und Populärkultur.
Auf daumenkinoartige Konstruktionen, wie sie auch heute noch als Kinderspielzeug dienen, folgen drehbare Apparate: zunächst 1832 das Phenakistiskop des Belgiers Joseph Plateau und des Österreichers Simon Stampfer, das durch seine drehbaren Scheiben vor einem Guckloch den Eindruck von Bewegung erzeugt. Und ein Jahr später, 1833, das Zoetrope, bei dem die Bilder innen stehenbleiben, aber sich die gesamte Schale dreht, wodurch ebenfalls der Eindruck bewegter Bilder entsteht. Auch diese kleineren Medien gehen Mitte des Jahrhunderts in Massenproduktion – insbesondere das Zoetrope, das ab 1867 seinen Siegeszug als Haushaltsgimmick antritt.
Während gezeichnete Bilder also bereits Formen der Bewegung gefunden haben, ist die Fotografie zu jenem Zeitpunkt noch in zweierlei Hinsicht zu schwerfällig dafür – die Belichtung dauert viel zu lange und das Material ist massiv und unbeweglich. Für einen Film im engeren Sinne ist jedoch eine schnelle Belichtung, um durch eine rasche Bildrate die Illusion von Bewegung zu erzeugen, unabdingbar. Mehr als 16 Bilder die Sekunde sind erforderlich, damit die Nahtstellen in der menschlichen Wahrnehmung aufgrund unserer Netzhautträgheit verschwinden und die Bewegung als kontinuierlich empfunden wird. Außerdem muss das Material leicht kopierbar sein und schnell gewechselt werden können – selbst wenn also mehrere Fotografien eine zusammenhängende Bewegung abzubilden vermögen, wären die einzelnen Momente jener Bewegung doch auf vereinzelte, schwere und unflexible Glasoder Zinnplatten aufgeteilt.
Der Durchbruch kommt mit dem Fotopapier, das leichter, biegsamer und schneller zu verarbeiten ist. George Eastman (1854–1932)entwickelt 1888 sein Modell Kodak, das als erste Amateurkamera in die Geschichte eingeht und das neue flexible Fotopapier nutzt. Ein Jahr später erfindet derselbe George Eastman den Zelluloidfilm, der noch flexibler ist, da er sich verlustfrei einrollen und wieder entrollen lässt. Die materiellen Bedingungen des Films selbst sind damit geschaffen – nun fehlt nur noch ein Gerät, das die Zelluloidstreifen in Bewegung versetzt.
1877 entwickelt der Franzose Émile Reynaud (1844–1918) das Zoetrope weiter, indem er es mit Spiegeln versieht. Sein Praxinoskop genannter Apparat gibt den Anstoß zu der allmählichen Entwicklung der bewegten Spiegelprojektion über die nächsten zwei Jahrzehnte hinweg. Ein Jahr später experimentiert Edward (Eadweard) Muybridge (1830–1904) mit Schnellbelichtung. Mithilfe von zwölf Kameras führt er im Auftrag einer Firma, die über die Qualität von Rennpferden Auskunft haben möchte, Bewegungsstudien durch, die unter dem schlichten Namen Horses kursieren. Aus Muybridges wirtschaftlichem Interesse erwächst schließlich eine naturwissenschaftliche Neugierde, als er realisiert, wie genau mit seiner Methode einzelne Aspekte von Bewegungen festgehalten und somit verlangsamt werden können.
Im selben Geiste fertigt Étienne Jules Marey (1830–1904) 1882 seine Foto-Pistole an, die zwölf Bilder pro Umdrehung belichten kann, und die er zunächst für Studien über Vogelflugbewegungen einsetzt. Sein Verfahren benennt er kurz darauf in Chronofotografie um, und unter diesem Label wird auch heute noch seine bekannteste Studie Walking Man von 1884 geführt. Eines der Hauptprobleme der Herstellung bewegter Bilder zu jener Zeit ist die Tatsache, dass kontinuierlich maschinell abgespielte Bilder in der menschlichen Wahrnehmung miteinander verschwimmen. Die Abspielmaschinen müssen also bei jedem Bild kurz anhalten und wieder anfahren, um durch diesen Start-Stop-Effekt die Konturen der Bilder klar wahrnehmbar zu machen, während die Geschwindigkeit von mindestens 16 Bildern pro Sekunde eingehalten werden muss, damit die Illusion der kontinuierlichen Bewegung überhaupt entstehen kann. Diese Start-Stop-Technik wird von der 1790 erfundenen Nähmaschine übernommen, die einen solchen Mechanismus aufweist. Etienne Jules Marey geht als erster diesen Weg und bleibt dabei Pionier in einer Produktionsweise bewegter Bilder, die zwar vorerst in eine Sackgasse führt, aber immerhin als Inspiration für spätere Entwicklungen dient. 1888 entwickelt er eine aus heutiger Sicht irrwitzige Konstruktion: eine Kamera mit Papierfilm, die in Laufgeschwindigkeiten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufzeichnen kann – damit ist die notwendige Kombination von dehnbarem Film und einem Start-Stop-Mechanismus erstmals verwirklicht, die wenige Jahre später die eigentliche Erfindung des Films zu einem weltweiten Erfolg machen wird. Hier enden diejenigen unserer Beispiele, die sich jenseits der eigentlichen Filmgeschichte befinden – Vorläufer, Zwischenschritte, technologische Bedingungen. Der Film selbst wird ziemlich genau parallel in den USA, Frankreich und Deutschland entwickelt – die einzelnen Geschichten dahinter werden Bestandteile der folgenden Kapitel sein.