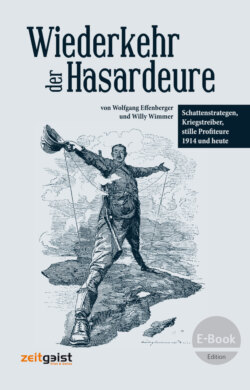Читать книгу Wiederkehr der Hasardeure - Willy Wimmer - Страница 27
Balkankrieg 1912
ОглавлениеEntschlossen und umfassend griff der Balkanbund die Türkei an, welche sich im Südosten an der Tschataldscha-Linie behaupten konnte, im Westen aber herbe Niederlagen einstecken musste: am 24. Oktober Niederlage bei Kumanova, Serben besetzen die Adriaküste bei Durazzo; am 26. Oktober Räumung von Üsküb (Skopje); am 8. November ziehen Griechen und Bulgaren in Saloniki ein, am 18. November fällt Monastir, das letzte Ziel aber – Konstantinopel – blieb unerreicht. Der türkische Großwesir Kiamil Pascha bat die Großmächte um Friedensverhandlungen, letztlich konnten die Bemühungen Deutschlands und Englands einen Krieg zwischen Österreich und Russland verhindern. Streitigkeiten zwischen den Siegern über die Verteilung der Beute retteten die Türkei.
Nach dem Waffenstillstand führte der serbische Gesandte Ristic Mitte Dezember 1912 in Bukarest ein aufschlussreiches Gespräch mit dem rumänischen Innenminister Take Jonescu (1858–1922). Dieser war überzeugt, dass die Großmächte keinen Krieg wünschten. »Wenn ich von Großmächten spreche«, so Jonescu, »meine ich nur diese drei: Deutschland als Militärmacht, England als Seemacht und Frankreich als Finanzmacht. Russland, Österreich-Ungarn und Italien, besonders letzteres, können als Großmächte nicht in Rechnung gezogen werden.« Dann versuchte Jonescu dem serbischen Gesandten ins Gewissen zu reden: »Wäre ich ein Serbe, so würde ich mich mit dem, was Serbien gemäß den in London getroffenen letzten Vereinbarungen erhalten hat, zufrieden stellen. Es ist klug, ein Maximum von dem zu verlangen, was erreichbar erscheint. Aber man darf nicht etwas noch darüber hinaus begehren, besonders das nicht, was man erwünscht. An eurer Stelle hätte ich z. B. Österreich-Ungarn nicht getrotzt und dem serbischen Heere nicht den Vormarsch zum Adriatischen Meere befohlen. Ich glaube nicht, wie ihr, dass in diesem Falle die Frage eures Hafens nicht einmal auf diese Weise geregelt worden wäre, wie dies jetzt tatsächlich geschehen ist.«136 Abschießend versuchte Jonescu Ristic die Bedeutung der in diesem Krieg gemachten serbischen Gewinne begreiflich zu machen: »Ihr dagegen habt euch im stillen und ohne Lärm zum Krieg vorbereitet und Siege davongetragen, die ihr euch wahrscheinlich selbst nie erhofft hattet.«
Diese Siege erregten die Serben in Bosnien, sie fühlten, dass »ihnen der künftige Kampf gegen die Muselmanen und katholischen Serben – mit anderen Worten: gegen die Regierung – ganz leicht sein wird«, schreibt der serbische Gesandte Jovanović aus Wien an Pašić. »Die serbischen Siege – das gesicherte Kossovo, wie sie sagen – sind eine unerschöpfliche Kraftquelle für alle ihre Ziele.«137
Ebenso wie Bismarck vertrat Kaiser Wilhelm II. für den Balkan die »Nicht-Intervention um jeden Preis«138. Um den Dreibund zu retten, brachte ihn Kanzler Theobald von Bethmann Hollweg (1856–1921) von dieser Position ab. Schon am 22. November 1912 erklärte der Kaiser dem österreichischen Generalstabschef Blasius von Schemua, dass Österreich-Ungarn »auf Deutschlands Unterstützung unter allen Verhältnissen voll zählen« könne.139 Das ging wiederum dem Staatssekretär des Äußeren, Kiderlen-Waechter, zu weit. Der ließ in der regierungsnahen Norddeutschen Zeitung einen Artikel veröffentlichen, in dem vor einem militärischen Vorgehen Österreich-Ungarns auf dem Balkan gewarnt wurde, was in Österreich-Ungarn zu Rückfragen, erheblichen Irritationen und verbitterten Kommentaren führte.
In der Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1912 war Bethmann Hollweg um Schadensbegrenzung bemüht: »Als wir den Kampf als unvermeidlich ansahen, haben wir vor allem darauf hingewirkt, ihn zu lokalisieren. Dies ist bis jetzt gelungen, und ich kann wohl die bestimmte Hoffnung aussprechen, daß dies auch weiter gelingen wird.« Deutschland wolle wie die anderen auch bei einer Nachkriegsregelung mitreden: »Denn an der ökonomischen Gestaltung im Orient sind wir sehr wesentlich direkt interessiert.« Zur Konfliktlösung zwischen den Großmächten finde ein lebhafter und erfolgversprechender Gedankenaustausch statt. Wenn aber »unsere Bundesgenossen bei Geltendmachung ihrer Interessen wider alles Erwarten von dritter Seite angegriffen und damit in ihrer Existenz bedroht werden sollten, dann würden wir, unserer Bündnispflicht getreu, fest und entschlossen an ihre Seite zu treten haben, – (lebhafter Beifall vom Zentrum und von den Nationalliberalen) – dann würden wir an der Seite unserer Verbündeten zur Wahrung unserer eigenen Stellung in Europa, zur Verteidigung der Sicherheit und Zukunft unseres eigenen Landes fechten.« Daraufhin ging der Kanzler auf den Konflikt zwischen der Türkei und den Balkanstaaten ein. Die deutsche Politik ziele seit Langem darauf ab, die guten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu den Balkanstaaten und der Türkei zu erhalten und zu stärken. »Wir glauben, hierdurch der Türkei manchen Dienst geleistet zu haben, ohne daß wir dabei unsere guten Beziehungen zu anderen Mächten gefährdeten. Dieser Politik, die allerdings bei Ausbruch des türkisch-italienischen Krieges gerade bei uns heftig angegriffen wurde, möchte ich es als einen Erfolg vindizieren …, daß wir uns während des Kampfes zwischen einem Bundesgenossen und einem Freunde die Sympathien beider zu erhalten gewusst haben.« Bethmann Hollweg hoffe auf die Fortsetzung und Erstarkung dieser freundschaftlichen Beziehungen.140
Der mit Haase und Liebknecht zum linken SPD-Flügel zählende Abgeordnete Georg Ledebour (1850–1947) warnte vor einer absoluten Bündnistreue und warf dem Reichskanzler vor, wenig zur Aufklärung der gegenwärtigen Situation beigetragen zu haben. Er erinnerte an Äußerungen Bülows und Wilhelms II., die seiner Meinung nach diplomatische Fehlgriffe darstellten, und an die unglückliche Tangerreise des Kaisers. Schließlich zitierte Ledebour aus dem Trinkspruch Wilhelms II. auf den Sultan am Ende seiner Palästinareise (8. November 1898): »Möge der Sultan und mögen die 300 Millionen Mohammedaner, die auf der Erde zerstreut leben, die in ihm ihren Kalifen verehren, dessen versichert sein, daß zu allen Zeiten der Deutsche Kaiser ihr Freund sein wird.« Dieser Toast habe beim Sultan wie bei den Türken den Glauben erweckt, dass sie bei Angriffen fremder Mächte auf die Unterstützung Deutschlands rechnen könnten. »Das war eine leichtfertige Festlegung Deutschlands auf eine werktätige Bundesgenossenschaft, die nicht durchgeführt werden konnte.« Ledebour ignorierte dabei wie viele andere den Umstand, dass der Trinkspruch in erster Linie von einem protestantischen Oberhaupt an ein anderes religiöses Oberhaupt gerichtet und keine Parteinahme im politischen Sinne war.
Weiter führte er aus: »Diese Versicherung hat den Sultan und hat die Türkei und hat die 300 Millionen Mohammedaner, denen Kaiser Wilhelm II. und das Deutsche Reich Freundschaft versicherten, nicht davor behütet, daß nachher Marokko französisch, Tripolis italienisch geworden ist und die Türken jetzt aus Europa so ziemlich restlos herausgeklopft wurden.«141 Hier scheint Ledebour vergessen zu haben, dass der Kaiser beim Versuch, die Souveränität Marokkos zu retten, gerade vonseiten der Sozialdemokraten heftig angegriffen wurde.
Die Ursachen der Kriege hatten, so Ledebour, ihre Wurzeln in kapitalistischer Ausbeuterei. Künftige Kriege könnten durch die Macht der Internationale verhindert werden. Der Abgeordnete Graf von Kanitz hielt das für eine Illusion und entgegnete: »Die beste Friedensgarantie ist die Einmütigkeit und Geschlossenheit eines hinter seiner Regierung stehenden Volkes.« Die jetzige Situation erinnere an das Frühjahr 1909: »Auch damals hatte Serbien im Vertrauen auf die russische Hilfe sich einen Weg nach dem Adriatischen Meere bahnen wollen, die russische Hilfe blieb aus, und obwohl die Brandfackel eines europäischen Krieges in Aussicht stand, gelang es dem Geschick unserer Diplomatie, das Feuer zu dämpfen, ehe es zu heller Flamme aufloderte.« Nun käme es darauf an, die für die Türkei unvermeidlichen Gebietsabtretungen auf ein vernünftiges Maß zu beschränken. Das könne schwierig werden, da sich der Balkanbund nicht zum Krieg gegen die Türkei verpflichtet, sondern schon im Voraus das Fell des Bären verteilt habe. Kanitz zeichnete ein Bild des Kriegsschauplatzes: »Griechenland hat Saloniki besetzt und hat offenbar die Absicht, Saloniki zu behalten, hat sogar noch den Hafen von Balona in Anspruch genommen oder wird ihn in Anspruch nehmen. In dem Bündnisvertrag zwischen den Balkanstaaten Bulgarien, Montenegro und Serbien aber heißt es, daß Saloniki den Bulgaren zufallen soll.« Nach Kanitz’ Überzeugung bestand die große Gefahr, dass nach einem Friedensschluss mit der Türkei die »hohen Verbündeten sich nachträglich in die Haare fahren, und daß hier noch ein sehr ernster europäischer Konflikt die Folge sein kann«. Auch würde sich das albanische Volk eingedenk seiner ruhmvollen Geschichte nicht aufteilen lassen. Das wäre aber die Voraussetzung für den serbischen Wunsch, einen Hafen am Adriatischen Meer zu besitzen – und zwar nicht bloß für seinen Handelsverkehr. Österreich und Italien wären sich in diesem Punkt einig und würden auch keine Teilannexion Albaniens zulassen. Kanitz zeigte Verständnis für den Wunsch Serbiens und brachte einen Vermittlungsvorschlag ein. Die Serben sollten einen Handelshafen am Adriatischen Meer erwerben und dort jeglichen Handelsverkehr abwickeln können. Damit wäre den wirtschaftlichen Wünschen Serbiens Rechnung getragen. Kanitz hatte jedoch die politischen Ziele Serbiens übersehen.142
Nur vier Tage zuvor hatte Ministerpräsident Pašić dem serbischen Geschäftsträger143 Gruitsch in London die Anweisung Nr. 219 übermittelt, mit dem britischen Außenminister Sir Edward Grey über den Wunsch Serbiens nach einem Hafen an der Adria zu sprechen und Durazzo (alban. Duressi) als Hafen vorzuschlagen. »Auf die Frage Greys, ob dieser Hafen allein aus wirtschaftlichen Gründen von uns gewünscht werde«, sei ausweichend zu antworten, »daß wir als ein junges Staatswesen für jetzt und auch noch auf lange hinaus nicht an eine Kriegsflotte denken können«.144
In der Folgeanweisung vom gleichen Tag verlangte Pašić von seinem Londoner Geschäftsträger: »Drücken Sie Grey persönlich meine lebhafteste Dankbarkeit für seine korrekte Auffassung unserer vitalen Interessen bezüglich des Ausganges zum Adriatischen Meere über serbisches Territorium zu einem Hafenplatz aus. Diesem Bedürfnis würde einzig und allein Durazzo entsprechen … welches auch einst serbisch gewesen sei.«145 Hier bewies Pašić brillante Geschichtskenntnisse. Tatsächlich war Durazzo in seiner wechselvollen Vergangenheit 1336 an Serbien gefallen, um gleich darauf von Neapel vereinnahmt zu werden. Aus Sicht Pašićs könne Serbien als Binnenstaat nur mit einem solchen Hafen auf völlige ökonomische und politische Unabhängigkeit rechnen, »da ein solcher Hafen Serbien erst den gleichberechtigten Verkehr mit anderen Staaten ermöglichen würde.«146 Träumte Pašić hier schon von einer Flottenparade in der Adria?
Auch Ledebours Vorwurf, den Österreichern willenlose Trabantendienste zu leisten, wies Kanitz zurück und zitierte den Fürsten von Bülow, der vor Jahren an gleicher Stelle auf diesen Vorwurf antwortete: »Nicht in der Ansicht auf einen territorialen Gewinn liegt unser Interesse an der Balkanfrage, sondern darin, daß wir einen loyalen Bundesgenossen, für den wir keinen Ersatz finden würden, nicht im Stich lassen dürfen.« Kanitz weiter: »Und wenn wir in einen Krieg verwickelt werden, geschieht es nicht wegen des lumpigen Stückes Küste am Adriatischen Meere, welches uns vollkommen gleichgültig sein kann, sondern es handelt sich darum, uns unseren Bundesgenossen im Dreibund zu erhalten; denn diese Bundesgenossenschaft ist für uns, wie die Dinge einmal liegen, eine Lebensfrage, eine Existenzfrage.«147
Ab 3. Dezember 1912 schwiegen die Waffen auf dem Balkan, und es begannen schwierige Friedensverhandlungen. Für das makedonische Gebiet zeichneten Bulgarien, Griechenland und Serbien als Teilungsmächte. Diese Teilung ist bis heute umstritten. Auch die Friedensverträge der nachfolgenden beiden Weltkriege revidierten das Ergebnis nicht.
Dreh- und Angelpunkt der Kriegsschulddiskussion ist der 2. Dezember 1912, wo das Deutsche Reich angeblich den Krieg beschlossen hat. Die Notizen Wilhelms II. im Brief von Botschafter Lichnowsky an Kanzler Bethmann Hollweg geben die damals herrschende Stimmungslage wieder und lassen eine andere als die allgemein übliche Interpretation zu (Abschrift vom Original, handschriftliche Anmerkungen Wilhelms an der linken Seite transkribiert) (© Abb. 11)
Die vom Reichskanzler am 2. Dezember 1912 im Reichstag gegebene Bündniszusicherung wurde von der britischen Regierung als bedrohlich eingestuft und veranlasste den Lordkanzler Richard Haldane, den deutschen Botschafter Lichnowsky ausdrücklich zu warnen: Großbritannien werde bei einem Einmarsch Österreich-Ungarns in Serbien kaum der »stille Zuschauer« bleiben können, man könne zudem keinesfalls eine neuerliche Niederwerfung Frankreichs dulden, falls Deutschland im Zusammenhang mit einem russisch-österreichischen Konflikt Frankreich angreifen würde.
Als der Kaiser den Bericht zur Kenntnis nahm, soll er außer sich gewesen sein: »England wird aus Neid und Haß gegen Deutschland unbedingt Frankreich u(nd) Rußland gegen uns beistehen. Der eventuelle Existenzkampf, den die Germanen in Europa (Österreich, Deutschland) gegen die von Romanen (Galliern) unterstützten Slaven (Rußland) zu fechten haben werden, findet die Angelsachsen auf der Seite der Slaven. Grund: Neidhammelei, Angst unseres zu Großwerdens!«148 Unter dem Eindruck des Berichts aus London berief er am zweiten Advent für 11 Uhr eine Besprechung ein, die später von Bethmann Hollweg als »Kriegsrat« bezeichnet wurde – wohl deshalb, weil ausschließlich Militär anwesend war: Helmuth Graf von Moltke (Chef des Generalstabes), August von Heeringen (Chef des Admiralstabes), Alfred von Tirpitz (Staatssekretär im Reichsmarineamt) sowie Georg Alexander von Müller (Chef des Marinekabinetts).149
Für den Chef des Marinekabinetts war das Ergebnis der Besprechung gleich null, da einem Kriegsentschluss keine konkreten Überlegungen über die diplomatischen Voraussetzungen einer erfolgreichen Eröffnung des Krieges folgten.150 Dagegen wurde nach Meinung Fritz Fischers beim Kriegsrat definitiv beschlossen, den Krieg um die Vorherrschaft in Europa zu führen, nur der Zeitpunkt sei vertagt worden. Sein Eleve John C. G. Röhl fasste noch im Jahr 2008 die Diskussion wie folgt zusammen: »Heute steht die Hauptverantwortung der deutschen und österreichischen Regierungen für die Herbeiführung des großen Krieges im Juli 1914 nicht mehr in Frage, und auch der ›Kriegsrat‹ vom 8. Dezember 1912 steht nicht als unerklärliche und scheinbar folgenlose Entgleisung eines politisch bedeutungslosen und nicht ganz zurechnungsfähigen Monarchen da … die militärpolitische Besprechung jenes Sonntagsvormittags (lässt sich) reibungslos in einen Entscheidungsprozess betten, dessen Anfänge weit zurückreichten und der schließlich im Sommer 1914 in die Katastrophe des Weltkriegs münden sollte.«151
Im Februar 1912 war der britische Lordkanzler Haldane nach seinem Berlin-Besuch mit der Erkenntnis nach London zurückgekommen, dass an der Spitze des Deutschen Reiches Chaos herrsche und eine zielstrebige Planung eines Hegemonialkrieges nicht zu erkennen sei. Wer mag der Wahrheit näher gekommen sein: der kritische Zeitzeuge oder ein nachgeborener Wissenschaftler, für den es anscheinend gar keinen Zweifel gibt? Denn Zweifel an den Ausführungen Röhls kommen erstaunlicherweise von seinem Cambridge-Kollegen Christopher Clark. Für ihn ist der von Wilhelm II. einberufene »Kriegsrat« nur die Reaktion auf die ententistische Balkanpolitik Großbritanniens. »Sie (die Beteiligten am ›Kriegsrat‹, Anm. d. Verf.) überlassen den Balkan den Russen. Sie lassen zu, dass an dieser geopolitischen Grenze eine Zündladung installiert wird. Damit schaffen sie die Verzahnung, die zum Weltkrieg führt.«152 Im Sinne der »Balance of Power« habe England bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Österreich immer als Stabilitätsfaktor in Europa gesehen. Nun sind sie bereit, so Clark, die Habsburger auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Diese Bereitschaft sei in St. Petersburg, Belgrad und Paris durchaus erkannt worden. Damit erlösche nicht nur die grundsätzliche Solidarität zwischen den Monarchien, sondern auch die Existenzberechtigung einer anderen Nation. Im Sinn dieser Politik finanzierte die Republik Frankreich die Rüstung der Monarchien von Russland und Serbiens, Clark zufolge ein riskantes Spiel: »Sie pumpen große Summen nach Serbien und machen es so zum östlichen Bollwerk der Entente-Mächte.«153