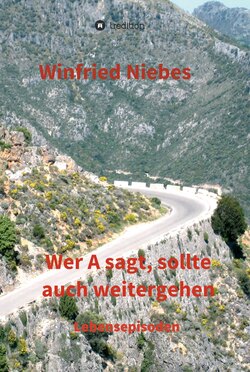Читать книгу Wer A sagt, sollte auch weitergehen - Winfried Niebes - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVerpasste Chancen
Vor einiger Zeit las ich einige Zeilen aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse.
Wie passend es doch ist, dass jede Blüte wie die Jugend welkt. Auch meine musste, ob ich wollte oder nicht, das Alter kommen lassen. Wichtig ist, jeweils zu einem Abschied bereit zu sein, einen Neubeginn zu wagen, nicht traurig zu sein, sondern tapfer.
In den verflossenen Jahren flackerten beharrlich Fragen auf, deren Antworten auf ewig ausbleiben werden. Welche Gründe lagen vor, mit den Eltern nicht öfter über die Vergangenheit und diesen verheerenden gottlosen Krieg oder die Hitlerzeit diskutiert zu haben?
War mein Vater freiwillig in das Soldatenleben eingetreten oder aufgrund welcher Beweggründe? Wollte er etwa weg aus dem Dorf? Wie oft erzählte er, dass bereits früh morgens die Pflicht auf der Wiese rief, um mit der Sense das noch taufrische Gras zu mähen. Niemand meiner oder der folgenden Generation mag sich jene Arbeit vorstellen und zwar noch vor Schulbeginn. Nicht mal an einem freien Samstag, falls schulfrei war.
Welche Meinung vertrat er damals, noch keine dreißig Jahre zu Kriegsbeginn, über die Juden? Dass er auf der niederländischen Insel Terschelling als Funker seine Aufgabe erfüllte, hat er erzählt. Wo und in welcher Funktion mein Vater außerdem operierte, wurde nie diskutiert. Gefragt hatte ich auch nicht. Oder alles vergessen? Ich hoffe inständig, dass er nicht direkt als Täter wirkte. Es dürfen auch nicht alle Soldaten als Täter verurteilt werden. Irgendwie oblag sehr vielen jedenfalls die Opferrolle.
Ich höre noch heute manch entschuldigend klingenden Sätze wie „Hitler hat die Arbeitslosen von der Straße gebracht. Der Autobahnbau brachte für viele Menschen Beschäftigung und Brot auf den Tisch“.
Ob ihm bekannt war, dass einige bekannte große deutsche Unternehmen wie die Gussstahlfabriken von Krupp (Alfred Krupp wurde verurteilt und erhielt auf Veranlassung der Amerikaner während des Koreakrieges Amnestie), die tödliche Chemiefabrik Bayer AG oder Siemens-Fabriken KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene sowie Ostarbeiter einsetzten? Es sollen bis zum Herbst 1944 bis zu fünfzigtausend Zwangsarbeiter gewesen sein. Leider konnten die Alliierten im April 1945 nur noch vierzigtausend Menschen befreien.
In späteren Jahren kam mir hin und wieder eine von mir damals nicht gestellte Frage in den Sinn: „Weshalb habe ich ihn nie konkret zu seinen Einstellungen zu den massenhaft ermordeten Juden befragt?“ Mir bleibt daher nur das Bemühen, mit größtmöglicher Intensität zu versuchen, im Langzeitgedächtnis damalige Diskussionen zu reflektieren. Eine bedeutende Grundsatzfrage an ihn tritt aus undurchsichtigen und schwachen Gehirnkammern innerhalb dieser von mir geführten Diskussion zutage: „Weshalb habt ihr Soldaten denn so lange im Krieg wie Statisten zugeschaut? Wieso habt ihr euch nicht gegen das Morden von vielen Tausend Menschen gewehrt? Seid ihr denn völlig blind oder taub gewesen und verblendet durch die Propaganda des einflussreichen Hitlervertrauten Goebels?“ Ich hätte weiterfragen können: „Warum habt ihr später so getan, als sei nichts geschehen? Niemals etwas über die Zeiten erzählt?“
Heute weiß ich, dass eine solche Verdrängung auch zu späteren Zeiten und an anderen Orten geschah.
Manchmal hatten seine Worte einen für meine Ohren negativen Nachklang: „Die wollten immer Geschäfte machen.“
Ich hätte darauf antworten sollen: „Meinst du, eine Geschäftstätigkeit ist eine negative Eigenschaft?“
Seine Antwort könnte ich mir jetzt vorstellen: „Die haben nicht richtig gearbeitet.“
Was er als Arbeit interpretierte, war für meinen Papa keine Frage. Nach seinem Reden zählte hierzu nur die körperliche Arbeit. Kein Wunder, dass mancher mir Spötteleien zurief: „Du mit deiner linken Flutsch.“ Als Linkshänder war es schon ein Problem, von körperlich tätigen Männern im Alltag akzeptiert zu werden. Allerdings sind derartige Sätze auch heute keine Seltenheit. „Wer im Büro sitzt, ist ein Schreibtischtäter und arbeitet nicht“, ist hier und da zu hören. Zu entgegnen wäre heute andererseits: „Weißt du, Geschäftstätigkeit und Erfolg können gleichfalls durch harte Arbeit gelingen.“ Der Geist muss beweglich sein, Ideen müssen auf praktischen Bedarf geprüft und dann realisiert werden. Die Geschichten in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär fanden nicht nur wegen günstiger Zeitpunkte oder aus Zufall statt. Ideenreichtum führte ebenso zum Erfolg wie Gelegenheiten mit riskantem Einsatz zu nutzen.
Eine andere Antwort von Vater zu den eventuellen Fragen zur damaligen Zeit summt sehr schwach in meinen Ohren: „Du redest mit deinem jugendlichen Unverstand über längst vergangene Zeiten. Wir wären sofort vom nächsten hitlertreuen Offizier erschossen oder von der Gestapo verhaftet worden. Mit Meuterern und Fahnenflüchtigen wurde kurzer Prozess gemacht. Als einfacher Soldat hatten wir erhebliche Sorge vor Spionen in unserer Truppe.“
Anscheinend überzeugte mich seine Aussage. Mein Versuch zu einem weiten Rückblick in seine Jugendzeit kann nur dem Charakter eines Ratespiels gleichkommen. Mir schwant, dass er Ende der 1930er Jahre sein äußerst schweres Leben zu Hause möglicherweise verändern wollte. Vielleicht verfiel er wie unzählige Menschen, angestachelt durch Figuren wie Goebbels, Göring, Himmler, Heß und Speer mit ihren propagandistischen Fähigkeiten, die eine große Zukunft für Deutschland prophezeiten, in Blindheit und hoffnungsvollen Glauben an bessere Zeiten.
Die Forschungsgruppe Wahlen erstellte im Jahr 1996 eine Umfrage zum Wissen der Deutschen über die Verfolgung der Juden und deren Ermordung in den Gaskammern. Ob meine Eltern irgendwelche Kenntnisse darüber hatten?
Mit besonderem Interesse, aufkommendem Zorn, Wut und Entsetzen nahm ich ausgiebige Darstellungen im Prümer Landboten zur Flüchtlingsgeschichte der Juden im Eifelraum während der NS-Zeit auf. Der umfangreiche Artikel verdeutlicht in der Eifelgeschichte die Parallele mit der im 21. Jahrhundert nicht zu übersehenden „Flüchtlingskrise“ mit Not, Verfolgung und Verschleppung. In der Eifel mit ihrer grünen Grenze zu Belgien entwickelten sich Fluchtmöglichkeiten über die ehemalige Bahnstrecke, die „Vennbahn“, zwischen Aachen und Ulflingen (frz.: Trois- vierges) in Luxemburg. Bahnanschluss bestand zwischen Prüm und Jünkerath. Neben dem für manche Grenzbewohner einträglichen Schmuggelgeschäft mit Kaffee und Zigaretten wurde der Menschenschmuggel durch hilfsbereite Menschen, welche ein hohes Risiko auf sich nahmen, organisiert. Politiker forderten bereits im Jahr 1933 eine verstärkte Kontrolle durch SA-Männer. Die Pogromnacht im November 1938 verstärkte bei der jüdischen Bevölkerung den dringenden Wunsch, mit Schleusern nach Belgien und in andere Länder zu fliehen. Berichtet wird über die Flucht eines kranken jüdischen Mädchens aus der Eifel bis nach Liverpool.
Wenn ich über die verzweifelte Flucht unbegleiteter Judenkinder lese, muss der damals dringende Appell des englischen Premierministers Lord Baldwin um die Wende zum Jahrzehnt 2019/2020 ohne Abänderung wiederholt werden: „Ich bitte Euch, den Opfern dieser Katastrophe beizustehen, die keine Naturkatastrophe ist, kein Erdbeben und keine Überschwemmung, sondern eine Katastrophe vom Ausbruch von Unmenschlichkeit der Menschen gegen ihre Mitmenschen.“ Im Grenz-Echo (damals ein Publikationsmedium) wurde 1939 über das Problem der jüdischen Flüchtlinge berichtet. Besonders dokumentiert las ich in dem umfangreichen Beitrag von der großen Aufnahmebereitschaft – im Gegensatz zu anderen Nationen – der belgischen Bevölkerung. In Schüller, nur zwanzig bis fünfzig Kilometer vom deutsch-belgischen Grenzgebiet Losheimergraben oder Winterspelt entfernt, müssen doch Informationen über das damalige Geschehen bekannt geworden sein.
Hat hier denn niemand die diskriminierenden Zeitungsartikel der gleichgeschalteten NS-Presse gelesen? Die erschütternden Szenen der Flüchtenden in der Winterzeit ab Dezember 1938 im deutsch-belgischen Grenzgebiet mit schier unüberschaubaren Wäldern und Mooren der Eifel und Ardennen können nach meinem Dafürhalten den Dorfbewohnern auf dem Berg bei Jünkerath nicht verborgen geblieben sein. Der Ort war doch nicht von der Außenwelt abgetrennt, sodass entweder durch Zeitungen oder zumindest „der stillen Post“ das Geschehen publik werden musste. Sollte Vater von alldem nie etwas gehört haben?
Seine mögliche Kenntnis zur damaligen Situation verbleibt für mich dauerhaft ein Geheimnis. Selbst wenn zu den Menschen auf irgendeine Art Informationen gelangt sein sollten, will ich gerne annehmen, dass diese längst nicht alles toleriert oder gewollt haben. Vielleicht wollten oder mussten sie in der Nachkriegszeit wegen anderer Sorgen manches mit aller Gewalt verdrängen?
Nun lese ich bei Wikipedia, dass bei Befragungen der Alliierten ab 1945 viele Deutsche stereotyp antworteten, von den NSMassenmorden nichts gewusst zu haben, daher verstehe ich vielleicht Vaters „Ausflüchte“. Damals galt dies den Beobachtern als Schutzbehauptung, die eine befürchtete Bestrafung abwehren sollte oder als psychisch selbstheilende Verdrängung. Im Frühjahr 2020 warfen die Medien die Frage auf, weshalb die deutschen Bischöfe nicht gegen die NS-Herrschaft protestierten. Die Kirchenzeitung widmete dem Thema einen großen Artikel mit einer Diskussion zur Frage: „Wann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen?“ Der Historiker Christoph Kösters antwortet dort ausführlich zu dieser grundsätzlichen Frage. Mir scheint, es gab bei den Kirchenvertretern erheblich unterschiedlich Auffassungen zum richtigen Weg. Jedoch setzten viele Priester ein persönliches Zeichen gegen das herrschende Regime, ansonsten hätten wohl kaum mehr als vierhundert Priester im Konzentrationslager Dachau ihr Leben lassen müssen.
Leider musste ich im Laufe der letzten Jahre erfahren, dass es in der Bundesrepublik der Sechzigerjahre gang und gäbe war, die früheren Zeit totzuschweigen. Eine Aufarbeitung der schrecklichsten Zeit des 20. Jahrhunderts unterblieb. Da viele Männer mit profunden Verwaltungs- und juristischen Kenntnissen als Soldat ihr Leben ließen, erfolgte der Einsatz früherer Nazis in Behörden und wo ebenfalls die früheren Akteure zum Aufbau der vom Krieg heimgesuchten Strukturen fehlten, schien eine willkommene Gelegenheit zu sein. Sie ermöglichte das eigene Verheimlichen. Ich konnte nicht begreifen, dass Kommunisten Nazis Unterschlupf in Brot und Arbeit brachten.
Doch auch zu anderen Zeiten, an anderen Orten sind solche kollektiven Verdrängungen zu beobachten. Eine Rundfunksendung des Deutschlandfunks am 05. Oktober 2019 verdeutlichte mir dreißig Jahre nach der Wende das Funktionieren der aktiven Verdrängung von ungeheuerlichen Geschehnissen. Wieso ist es möglich, dass manche Bürger in Torgau zu dem grausamen, menschenverachtenden und rechtswidrigen Jugendwerkhof nichts hören oder nicht darüber diskutieren wollen? Die Journalisten stellten ein ablehnendes oder schweigendes Weitergehen fest. Manch einer will heute weder Informationen über den Missbrauch an heranwachsenden Mädchen durch den damaligen Direktor dieses „Kindergefängnisses“ hören noch darüber etwas wissen wollen. Wie darf ich das deuten? Leben jene jetzt nur notgedrungen, da sie hier halt leben, im neuen rechtsstaatlichen Staatsgefüge und trauern dem abgelösten System nach?
Gleichfalls könnte ich oft aus den mir bekannten jugendlichen Erfahrungen meiner Eltern im Hinblick auf die im aktuellen Jahrhundert eingetretenen weltweiten politischen Verhältnisse müde und kraftlos werden. Wie wird das enden, wenn sogar junge Menschen mit Nazi-Symbolen auf der Straße hetzen oder sogenannte Reichsbürger unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aus den Angeln heben wollen? Wie hoch ist die Gefahr eines neuen, eines deutschen jungen Hitlers? „Der Geist des Flügels wird lebendig sein, in dieser AFD …“ ist am 30. April 2020 in einem Bericht des Deutschlandfunks über eine Rede von Björn Höcke zu hören. Selbst wenn die Flügelauflösung erfolgen sollte, sind Menschen mit dieser Gesinnung im Staat und können zukünftig großes Unheil anrichten.
Bei allen Problemen, weltweit, sollten wir Wohlbefinden spüren und heilfroh sein, in der Bundesrepublik Deutschland leben zu dürfen. Unsere Demokratie steht (noch) auf festem Fundament. Eine gesteigerte Hoffnung beseelt mich, dass die Menschen in „meinem“ Deutschland die Zeichen der Zeit früh genug erkennen werden und vielleicht kurz vor Toresschluss jeglichen Radikalismus in der Wahlkabine abzuwenden wissen.
Vielleicht habe ich aber auch deshalb so wenig gefragt, weil ich des Themas überdrüssig war. Jahrzehnte mochte ich absolut nichts über die Naziherrschaft hören und sehen. Eine gewisse Portion Bedauern erreicht mich nun, die vor mehr als zwanzig Jahren von ARTE in mehreren Teilen ausgestrahlte Dokumentation von Guido Knopp20 seinerzeit völlig außer Acht gelassen zu haben.
Unweigerlich ergreift mich der Gedanke, aus unerklärlichen Gesichtspunkten die Kriegszeiten lieber im Schrank der Geschichte verschlossen zu haben. Recht lange Zeit benötigte ich, um mich für die Geschehnisse der 30er und 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu interessieren. Aber es ist nie zu spät – erst nach dem Tod bleibt alles im Dunkel. Nunmehr rumort es intensiv in meinem Gehirn der Frage: War ich kein Getreuer meines Vaterlandes, kein Patriot?
Weshalb schaute ich mit übersteigerter Begeisterung Filme über die Erfolge der westlichen Siegermächte? Mehrfach inhalierte ich die Ereignisse in den Filmen „Die Brücke von Remagen“ oder „Die Brücke von Arnheim“.
Letztendlich könnte ich zu meinem Ich von einer Art Erleuchtung sprechen, die dazu führte, dass sehr viele Jahre später bei mir ein Informationsbedürfnis einsetzte. Details über jene Filme produzierten eine neue Erkenntnis über gravierende Sachverhalte. Der erstmals im November 1969 in der Bundesrepublik gezeigte Streifen über den legendären ersten Rheinübergang über die Ludendorffbrücke durch Heeresverbände der amerikanischen Streitkräfte verursachte kein Mitleid mit dem Schicksal deutscher Soldaten. Eher betrachtete ich die Aktion zu Beginn des Jahres 1945 als Erlösung.
Obwohl ein Krieg das Grausamste für die Menschen ist, (wir erleben täglich die schrecklichen Bilder der weltweiten Kriege und Menschenverfolgungen) verstärkte sich bei mir ein ausgeprägtes Interesse, sogar Wohlgefallen an US-Kriegsfilmen, worin ich deren Sieg zu sehen bekam. Die GIs waren erstaunt und konnten die aus dem Ersten Weltkrieg stammende Ludendorffbrücke ohne Schwierigkeiten überqueren. General Dwight D. Eisenhower soll damals gerufen haben: „Die Brücke ist ihr Gewicht in Gold wert.“ In späteren Jahren wurde immer vermittelt, wie froh wir sein durften, dass die Alliierten uns von dem grausamen Regime befreiten. Heute gibt es zu meinem Entsetzen so manche Verklärer, welche ignorieren und den Holocaust21 leugnen. Der filmisch dargestellte Erfolg der Alliierten zeigte eine große Portion Gerechtigkeit. Filme mit Erfolgen des Naziregimes bescherten mir hingegen nur Entsetzen. Ein Schauer lief mir erst recht über den Rücken, als in dem Film die Landung der westlichen Befreiungsallianz in der Normandie zu sehen war. Die jungen Soldaten wurden wie Freiwild durch deutsche Soldaten von der Küste aus abgeschossen.
Damals überschattete völlig Blindheit meine Augen und die Ohren hörten nur wenig über die Kriegsmaschinerie der Alliierten. Von den überaus grausamen Bombardements der britischen Bomberflotte, welche im November 1944 tausendeinhundertachtundachtzig Spreng- und mehr als hundertzwanzigtausend Brandbomben auf Jülich und fast einhundertfünfzigtausend Sprengbomben auf Düren warf, fehlte mir jegliche Information. Diese Städte wurden innerhalb von nur einer halben Stunde komplett zerstört,22 dort verloren mehr als siebentausend Menschen ihr Leben. Für die damaligen Kleinstädte eine hohe Zahl. Fast täglich hören wir alle von den Bombardements auf die Zivilbevölkerung in Syrien. Nur ältere Menschen vermögen sich an die massenhaften Bombenabwürfe der britischen Royal Air Force unter der Führung deren Oberbefehlshabers Sir Arthur Travers Harris, genannt Bomber-Harris23 (erst im Jahr 1984 verstorben) zu erinnern. Unter seinem Kommando wurden beispielsweise die Städte Frankfurt am Main am 22.04.1943, Leipzig am 04.12.1943, Dresden am 13./14. Februar 1945 – just vor fünfundsiebzig Jahren während meines Buchentwurfs – und Würzburg am 16. März 1945 mit vier- bis fünftausend Toten im Bombenhagel zerstört. Sein erklärtes primäres Ziel beinhaltete bewusst, die zivile Bevölkerung und Infrastruktur zu treffen. Logisch mag es klingen, dass er die Moral und den Widerstandswillen der deutschen Bevölkerung brechen wollte (sogenanntes Moral Bombing). Für ihn war es die Antwort auf die „naive Vorstellung der Nazis, dass sie jeden anderen nach Belieben bombardieren könnten und niemand würde zurückbomben“. In seinen Memoiren schrieb er sogar: „Trotz allem, was in Hamburg geschehen ist, bleibt das Bomben eine relativ humane Methode.“
Sehr verwundert war ich über die Drehorte der von mir gern gesehenen kriegerischen Filme, Prag und Dave an der Moldau in Tschechien. Trotz der Schilderung der tatsächlichen Geschehnisse des Jahres 1945 sehe ich keine Minderung der Filmqualität wegen der nicht authentischen Orte. Dies ist und scheint eine vielfache Praxis in Filmen zu sein. Später erfuhr ich, dass die von mir viele Jahre so beliebten Wild-West-Filme im heutigen Kroatien, an den Plitvicka jezera (Plitwicern Seen) produziert wurden.
Jedem Leser dürfte der Name Peter Altmeier bekannt sein. Ich denke aber nicht an den aktuellen Bundes-Wirtschaftsminister, sondern seinen Namensvetter, den ehemaligen Rheinlandpfälzischen Ministerpräsidenten. Er war der Landesvater bis zu meinem Abschied im Rathaus Stadtkyll im Herbst 1969. Auch in der Schule war uns von ihm berichtet worden. Altmeier gehörte zu den zwölf Länderchefs, welche im Juli 1948 im Hotel „Rittersturz“ in Koblenz zu einer Konferenz einluden. Die „Koblenzer Beschlüsse“ plädierten für die Konstituierung eines Weststaates der drei Westzonen; gleichwohl als Provisorium (Hinweis: spätere Präambel im Grundgesetz). Möglich war dies nur aufgrund der „Erlaubnis“ der drei Besatzungsmächte USA, Großbritannien und Frankreich, welche Bedingungen zum Zusammenschluss zu einem „Weststaat“ formuliert hatten.
Mit der nun bereits seit einem Jahrzehnt verstorbenen Mama sprach ich häufig über den Untergang der Kommunisten in der DDR und dass es schade wäre, dass mein Vater das nicht mehr erleben durfte. Seine Meinung hatte mich, ohne mir dessen bewusst zu sein, stark geprägt und völlig gegen alles, was irgendwie nach Sozialismus und Kommunismus riecht, gestimmt. Gerne hätte ich ihm nach der Wende erzählt, wie sich mein Berufsalltag und mein Leben in Leipzig vollzogen. Wenn ich intensiv überlege, haben wir uns damals nicht ausführlich zum Sozialismus oder Kommunismus unterhalten. Diese Systeme waren eben nicht gut wie das in Westdeutschland. Ich denke, er war überzeugt, dass die politische Ideologie und Weltanschauung in der DDR nicht gut sind für ein Volk. Wenn ich dementgegen die Forderungen Gleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit betrachte, sollte ein Sozialismus erstrebenswert sein. Aber in welchem Staat der Welt funktionierte mit diesen Kriterien bisher ein Sozialismus? Lehrte uns die Geschichte nicht, dass die Mächtigen versuchten, alles Gute für sich zu ergattern? Beispiele erscheinen mir überflüssig. Hätte unser Familienoberhaupt zumindest nicht noch ein halbes Jahr mit dem Sterben warten können, um die Wende zu erfahren?
Meine intensive Meinungsbildung wurde auch durch die westdeutsche Presse zum politischen System der DDR geprägt. Mich interessierte, was jenseits der Grenze geschah. Ob mich mein Vater von oben im Himmel sehen kann und zu meinem weiteren Lebens- und Berufsweg applaudiert hätte?
Nachdem mein Vater bereits mit achtundsechzig Jahren verstarb, durfte meine Mutter fünfundachtzig Jahre alleine in dem großen Haus leben. Viele Jahre nach seinem Tod stand ich irgendwann mit einem Gebet vor seinem Grab und dachte an die Verse von Ringelnatz:
„Ach steh noch einmal auf ins Leben,
Du toter Papa!
Der Krieg ist aus.
Dann hat sich viel begeben.
Ob du wohl weißt, was mir geschah?“
Gruselig war mir vor seinem Grab bei der Vorstellung, dass sein Körper vielleicht schon von Würmern verzehrt wurde. Solche Situationen brachten bei mir die ersten Überlegungen zur späteren Bestattungsart.
20 Lesehinweis
21 Lesehinweis
22 Lesehinweis
23 Lesehinweis