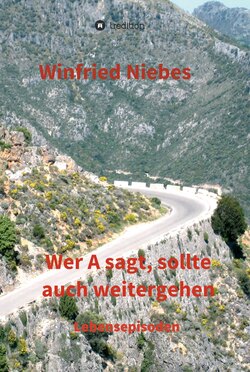Читать книгу Wer A sagt, sollte auch weitergehen - Winfried Niebes - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеZugreise ins Unbekannte
„Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“, sang Christian Anders im Jahr 1972. In dem fast vergessenen Song sehe ich einen zutreffenden Start für meine Erinnerungen an den Wegzug aus den Eifelgefilden Ende August des Jahres 1969.
Zwar hatte ich aufgrund der Grenzlage meiner Heimat bereits Ausflüge nach Luxemburg, Belgien und Elsass-Lothringen gemacht, aber nur ein einziges Mal entferntere Regionen kennengelernt. Es war im Jahr 1967, als ich mit Eltern und Schwestern in Österreich am Attersee herrliche Urlaubszeit erlebte.
Nicht nur durch die Abdankung der Kaiserkrone durch Lothar I ist mein ehemaliger Wohnort bekannt. Sogar mein früherer Berufsschulschort Prüm wurde im Spiegel im Jahr 2017 erwähnt. Dort lautete die Samstagsfrage: „Wozu braucht Tesla deutsche Ingenieure?“ Der TeslaGründer Elon Musk hat viel erreicht. Der US-Konzern kaufte ein Unternehmen in Prüm, die Zulieferfirma Grohmann Engineering. Somit wurde diese ehemalige Kreisstadt überregional, vielleicht sogar weltbekannt.
Nun sollte ich also meine vertraute Umgebung verlassen. Das qualmende Dampfross mit acht voll besetzten Wagen setzte sich aus dem zwei Kilometer entfernten Bahnhof Jünkerath auf Bahnsteig 2 langsam, überaus langsam in Bewegung. Ich erlebte dies schon wie eine Fernreise. Die vielen Pendler, Studierenden und sonstigen Passagiere zog es, den Gesichtern nach zu urteilen, teils mit Freude, teils mit Widerwillen, in das große Köln. Die gleiche Situation hätte als Bild jeden Sonntag gemalt werden können.
Damals zählte die Rheinstadt noch keine Million Einwohner. Ein Jahrzehnt später wurde im Zuge der kommunalen Neugliederung durch politische Entscheidungen ein großes kommunales Gebilde konstruiert; trotz heftiger Gegenwehr vieler.
So saß ich mit meinem Koffer auf den roten Kunststoffsitzen im überquellenden Abteil und war bis in die Haarspitzen angespannt und aufgeregt wegen der auf mich zukommenden neuen, unbekannten und völlig fremden Umgebung und vermutlich anderen Arbeitswelt. Dreiundzwanzig Jahre war ich alt, hatte eben den Abschied meines Vaters vom Sohn erlebt.
Ja, er weinte auf dem Bahnsteig – ich sah vor mir seine unmännlichen Tränen auf den vom Bluthochdruck geröteten Wangen kullern. Lange mochte er nicht, dass ich es sehe, winkte nochmals, drehte sich rasch um und verschwand schnell aus meinen Augen. Er ahnte sicher, was ich noch nicht wissen konnte, dass meine Reise durch die Lande und kommenden Zeiten begonnen hatte.
Eine besondere Anspannung beherrschte in den nächsten drei bis vier Stunden bis zur Ankunft in der Kreisstadt Gevelsberg den ersten Akt meines jugendlichen Abenteuers. Vom Telefon meiner Eltern aus hatte ich bereits in der Jugendherberge ein Zimmer bestellt. Von dort beabsichtigte ich, mit dem Zug oder Bus Ennepetal zu erreichen.
„Was wird mich erwarten? Wie sind die Menschen in Westfalen? Tatsächlich stur, wie so dahergeredet wird?“
Ja, das waren meine bestimmenden Gedanken, als die Dampflok schnaufend und Massen von dickquellendem grauem Qualm aus dem Schornstein prustend den Aufstieg hoch Richtung Schmidtheim schaffen musste.
Dieser Ort ist wie mein ehemaliger Wohnort bereits sehr alt. Die Römerstraße von der Mosel quer durch die Eifel bis zum Rhein berührt Schmidtheimer Gemeindegebiet, nicht weit entfernt finden sich Reste einer römischen Bebauung. Die Franken besiedelten nach und nach die fruchtbare Blankenheimer Kalkmulde, zu der Schmidtheim gehört. Die Orte Dahlem und Baasem wurden vermutlich im 7. Jahrhundert als fränkische Siedlung gegründet. Während meiner Volksschulzeit zeigte ich besondere Aufmerksamkeit zu Themen der eigenen Region sowie insgesamt zum Rheinischen Schiefergebirge; aber die deutschen Landschaften weckten meine Neugierde. Allerdings sind mir Lehrinhalte zu Bodenschätzen und Geologie fremd geblieben und ich musste mich jetzt im Schrifttum informieren. Ich belas mich zur Verarbeitung von Eisen in der Eifel und lernte über die Verhüttungsanlagen im fünften Jahrhundert v.Chr. während der Eisenzeit. Danke sagen darf die Eifel den Römern, welche nicht nur den Weinanbau nach Mitteleuropa „beförderten“, sondern dieses Mittelgebirge zu einem bedeutenden Wirtschaftsraum entwickelten.
Daher ist es nachvollziehbar, dass infolge Eisenerzvorkommen, der Verhüttung sowie der Bearbeitung des Eisens dem heutigen Schmidtheim als Siedlung irgendwann der Name „Schmiedeheim“ zukam.
Es war ein warmer Endsommertag. Das Fenster auf der rechten Seite hatte ich geöffnet, um unterhalb der Bahnstecke in Glaadt meiner Schwester zuwinken zu können. Das Haus und der große Garten waren wunderbar einsehbar. Die teilweise bereits herbstlich gefärbten Blätter an den vorbeihuschenden Bäumen hätte ich in der engen Schlucht ab dem Ortsteil Glaadt bei geöffnetem Fenster fast greifen können. Allerdings stand mir nicht der Sinn nach Blättern. Die Reize des nahenden Herbstes interessierten mich heute nicht. Bisher hatte ich in der heimischen Idylle die tausendfache Farbenpracht genossen, sodass mir der Herbstduft sogar auf irgendeine Weise in meine Nasenflügel kroch. Wie gut hatte ich in Erinnerung, wenn nach sonnendurchfluteten Tagen im letzten Herbst die heftigen von Westen herannahenden Stürme an den hohen Giebelwänden heulten und vorbeirauschten. Keinen Hund wollte man an solchen Tagen vor die Tür schicken, zumal noch einhergehende Regengüsse auf das karge und felsige Erdreich prasselten. Wie dagegen würden meine Tage in diesem Herbst aussehen? Ich wusste es nicht. Heute galt es für mich, loszulassen.
Nach einigen Kurven bergan sah ich den dicken schwarzen Qualm aus dem Schornstein der Lok steigen. Unbedingt musste ich nun meinen Kopf zurückziehen, das Fenster schließen, damit der beißende Ruß nicht in meine Augen dringen konnte. Äußerlich gelassen beobachtete ich die vorbeiziehenden und sich auflösenden schwarzen Rauchschwaden, es beschäftigte mich ein Gedankengewirr.
Um die Steigung ab Jünkerath von vierhundertdreißig auf eine Meereshöhe von fünfhunderteinundvierzig Metern zu bewältigen, musste das große Feuerloch mit einer Menge Steinkohle oder Koks gefüttert werden, damit volle Kraft entwickelt wurde. Die feuerrote Glut bescherte dem Heizer ordentliche Schweißausbrüche. Ich erinnere mich, dass mein Vater, Heizer auf Dampfloks, des Öfteren beim Abendessen über die zu schaufelnde Menge erzählte. Wie das so ist, als Kind gelangen die Worte in die Ohren und vielleicht verbleiben ein paar rudimentäre Reste für das Langzeitgedächtnis.
Mein Zug, aus Trier oder Saarbrücken in Blankenheim eingetroffen, sollte mich zunächst in die rheinische Hochburg des Karnevals bringen, wo ich in einen anderen Zug umsteigen musste. Die Station „Nirgendwo“ stellte für mich „Ennepetal in Irgendwo“ dar. Deren geografische Lage hatte ich nach Bewerbungszusage nur im Atlas auf der Karte ausspähen können.
Doch zunächst sollte mich mein Reiseweg nach kurzem Aufenthalt in das westfälische Gevelsberg führen, wo eine Übernachtung vonnöten war, da ich mein Ziel an diesem Tag nicht mehr erreichen konnte. Der Name der Stadt löst bei mir heute noch einen leicht bitteren Nebengeschmack aus.
In der Zentrale der Jugendherberge wurde mir die zweite Etage mit Nummer siebzehn genannt. Gespannt wie ein Flitzebogen schleppte ich meinen Koffer und eine Umhängetasche – damals gab es sogenannte Campingbeutel – in das genannte Zimmer. Viel später erfuhr ich im Sachsenland, dass dieses Wort zum typischen DDR-Wortschatz gehörte; gemeint war dort ein kleiner Rucksack. Als ich in den Raum schritt, bemerkte ich erschrocken, dass bereits ein fremder Mann auf einem zweiten Bett seinen Koffer auspackte und den neben ihm stehenden schmalen Kleiderschrank befüllte. Meine Unerfahrenheit hatte mich bei der Buchung nicht auf die Idee gebracht, speziell ein Einzelzimmer zu bestellen. Sofort musste ich mich auf die neue Situation einstellen. Den Koffer entleerte ich rasch auf dem Bett in Türnähe; ebenso die Umhängetasche mit dem Rasierapparat und einigen Waschutensilien. Er hatte für sich das Bett unmittelbar an der Fensterfront auserwählt. Wir sprachen über dies und jenes. „Gute Nacht“, wünschten wir uns gegenseitig und der Schlaf hätte einsetzen dürfen. Mein Nachbar schlief, während ich noch grübelnd über die gemeinsame Nacht mit offenen Augen an die Decke blickte. Der Mond schien durch die dünnen Gardienen, sodass die Lampe in der Zimmermitte kleine Schatten an die Decke warf. Jetzt schien mein mehrjähriges Privileg, allein schlafen zu dürfen, zu enden. Irgendwann hatte sich der Mond hinter den Wolken versteckt. Ich hätte keine Gestalt vor meinem Bett gesehen; so stockdunkel war es im Raum. Es war jedoch nicht mucksmäuschenstill. Mein Nebenmann schien Waldarbeiter zu sein. Einige Festmeter des harten Eichenholzes hatte der Ärmste sägen müssen. Nichtstun war angesagt, weder Schlafen noch Umherwandern erschien als Möglichkeit. Am Morgen begrüßte jener mich fröhlich, er war schließlich im Gegensatz zu mir ausgeschlafen und munter. Mein für ihn unerwartetes Stöhnen aus meinem Munde über sehr unruhigen Schlaf hörte er sich an. Ob er, selbst noch mit schläfrigem Gesicht, meine müden Augen erblickte, habe ich nicht nachgefragt. Selbstverständlich haben Schnarcher kein Verschulden, für mich bedeutete es eine Qual.
„Ich kann die nächste Nacht bei allerbestem Willen hier nicht bleiben“, sagte ich ihm, „ich muss sehen, was möglich wird. Meine wenigen Habseligkeiten packe ich rasch und versuche, den nächsten Zug oder Bus zu erreichen.“
Mein Bettnachbar ist mir im Laufe der Jahrzehnte nie mehr begegnet. Obwohl ein chinesisches Sprichwort lautet: „Sei freundlich, wenn du jemanden das erste Mal triffst, du triffst ihn ein zweites Mal.“ Die Peinlichkeit stelle ich mir vor, wenn auf dem Weg zur Vorstellung böse Worte auf der Straße fallen und dann stehst du vor dem möglichen künftigen Chef. Große Hoffnung keimte in mir, am ersten Arbeitstag Hilfe zu einem ruhigen Bett zu erhalten.
Sofort nach Ankunft im Rathaus in Ennepetal führte mich jemand aus der Personalabteilung in die Tiefbauabteilung, meine künftigen Arbeitsumgebung. Dort lernte ich eine von Gestalt kleine und nach dem ersten Eindruck nicht überhebliche, freundliche Person kennen, meinen künftigen Abteilungsleiter. Ein weiterer Kollege, der für mich mittelalterlich erscheinende Stellvertreter aus Ostfriesland, fühlte sich hier in Westfalen nicht wohl und fand bereits während der ersten Wochen nach meinem Eintritt eine Chance in seinen früheren heimatlichen Gefilden. Die Vorstellungsrunde ergänzte sich um einen fast gleichaltrigen jungen Kollegen und eine ältere Sachbearbeiterin. Sie stand etwa fünf Jahre vor ihrem Rentenbeginn, das schien mir fast der Grund zu sein, ihre grauen Haare nicht besonders zu frisieren. Nun bekam ich einen ersten Eindruck zu meinem künftigen Arbeitsbereich.
Oh, wie viele Steine purzelten von meinem Herz, als nach mir unendlich lang erscheinender Zeit der dortige Beigeordnete aus der Abteilung von meiner Notsituation erfuhr und eine Lösung andeutete.
„Herr Niebes, ich bringe Sie heute Nachmittag zu Freunden. Sie werden ihnen nach meiner telefonischen Absprache im Obergeschoss des Hauses ein möbliertes Zimmer zur Verfügung stellen. Dort werden Sie unterkommen; nehmen Sie gleich Ihre Sachen mit. Ruhe werden Sie dort finden, denn die Gärtnerei grenzt an den städtischen Friedhof.“
Dieses Gelände verursachte bei mir keine Furcht. Ich habe schon Menschen kennengelernt, welche um Mitternacht vor Angst vor aufsteigenden Geistern keinen Sparziergang dorthin wagen würden. An den mächtigen Sonnengott Re aus der altägyptischen Religion, viele Jahrhunderte vor christlicher Zeit, der des Nachts durch die Unterwelt fahre und die Toten erleuchte, glaubte ich wirklich nicht. Im 20. und 21. Jahrhundert gibt es sogar noch Menschen, welche sogar in bestimmten Wolkenformationen fremde Mächte mit Botschaften erkennen, solches Denken lag und liegt mir fern.
Nach Dienstschluss durfte ich meine in einer Ecke im künftigen Büro abgestellten Reiseutensilien aufnehmen und in seinem Auto die Reise zur Gärtnerei antreten. Gesagt, getan.
Ich schließe meine Augen und sehe mich vor dem stattlichen Zweifamilienhaus, links von der großen Beerdigungsstätte an einer Sackgasse gelegen. Alles macht einen picobello Eindruck. Es ist bereits später Nachmittag und die im Vorhof sichtbaren Gartengerätschaften sind ordentlich platziert. Na, da bin ich mal gespannt, was die Leute zu mir sagen werden. Etwas sonderbar ist mir schon zumute, nun so plötzlich vor ihnen zu stehen und um Einlass zu bitten. Aber ich hatte doch einen sehr guten Fürsprecher.
Wie von Westfalen allgemein erwartet wird, erfolgte durch Ehepaar Saager eine freundlich-kühle Begrüßung. Eine Wohltat schien sich zu eröffnen. Aber was sollte ich denn erwarten? Es konnte mir doch niemand direkt, wie die Bläck Fööss im Jahr 1971 sangen, zurufen: „Drink doch ene met …“ Der Hausherr wollte sich noch mit Herrn Scholze unterhalten. Ob er wohl etwas Näheres zu meiner Person hören wollte? Verständlich wäre es schon.
Frau Saager ging mit mir zu dem gesonderten Eingang, um mir den Weg zu zeigen. Sie schritt voran zu meinem künftigen Domizil. Auf der besonders engen, alten Holztreppe, knarrte diese und jene Stufe. Auf der ersten Etage angekommen, erfuhr ich, dass links im ersten Obergeschoss ein älteres Rentnerehepaar, nach meiner Einschätzung fast achtzig Lenze zählend, wohnte. Oben in der zweiten Etage angelangt, öffnete sie eine weiße Holztüre und ich sah ein winziges Kämmerlein.
Ich erblickte links neben dem Eingang einen schmalen Kleiderschrank, höchstens einen Meter breit mit einem Hängeteil, mehrere alte Holzbügel und vier Böden für Wäsche. Nach kurzer Einschätzung schien mir die Lagerfläche für meine wenigen Habseligkeiten im inzwischen abgestellten Koffer zu genügen.
Im Uhrzeigerlauf sah ich das weiße Waschbecken mit einem kleinen Riss an der rechten Seite und mittig einen kleinen Tisch sowie zwei mit dunkelbraunem Stoff bezogene Stühle und, in die Ecke gerückt, das Bett für eine Person. Durch das kleine Fenster erspähte ich die vielen Gräber, ohne ein Ende der Grabstätten auszumachen. Erfreut atmete ich beim Anblick der bereits herbstlich gefärbten großen Bäume auf. Die einzelnen Ruhestätten sollte ich während eines späteren Rundganges entdecken.
„Die nächste Nacht wird mir jedenfalls Ruhe bescheren, sofern um Mitternacht nicht die Geister aus den dunklen Gräbern aufsteigen“, dachte ich. Das Gedicht „Die Geister vom Mummelsee“ von Eduard Mörike, wenn bei ihm diese Unholde vom Berge mit Fackeln kommen, hätte ich umdichten können (damals war der Dichter mir nicht sehr bekannt), um auf die Geister aus den tiefen Gräbern zu warten. Nein, nicht warten, sondern rasch das Fenster schließen.
Mir fällt zu den Geistern meine Angst in Kindertagen ein, alleine im dunklen Keller zu sein. Keinen Gedanken verschwende ich an eine Geisterstunde, gleich ob sie in der dunkelsten Nachtstunde zwischen null und ein Uhr sein soll oder später. Ich lebe nicht mehr im Mittelalter.
Erstaunlich, dass ein altes Manuskript aus dem Jahr 1411 sich bereits über Okkultismus mit allen dazugehörigen Anrufungen und Beschwörungen zum Herbeirufen der Geister beschäftigt. Damals herrschte eine gewisse kollektive Angst vor Kometen, Seuchen und verständlicherweise vor Erdbeben. Dies wurde, intensiv geschürt durch Gruselmärchen des Aber- und Kirchenglaubens (z. B. über Teufel, Dämonen oder Hexen). Die Angst vor Seuchen in unseren Breiten und nach den Jahrhunderten der Pest ist für mich an sich noch verständlich.
Ich dagegen befand mich im 20. Jahrhundert im sicheren Hafen Deutschland in Westfalen.
Heimweh kam angesichts der überaus großen Neugierde und völlig fremden Stadt noch nicht auf. Einigermaßen nervös gespannt erwartete ich als junger Beamter und Stadtassistent zur Anstellung die auf mich zukommende Arbeit.
Es drängt mich überaus heftig, aus dem Arbeitsleben Anekdoten zu erzählen. Wie lautet der Spruch? Morgens ist die Welt noch in Ordnung. Damals hatte ich keine Kenntnis davon, dass die Formulierung als Basis zum Roman des englischen Autors Eric Malpass aus dem Jahr 196524 sowie zum Kinofilm im Jahr 1968 fungierte.
Jedenfalls war dem so in unserer kleinen Bürowelt. Die besagte Ältere und der gleichaltrige Kollege Konrad zeigten am zeitigen Morgen keinen ausgeprägten Drang zu Fleiß. Pünktlich anzutreten morgens um sieben Uhr in der Früh war Pflicht. Die mir noch unbekannten Kartenspiele Rommee oder Canasta sollten Bestandteil der ersten Aufgabe sein. Verwundert schaute ich beide an. Eins kommt noch hinzu: Die Dame qualmte hinter ihrem Schreibtisch wie eine Dampfwalze und zündete sich in kurzen Abständen eine neue Zigarette an. Bis dato war ich Nichtraucher. Aber das Drängen fand kein Ende und endlich hatten beide mich so weit, dass ich meinen ersten Glimmstängel probierte, und sie mussten mein anfängliches Gehuste ertragen.
Wenn nur das Rauchen völlig neu gewesen wäre, nein sogar Alkoholisches schien nötig zur Motivation und zum morgendlichen Start oder – ich wagte kaum zu denken – es diene dem Überstehen der Ödnis der Arbeitsalltage?
Im Schrank war (es wird ja häufig über geheime Aktenordner gelästert) ein kleines Fläschchen Likör zum morgendlichen Ermuntern heimlich verstaut.
Mit Konrad kam ich rasch zu einer Büro-Feierabend-Freundschaft. Die feucht-fröhlich und fidel gestalteten Abende mit ihm auf meiner Bude sind fast nicht zählbar.
Nicht selten kam er auf mich zu und flüsterte: „He Winfried, heute hätte ich abends frei, da meine Freundin etwas anderes plant. Wollen wir uns einen netten Abend machen?“
„Na klar, ich habe ohnehin nur Langeweile in meiner Kammer.“
Uns schwebte vor, eine Kiste Bier und eine Flasche Whisky zu kaufen. Kurz überlegt und schon sausten wir mit dem alten, für diesen Abend ausgeliehenen Kleinwagen seiner Mutter zu einem Laden. Oje, wer eine derartige Mischung in größerer Menge noch nicht als Staudamm zu sich nehmen konnte, dem ist der Durst am nächsten Tag unbekannt. Staudamm trinken? Das war für uns beide ein gängiger Ausspruch. Jeder von uns wusste, was der andere sich vorstellte.
Da wir, trotz großen Durstes, nun nicht zwanzig Flaschen Bier und eine komplette Flasche Whisky an einem Abend verzehren konnten, stand für einen der nächsten Abende eine erfreuliche Reserve zur Verfügung. Viel tragischer war zweifelsohne der heftige Drang nach Wasser ob der Nachwirkung einiger Gläser Pernod abends zuvor am nächsten Morgen. Sehr deutlich rauschte mir später noch so manche Kanonade der Mutter seiner Freundin in den Ohren, dass er schon wieder ohne Besuch bei ihr mit mir herumvagabundiert sei. Manchmal fuhr seine mögliche Schwiegermama zu ihren Verwandten irgendwo nach Westfalen wie Bielefeld oder Osnabrück. Die Städte kannte ich nur aus dem Atlas und stellte mir eine Fahrt mit dem Zug dorthin unendlich lang vor. Für Konrad war dann einige Abende Ruhe, wenn er seiner Freundin ausgiebig erklärt hatte, dass wir Wichtiges besprechen müssten zur Büroarbeit, wofür nur abends die nötige Ruhe herrsche. Es war kaum zu glauben, dass sie dies als bare Münze nahm. Nun musste er keine mahnenden Worte der künftigen Schwiegermutter anhören.
Jeder mag sich denken, dass ich mir zur Körperwäsche das Waschbecken nicht reichen konnte. Mangels Dusche in meinem neuen Obdach nutzte ich sehr gerne das städtische Bad gegen geringes Geld. Einige Räume mit Badewannen konnten samstags bis zwölf Uhr genutzt werden.
Um mein monatliches Nettoeinkommen von etwa achthundert Mark nicht zu sehr zu strapazieren, fuhr ich etwa nur alle zwei Wochen nach Hause. (Eine noch vorliegende Berechnung meiner Dienstbezüge Anfang der 1970er Jahre weist netto siebenhundertsiebenundachtzig Mark aus.)
Meine Mutter hatte mir mit keinem Wort Andeutungen zukommen lassen, dass ich die Wäsche bringen könne. Aus eigenem Antrieb brachte ich also meine Schmutzwäsche in eine Wäscherei. Die Hemden waren danach prima aufgebügelt. Der Preis schien nicht zu hoch zu sein, da ich mir das leisten konnte, möglicherweise sogar musste, um nicht doch zu viel Wäsche nach Hause mitzunehmen.
Ansonsten verlief ein Wochenende ohne Heimfahrt meist arg langweilig, da ich außer Konrad keine Bekanntschaften oder gar Freundschaften erreicht hatte. Es ergab sich nicht die Möglichkeit. Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung hatte ich mir erhofft, in eine Stadt mit aufregenden und pulsierenden Angeboten zu gelangen – aber diese Kleinstadt entsprach kaum meinen jugendlichen Vorstellungen. Der Kollege musste am Wochenende meist seine Pflichttermine mit seiner Freundin gestalten. Der Samstag und der Sonntag zogen sich so langsam und zäh dahin wie Kaugummi.
Hin und wieder sah man uns, manchmal bereits am späten Nachmittag, in Wirtschaften am Geldspielautomaten. Er frönte dem Risiko der geldschluckenden Kisten mit Begeisterung und konnte in die Luft hüpfen, sobald der eiserne Kasten heftig und laut Hartgeld ausspuckte. Leider hatte der Automat den inneren, fest gespeicherten Befehl, eingeworfene Münzen überwiegend zu behalten, sodass dementsprechend nur ab und zu ein Gewinn in Flüssiges umgesetzt werden konnte. Sparen war bei ihm irgendwie ein Fremdwort. Wie gewonnen, so auch gleich zerronnen; ich war jedenfalls eingeladen.
Bei meinen Rundgängen durch Stadt und Gegend am Wochenende erblickten meine Augen einmal einen schwarzen Mercedes; der zum Verkauf angeboten wurde. Ältere Autofahrer erinnern sich an das Modell mit den abgerundeten Kotflügeln. Einige Jährchen schien er angesichts des Preises sehr wohl auf dem Buckel, sprich unter den Rädern, zu haben. Der Preis war mit eintausendachthundert Mark ausgezeichnet. Mit meinem Lohn hätte ich lange sparen müssen, um mir diesen herrlichen schwarzglänzenden Wagen zu leisten.
Jeden Monat gewissenhaft eisern sparen war meine Überlegung, um stolzer Mercedeseigentümer zu werden. Kühlen Kopf bewahren, lautete meine von Kindheit an erlernte Devise. Aber womit sollte ich denn mögliche Reparaturen bezahlen? Der Dieselpreis lag im Verhältnis zu heute auf niedrigem Niveau. Ob und in welchem Umfang möglicherweise neue Reifen meinen Geldbeutel belastet hätten, ließ mich sehr an dem Vorhaben, Autobesitzer zu werden, zweifeln. Bezüglich der gesamten Materie hatte ich von Tuten und Blasen, wie es in Redensarten lautet, keine Ahnung. Das Risiko eines Erwerbs und die mir völlig unbekannten Unterhaltungskosten ließen mich nicht weiter von dem schwarzen Vehikel träumen. Die damaligen Erziehungsmethoden, die relative Armut der Nachkriegszeit mit besonders zu erwähnendem knappem Haushaltsgeld und mit vielen Sorgen meiner Eltern prägten mich. Es entwickelte sich mit den Jahren eine eiserne Sparsamkeit, Zielstrebigkeit mit einigen Steinbock-Charakteristiken, was als Anfangsgrad von Geiz und Egoismus bezeichnet werden könnte, je nach Blickwinkel der Leser.
Eine recht unerfreuliche Anekdote zum Tanken wird gestandenen Autofahrern die Stirn runzeln lassen. Mit dem städtischen Dienstwagen sollte ich zur fünfzehn Kilometer entfernten Kreisstadt fahren. Der Tankzeiger zeigte dringendes Nachfüllen an. An der Tanksäule muss ich irgendwie nicht auf die Beschriftung geachtet haben oder wer weiß, wie so ein Malheur geschehen konnte. Nach dem Bezahlen versuchte der Motor nach Bruchteilen von Sekunden einen Start und verpestete mit einer so heftigen Rauchsäule die Umgebung, als wäre ein Vulkan ausgebrochen. Entweder war im Tank Diesel statt Benzin oder umgekehrt eingefüllt worden. Der Schweiß brach aus mir heraus. Was soll ich tun? Pures Entsetzen registrierte ich im Gebaren des Tankwarts, welcher aus seinem Kassenhäuschen stürzte und aufgeregt vor mir stand.
„Was hast du denn fabriziert? Hast du keine Augen im Kopf oder den Führerschein von Neckermann erhalten?“, war seine mir kaum helfende Reaktion.
Was blieb mir anderes übrig, als mit den Schultern zu zucken und ahnungslos aus dem dicken Qualm zu verschwinden. Der Tankwart erkannte den Dienstwagen und rief auf meine Bitte hin bei der Stadtverwaltung an. Den weiteren Hergang zur Reparatur vermag ich bei bestem Willen nicht mehr zu rekapitulieren. Der dienstliche Ausflug endete also abrupt und meine Füße trugen mich mit bedröppeltem Gesicht zurück zum Rathaus. Weder an eine heftige Schimpfkanonade noch an eine Diskussion zur Kostenerstattung habe ich eine Erinnerung.
Irgendwann flatterte ein Brief mit der Aufforderung zur Erstattung von Ausbildungskosten aus dem Rathaus Stadtkyll in den Briefkasten meiner neuen Arbeitsstelle. In meiner Not und im Bewusstsein, die geforderte Summe nicht zahlen zu können, wendete ich mich ratsuchend an den Personalchef. Meine Aufregung senkte sich so rasch wie nach einer Fiebertablette, als er mir einen bereits vor Jahren ergangenen Erlass aus Nordrhein-Westfalen zeigte, nach dessen Bestimmungen derartige Kosten nach einem Wechsel zu anderen öffentlichen Arbeitgebern nicht zur Erstattung angefordert werden sollen. Es bedurfte einiges an Korrespondenz, bis der frühere Chef die Argumente aus NordrheinWestfalen akzeptierte und die Forderung einstellte.
Vor meinem Dienstantritt war mir zugesagt worden, dass ich nur eine kurze Probezeit zu bestehen habe. Auf meine Rückfragen musste ich allerdings hören, dass nach der Laufbahnverordnung eine festgelegte Wartezeit eingehalten werden müsse. „Das haben Sie völlig falsch verstanden“, lautete die Rückmeldung. Wer weiß, was ich damals gehört oder verstanden habe? Da mir das westfälische Städtchen nicht als Stadt nach meinen dörflichen Vorstellungen reichte, interessierte ich mich wiederum für die Stellenangebote in der Schwartzschen Vakanzenzeitung.
24 Lesehinweis