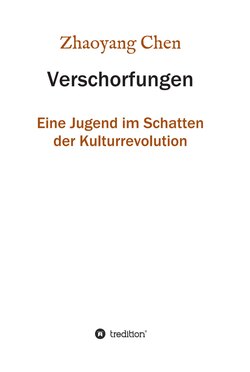Читать книгу Verschorfungen - Zhaoyang Chen - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Wohnhof in Xuzhou
Meine Familie väterlicherseits stammt, wie schon eingangs erwähnt, aus der antiken Stadt Xuzhou, genauer gesagt aus dem Viertel Hubu Shan. „Shan“ bedeutet Berg, eine stark übertriebene Bezeichnung, zumal der Höhenunterschied zum Meeresspiegel weniger als 50 Meter beträgt. Hubu Shan war das wohlhabendste Wohnviertel der Stadt. Auch der Palast des Kaisers Qian Long und das kaiserliche Steuer- und Einwohnerministerium befanden sich dort. Mein Urgroßvater war der dritte Sohn seiner Eltern, und da die Tradition vorsah, dass nur der Stammhalter, der erstgeborene Sohn Haus und Hof erbte, wurde das restliche Vermögen unter den übrigen Söhnen aufgeteilt. 1948 siedelte mein Urgroßvater nach der innerfamiliären Haushalts- und Vermögensaufteilung um und ließ sich im Westen der Stadt nieder. Sein Wohnhof befand sich in der BoÁi-Straße im Xiguan, also dem Westend von Xuzhou. Heute steht dort ein Gebäudekomplex namens „Europa-Kaufhaus“. Es handelte sich um eine höher gelegene, sehr belebte Geschäftsstraße, die zehn Meter breit und etwa 800 Meter lang war und von Ost nach West verlief. Die BoÁi-Straße war die Verkehrsader im Westen der Stadt, von der aus die Händler aus den Vororten in die Stadt gelangten. Gesäumt war die Straße von Geschäften, die bereits in der Song-Dynastie existiert hatten. An dieser altehrwürdigen Straße lagen auch der Wohnhof und das Geschäft meines Großvaters. Der Wohnhof, bestehend aus einem rechteckigen Innenhof, auch „chinesisches Rechteck“ genannt, wurde von vier Häusern umschlossen, deren Fenster und Türen auf den Hof gingen. Der Innenhof war 200 Quadratmeter groß, Platz genug zum Spielen, für Familienfeste und für Treffen mit Freunden und Bekannten. In dem Hof wuchsen zwei Granatapfelbäume. Der eine blühte weiß, der andere rot. Mein Großvater hatte diesen Wohnhof von Herrn Leng, einem Süßwarenhändler gekauft. Bezahlt hatte er aber nicht mit Geld, sondern mit Getreide, denn in den 1920er- und 1930er-Jahren war Geld kein sicheres Zahlungsmittel. Nach Großvaters Planung sollte jeder seiner drei Söhne mit seiner Familie eines der Gebäude bewohnen. So wollte er die große Familie zusammenhalten. Meine Großeltern bewohnten das zentrale Gebäude, welches aus zwei Stockwerken und sechs Zimmern bestand. Es lag höher als die anderen Häuser und war über eine fünfstufige Granittreppe zu erreichen. Hinter diesem Gebäude befand sich ein Garten, in dem viele Rosen gediehen. Da mein Vater der zweitälteste Sohn der Familie war, sollten wir das Ostgebäude rechter Hand von Großvater bewohnen, während im West- und Nordgebäude die beiden Onkel mit ihren Familien wohnten. Die klare Anordnung der Gebäude entsprach der konfuzianischen Familienordnung und deren sozialen Loyalitätsprinzipien. Für meine Großeltern war das Leben so lange schön, wie sie ihre Kinder und Enkelkinder um sich haben konnten. Unser Wohnhof war fast der einzige Hof, der zur Straßenseite hin durch eine Mauer geschützt war. In den Hof gelangte man durch ein überdachtes, drei Meter hohes Tor und über eine sehr hohe Türschwelle. Das schwarz lackierte, massive doppelflügelige Holztor, das einzige nach außen hin sichtbare Zeichen von Wohlstand, war mit dicken Papierschichten zugekleistert und übersät von wütend hinkalligraphierten kulturrevolutionären Parolen und Mao-Zitaten. Peu à peu verloren meine Großeltern den Wohnhof durch Enteignung und mussten sich am Ende mit einem 15 Quadratmeter großen Durchgangszimmer neben dem Eingangstor begnügen, während der linke Trakt von einer Arbeiterfamilie mit vier Kindern bezogen wurde. Der Vater arbeitete als Brauer in einer Destillerie, die Mutter in einer Kartonagenfabrik. Im rechten Trakt wohnte Familie Li. Vater Li war Leiter der städtischen Gärtnerei und Denkmalpflege. Mutter Li war Verkäuferin in dem Lebensmittelgeschäft, das nach der Enteignung der Buchhandlung meines Großvaters dort untergebracht worden war. Auch Großmutter Li wohnte dort. Die beiden Kinder der Lis waren älter als ich und wurden von ihrer Großmutter gehütet, aber wegen des Altersunterschieds spielten sie kaum mit mir. Obwohl Reichtum in der kommunistischen Gesellschaft verpönt war, gab es zur damaligen Zeit doch noch Unterschiede im Haushaltsaufkommen: Familien mit vielen Kindern lebten schlechter und waren ärmer dran als Familien mit wenigen Kindern. Da Familie Li nur zwei Kinder hatte, konnte sie sich schon früher als die übrigen Nachbarn ein Fahrrad und ein Radio leisten. Im nördlichen Gebäude wohnte ein altes christliches Ehepaar, das aus dem Umland stammte. Opa Leng war ein sehr gläubiger Mann und betete dreimal täglich, um Gott für seine Mahlzeiten zu danken. Obwohl die Ausübung von Religion strengstens verboten war, betete Familie Leng in unserem geschlossenen Wohnhof ungehindert zu Gott. Und niemand denunzierte sie, was wohl auf die Friedfertigkeit und Freundlichkeit des hochbetagten Ehepaars zurückzuführen war. Nachbarschaftliche Harmonie und gegenseitige Rücksichtnahme waren auch in der finstersten Zeit in China erhalten geblieben. Opa Leng sprach einen Dialekt, den ich nicht verstand und hatte einen schlohweißen Bart, der ihn wie einen Unsterblichen der „Acht Heiligen“ aus der chinesischen Mythologie aussehen ließ. Ich hatte nicht oft Gelegenheit, von ihm liebkost zu werden, weil er seine Tür meistens verschlossen hielt. Die Wände seines Zimmers waren mit Bibelillustrationen beklebt. All die mystischen Gestalten in ihren farbigen, fremdartigen Gewändern machten mir ein wenig Angst. Zur Winterzeit, wenn die Sonne schräg in sein Zimmer schien, übten die vergilbten Farbtöne der Bilder eine magische Wirkung auf mich aus. Auch Decke und Querbalken waren mit Heiligenbildern beklebt. Die Bilder an der Decke erzählten Geschichten von geflügelten Engeln im Himmelreich. Die auf den Balken stellten einen fremd aussehenden, bärtigen Mann in langem blauem Gewand dar, der eine Dornenkrone auf dem Kopf trug, unter der furchterregende Blutstropfen hervorquollen. Als ich Opa Leng danach fragte, bekam ich immer dieselbe Antwort: dass Jesus Christus für uns gestorben sei. Doch ich wusste weder, wer Jesus Christus war, noch begriff ich, was „für uns gestorben“ bedeutete. Opa Leng gab sich aber gar keine Mühe, mir das näher zu erklären. Familie Leng hatte neun Kinder, von denen nur noch der jüngste Sohn bei den Eltern wohnte. Da die anderen Kinder alle in die Grenzprovinzen verschickt worden waren, konnte ich davon ausgehen, dass die Klassenzugehörigkeit der Familie bestimmt nicht rot war. Unter Folter und Zwang musste der Sohn seine Eltern verraten haben, denn eines Tages stürmten viele Halbwüchsige den Wohnhof, prügelten auf das alte Ehepaar ein, rissen alle Bilder von Jesus Christus von der Wand und verbrannten sie. Die Rotgardisten schrien den Alten an, es sei illoyal gegenüber dem Vorsitzenden Mao, statt eines Porträts von ihm Bilder von Jesus Christus im Wohnzimmer hängen zu haben. Und dann musste Opa Leng sich über das Feuer beugen und die Bilder von Christus mit seinen eigenen Füßen zertrampeln. Nach diesem Angriff starb er. Zu seiner Beerdigung wollte Oma Leng niemanden aus der Nachbarschaft einladen, weil sie uns in jenen barbarischen Jahren des Klassenkampfs vor Sippenhaft bewahren wollte. Beim Abtransport des Leichnams sang Oma Leng Lieder, die ich erst viel später, zu meiner Studentenzeit nach der Kulturrevolution, als Kirchenlieder erkannte. Zur Zeit der Kulturrevolution, zu der das ganze Land mit 700 Millionen Menschen nur das Lied von der „Roten Sonne Mao Zedong“ sang, war es ein konterrevolutionärer Akt, christliche Lieder zu singen.
Ich weiß bis heute nicht, wie mein Großvater die Zeit der Entrechtung und Enteignung seelisch verkraftet hat. In all den Jahren, in denen ich mit ihm zusammenwohnte, hat er nie darüber geredet. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er jemals Streit mit all diesen fremden Leuten gehabt hätte, die nun von Staats wegen unsere Häuser bewohnten. Meine Großmutter war diejenige, die mit dem Zeitgeist nicht mitkam und ständig mit ihren Gefühlen haderte. Zum Glück hatten die neuen Bewohner gesunden Menschenverstand und waren einsichtig genug, sie als ehemalige Herrin zu respektieren und Rücksicht auf ihre schlechte Laune zu nehmen, die dem Verdruss, dem Ärger der der Ablehnung entsprang. Großmutters Leben war von Groll und Unmut erfüllt. Die Freude, möglichst viele Enkelkinder um sich zu haben, war ihr genommen worden. Denn in der kleinen Ein-Zimmer-Wohnung war für Kinder nicht genug Platz. Mein Großvater blieb schweigsam und suchte keinerlei Kontakt zu den neuen Bewohnern des Wohnhofs.
Meine Eltern hatten eine Eineinhalb-Zimmer-Wohnung in der Nähe der BoÁi-Straße zugeteilt bekommen. So pendelte ich in meiner frühen Kindheit zwischen den beiden Wohnorten täglich hin und her. Zum Mittagsessen ging ich zu den Großeltern. Zum Schlafen ging ich abends zu meinen Eltern in die Tangci-Gasse. Meine Großmutter kochte für mich ein Xuzhou-Gericht aus Bohnen, Erdnüssen, Wurzelgemüse und Fleischwürfeln, angereichert mit ein paar Chilischoten. Ein Gericht, das ich seit ihrem Tod nie wieder gegessen habe, das jedoch auf ewig mit ihr verbunden bleibt.
In unserer Wohnung gab es kein fließendes Wasser. Jeder Haushalt besaß ein 80 bis 100 Liter fassendes Tonfass als Wasserbehälter, das meistens lasiert und mit einem Deckel versehen war. Eine Wasserstation gab es in der Nähe einer Stelle, an der sich früher eine Zugbrücke befunden hatte, die tagsüber die Stadt mit den ländlichen Vororten verband und nachts hochgezogen wurde. Soweit ich mich erinnern kann, war das Wasserholen die erste körperliche Arbeit, die ich als Kind zu verrichten hatte. Kaum sieben Jahre alt, half ich, Wasser in einem 20-Liter-Eimer an einer Tragestange zu holen. Die Straße war mit Granitplatten gepflastert, die durch jahrhundertelanges Befahren und Begehen poliert und deshalb sehr glatt und rutschig geworden war. Ich kannte als Kind jede Steinplatte und jede Spurrille dieser Straße, weil ich beim Wasserholen stets darauf achten musste, wohin ich trat, um das Wasser nicht zu verschütten. Am Anfang holte ich es zusammen mit meiner zwei Jahre älteren Schwester, später dann mit meinem zwei Jahre jüngeren Bruder. Zu zweit füllten wir den Wasserbehälter randvoll, bevor wir in die Schule gingen. Als ich größer wurde, holte ich das Wasser mit einem Tragejoch in zwei 20-Liter-Eimern alleine, bis ich 14 Jahre alt wurde und wir in eine Wohnung in dem neuen Wohnviertel Heping Xincun zogen, wo wir nun endlich fließendes Wasser hatten.
In den 1960er-Jahren gab es in China ungefähr 600 Millionen Menschen. 80 Prozent davon lebten auf dem Land. Die Regierung in Peking opferte damals die Landbevölkerung, um die 20 Prozent, die in den Städten lebten, vor Hunger und Not zu bewahren. Das strenge Haushaltsregistrierungssystem Hukou machte die Bauern zu Menschen zweiter Klasse. Sie durften ihre Dörfer nicht verlassen und konnten daher nicht einmal betteln gehen. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich nie hungern müssen. Es gab für alles Bezugsscheine. Die Bezugsmenge änderte sich zwar von Jahr zu Jahr, aber es war zumindest genug. Meine Eltern konnten am Monatsende immer bei der Regierung in Ungnade gefallene Freunde, die nicht genug zu essen hatten, mit Bezugsscheinen und ein wenig Geld unterstützen. Gemüse konnte man frei und ohne Bezugsscheine kaufen. Mit einem oder zwei Fen konnte ich mittags nach der Schule immer einen Korb voll Tomaten, Gurken oder anderes melonenähnliches Gemüse kaufen. Es war sehr billig, frisch und schmeckte gut. Fleisch, Fisch und Eier waren allerdings eine Mangelware, die streng nach Bezugsscheinen verteilt wurde. Für meinen Hund und meine Katze, die gerne Fleisch und Fisch fraßen, sammelte ich nach der Schule in der Großmarkthalle Fleisch- und Fischreste. Für die armen Bauernkinder der benachbarten Provinz Henan wäre das eine Festmahlzeit gewesen.
In meiner Kindheit trieb der auf dem Land herrschende Hunger trotz des Verbots viele Bettelnde aus den Provinzen Henan und Anhui zu uns. Einmal saß ich nach der Schule allein vor dem Eingangstor unseren Wohnhofs und las. Meine Großmutter hatte mir ein Stück Mantou – ein dampfnudelartiges Brot aus Weizenmehl – in die Hand gedrückt, damit ich meinen Hunger ein wenig stillen konnte, bevor wir richtig zu Mittag aßen. Plötzlich tauchte eine Frau mittleren Alters auf, riss mir das Mantou aus der Hand und spuckte mehrmals hintereinander darauf. Ich war von dem Angriff völlig überrascht und ekelte mich derart vor der Spucke, dass ich auf die Rückgabe des Mantous verzichtete. Die Frau verbeugte sich mehrmals tief vor mir und sagte: „Danke, kleiner Herr, danke, kleiner Herr!“ und verschwand genauso schnell, wie sie gekommen war. Als ich wieder zu mir kam, stand meine Großmutter vor mir und wunderte sich, wie schnell ich das Mantou verputzt hatte.