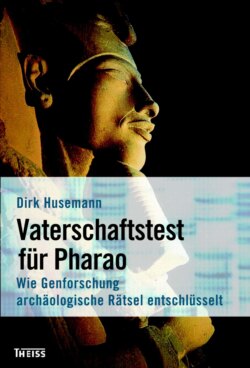Читать книгу Vaterschaftstest für Pharao - Dirk Husemann - Страница 10
Frauenfeindliche Vererbungslehre
ОглавлениеDer fortschrittlichste Zweig der Naturwissenschaften blieb zunächst in konservativen Zwängen gefangen – jedenfalls in den USA. Das bekam Barbara Mc-Clintock zu spüren, die als Frau in die Männerdomäne Genetik einzudringen versuchte.
Daraus wäre um ein Haar nichts geworden. Als junge Frau versuchte Barbara McClintock sich in den 1920er Jahren als Studentin für Genetik an der Universität einzuschreiben – das aber war nur Männern erlaubt. McClintock fand einen Umweg über die Botanik. In dieser Disziplin waren Frauen zugelassen. So kam es, dass Barbara McClintock Maiskörner zählte wie einst Gregor Mendel Erbsen.
Karriere aber war verboten. Trotz beachtenswerter Erfolge in der Forschung wurden dem Talent hohe akademische Titel und entsprechende Positionen in der Forschung mehrfach verweigert. Barbara McClintock galt bei ihren Kollegen als schwierig und eigenbrötlerisch, sie setzte sich über die Bürokratie der Universitäten hinweg, blieb lange nach den Öffnungszeiten noch in ihren Arbeitsräumen und brach an Sonntagen in das Labor ein, um die Untersuchung fortsetzen zu können. Schließlich kehrte sie der Cornell-Universität in Ithaca, New York, den Rücken. McClintock suchte ihr Glück 1941 in einer privaten Forschungseinrichtung, dem Cold Spring Harbor Labor auf Long Island. Dort setzte sie aus Tausenden von Maiskörnern das Mosaik des Erbgutes zusammen.
Wenn Maispflanzen die Leinwand von McClintocks Theorien zur Vererbungslehre bildeten, so waren radioaktive Strahlen Pinsel und Palette. Mit ihnen versuchte die Biologin die Vorgänge in den Pflanzen sichtbar werden zu lassen. Wie Beadle und Tatum den Schimmelpilz, so bestrahlte auch Barbara McClintock ihr Untersuchungsmaterial, um Mutationen hervorzurufen und daran Gesetzmäßigkeiten im Erbgut zu erkennen. Eines Tages beobachtete sie, dass eine neue Generation von Maispflanzen merkwürdige Streifen und Flecken auf den Körnern zeigte. Es schien sich um ein Muster zu handeln, aber es sah anders aus als jene, die von der radioaktiven Strahlung hervorgerufen wurden. Barbara McClintock kannte ihr Maisfeld ganz genau, sie hatte Jahre ihres Lebens damit zugebracht, kleinste Veränderungen auf Maiskörnern zu katalogisieren. Diese seltsame Zeichnung gehörte nicht zum üblichen Bild. Entweder war etwas Außergewöhnliches geschehen oder Barbara McClintock war dank ihrer langjährigen Hingabe an die Maiskörner derartig sensibilisiert für die Pflanze, dass sie als erste mit bloßem Auge sehen konnte, was allen anderen verborgen war – eine Veränderung, die anders aussah als all jene, die durch Strahlung hervorgerufen worden waren.
Zunächst stach die Zeichnung der Blätter ins Auge. Zeigte ein Blatt mehr grüne Streifen als üblich, so trug ein benachbartes Blatt weniger. Dieses Verhältnis galt auch für andere Zeichnungen, Farben und Formen von Blättern und Körnern. Stets tauchten Farbmuster in gegensätzlichen Paaren auf. Was für einen weniger aufmerksamen Beobachter nur eine Laune der Natur gewesen wäre, verblüffte Barbara McClintock. Sie erntete die Maispflanzen ab und verbrachte die nächsten sechs Jahre ihres Lebens damit, nach einem Mechanismus für die rätselhafte Mutation zu suchen.
Noch während die Biologin über den Maiskörnern brütete, bekam sie erstmals Anerkennung für ihre hartnäckige Arbeit. Die Amerikanische Akademie der Wissenschaften nahm Barbara McClintock 1944 in ihre Reihen auf. Die Forscherin war verblüfft: „Juden, Frauen und Neger sind es gewöhnt, diskriminiert zu werden und erwarten nicht viel. Ich bin keine Feministin, aber ich freue mich immer, wenn unlogische Barrieren durchbrochen werden – es hilft uns allen.“ Eine Professur aber ließ weiter auf sich warten.
Die Pforten der Universitäten blieben ihr verschlossen, dafür öffnete sich jene zum Verständnis des Erbguts. McClintock entdeckte springende Gene. Sie vermutete – und bewies später –, dass Gene auf einem Chromosom verschiedene Positionen einnehmen konnten. Lag in einer Maispflanze das Gen für grüne Streifen auf einer Position der Chromosomen, die für die Blattfarbe zuständig war, tauchte es in einer anderen Pflanze an der Position auf, welche die Körnerfarbe bestimmte. Bisher war die Biologie davon ausgegangen, dass bestimmte Gene stets dieselbe Position auf einem Chromosom einnehmen. Dass nun ausgerechnet eine Frau an diesem Dogma der Vererbungslehre rüttelte, passte den männlichen Kollegen nicht. Barbara McClintock präsentierte ihre Beweise 1951 der Öffentlichkeit und bekam eine Abfuhr.
„Sie ist nur eine alte Schachtel, die seit Jahren in Cold Spring Harbor herumhängt“, lautete der Kommentar eines männlichen Kollegen, nachdem die so genannte Fachwelt Babara McClintocks Forschungsergebnisse in der Luft zerrissen hatte. Die Biologin zog sich in die Abgeschiedenheit ihres Labors zurück. Es dauerte weitere zwanzig Jahre, bis die springenden Gene, heute als Transposons allgemein anerkannt, zum Basiswissen jedes Biologiestudenten gehörten. Heute gilt: Transposons ermöglichen Genen zu mutieren, um zum Beispiel auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren.
Nach der öffentlichen Ablehnung ihrer Theorien hielt sie nie wieder eine Vorlesung. Nur einmal noch tauchte die Biologin in der Öffentlichkeit auf. 1983 nahm Barbara McClintock den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin in Stockholm entgegen. Nach dem Rezept für ihre Hartnäckigkeit und ihr Durchhaltevermögen befragt, antwortete sie: „Wenn man weiß, dass man Recht hat, ist es nicht so schlimm. Man weiß, früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht.“ Barbara McClintock starb am 2. September 1992.