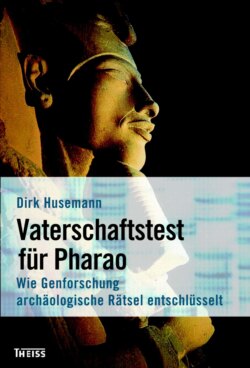Читать книгу Vaterschaftstest für Pharao - Dirk Husemann - Страница 25
Die Trennkost der Evolution
ОглавлениеWährend die Frage nach dem Kannibalen-Gen zunächst offen blieb, fand ein Forscherteam in Leipzig heraus, dass die Art der Nahrung tatsächlich die Aktivität der Gene beeinflusst. Für das Beispiel der Laktose, die dem Menschen vor 10.000 Jahren erst das Milchtrinken ermöglichte, bedeutet diese Erkenntnis, dass Homo sapiens in der Jungsteinzeit zunächst Milch probierte und daraufhin das Enzym ausbildete – über einen Zeitraum mehrerer Generationen. Der umgekehrte Fall, dass wenige Individuen das Enzym vorab besaßen, dann erst die Milch aus dem Euter molken und fortan gegenüber Individuen ohne Laktaseenzym einen Vorteil hatten, scheint ausgeschlossen. Den Beleg dafür fand Mehmet Somel im Januar 2008 in einer Maus.
Gleich ein Dutzend der Nager fraß sich bei einem Test im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig rund und satt. Eine der Mäusegruppen bekam Obst und Gemüse vorgesetzt – Schimpansendiät. Auch die nahen Verwandten des Homo sapiens ernähren sich in erster Linie vegetarisch. Gelegentlich darf es aber auch ein Stück Fleisch sein. Mäusegruppe zwei knabberte vom Tagesmenü der Institutskantine: statt Rohkost gab es Gebratenes und Gekochtes – ein historisches Menü, denn der Frühmensch stellte sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt seiner Geschichte auf warme Mahlzeiten um. Möglicherweise – so vermuten Anthropologen – bildeten sich dank weichgekochter Nahrung beim Vorläufer des Menschen die langen Zähne zurück, mit denen Schimpansen noch heute imponieren. Die dritte der Leipziger Mäusegruppen fand in ihren Näpfen Fast-Food, Reste von Hamburgern und Pommes frites nach den Rezepten einer US-amerikanischen Kette. Die vierte und letzte Gruppe bekam gewöhnliches Mäusefutter vorgesetzt, ihre Daten sollten als Vergleichsmodell dienen. Zwei Wochen schlemmten die Mäuse, dann sahen die Genetiker nach, wie sich die Tiere verändert hatten.
Wie zu erwarten war: Die Fast-Food-Tiere hatten den größten Körperumfang entwickelt. Mit diesem Ergebnis wollten sich die Forscher in Leipzig aber nicht abspeisen lassen, entnahmen Mäuse-DNA aus der Leber und verglichen die Messwerte mit jenen Daten, welche die Tiere mit normalem Mäusefutter geliefert hatten. Resultat: In der Leber war die Hölle los. Von 13.168 abgelesenen Lebergenen zeigten 830 veränderte Aktivität. Immerhin kommen 117 dieser Gene auch bei Menschen und Schimpansen vor. Eine vergleichbar heftige Reaktion ist demnach bei Homo sapiens und Primaten zu erwarten.
Auf das Gehirn der Mäuse hatte die Trennkost offenbar keine Auswirkung – mit einer Ausnahme: Die Fast-Food-Gruppe zeigte auch im Denk- und Steuerorgan veränderte Genaktivität. „Das wirft die faszinierende Frage auf, welche Effekte eine Fast-Food-Ernährung auf das Gehirn hat“, resümieren die Forscher um Mehmet Somel. Diese Frage muss zunächst unbeantwortet bleiben.
Bis zum Homo frittensis ist es noch ein weiter Weg. Schon jetzt aber wirft das Leipziger Experiment neues Licht auf die Vergangenheit des Menschen. Dessen Essgewohnheiten lassen sich nur ungefähr rekonstruieren. Anthropologen schätzen, dass die Vorfahren der Hominiden vor mehr als sieben Millionen Jahren begannen, Aas zu fressen. Die Umstellung von rein vegetarischer Kost auf gelegentlichen Fleischkonsum mag durch Notsituationen hervorgerufen worden sein. Dürreperioden können das pflanzliche Nahrungsangebot dramatisch eingeschränkt haben. Um nicht zu verhungern, lasen die Frühmenschengruppen auf, was sie am Boden fanden – dazu werden auch Tierkadaver gehört haben. Frischfleisch gab es nur in Glücksfällen; Jagen war eine Kunst, die vermutlich erst Homo habilis vor 2,4 Millionen Jahren entwickelte; immerhin erfand diese Menschenart auch das erste Werkzeug. Einen weiteren Stern auf der Menükarte erhielten die Vorfahren des Menschen durch die Entdeckung, dass Fleisch über einem Feuer gegart werden kann. Die ältesten Belege für kontrollierte Brände stammen vom Turkanasee in Afrika und sind 1,6 Millionen Jahre alt. Sollten die Flammen zu dieser Zeit neben ihrer Funktion als Wärmespender und Lichtquelle schon als Herdstelle gedient haben, hieße der Chefkoch Homo erectus. Allerdings waren die Brände noch zufällig – vermutlich durch Blitzeinschlag erzeugt und von den Hominiden gehütet. Welcher Menschenart schließlich der zündende Gedanke kam, selbst Feuer zu entfachen, weiß niemand. Heute gilt der Verzehr rohen Fleisches als Gespenst aus der menschlichen Vergangenheit.
Das Experiment in Leipzig legt nahe, dass diese Stationen der Steinzeitküche eng mit der Entwicklung des Menschen verbunden gewesen sind. Wer Fleisch statt Blätter aß, brachte seine molekularen Aktivitäten in Schwung. Welche Veränderungen die neuen Nahrungsquellen bei den Hominiden auslösten, ist noch unbekannt. Nach einigen Generationen mag es im Enzymhaushalt einen Unterschied zwischen Vegetariern und Fleischessern gegeben haben. Während die einen auf den Bäumen blieben, um weiter Blätter zu kauen, streiften die anderen am Boden umher, um nach Tierkadavern zu suchen. Vielleicht half der Fleischkonsum dem Frühmenschen sogar auf die Sprünge und spielte eine Rolle bei der Entwicklung des aufrechten Gangs. Der US-Anthropologe Owen Lovejoy vermutet, dass teilweise aufrecht gehende Individuen den entscheidenden Vorteil hatten, dass sie gesammelte Nahrung mit beiden Händen nach Hause tragen und deshalb größere Mengen an Vorräten anhäufen konnten als jene, die hartnäckig auf vier Beinen liefen. Heißhunger auf Fleisch, hervorgerufen durch eine veränderte DNA-Struktur, mag dabei eine Rolle gespielt haben.