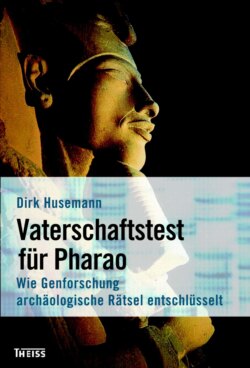Читать книгу Vaterschaftstest für Pharao - Dirk Husemann - Страница 18
Zuchtstation für Dinosaurier – Fantasie und Realität der Paläogenetik
ОглавлениеAnfang der 1990er Jahre machte George Poinar jun. von der Universität Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien die Paläogenetik zur Sensationswissenschaft. Er entdeckte in vierzig Millionen Jahre alten, in Bernstein eingeschlossenen Termiten gut erhaltene Erbsubstanz. Die Entdeckung inspirierte Buchautor Michael Crichton zu der Saurierfantasie „Jurassic Park“. Die Geschichte von den wiederbelebten Dinosauriern sorgte weltweit für Euphorie. Mit einem Schlag schienen alle Probleme der Geschichtsforschung gelöst. In Büchern, Filmen und Vorstellungen stiegen leibhaftige Riesenechsen aus Reagenzgläsern, wurden Einstein und Goethe wiedergeboren und die bedrohten Tierarten der Welt vor dem Aussterben gerettet.
Die Realität erteilte solchen Träumen eine Absage. Die menschliche Erbsubstanz besteht aus Millionen von Bruchstücken. Nur komplett ergeben sie ein vollständiges Bild, eine Blaupause des Lebens. Selbst damit bleiben Klon-Experimente Wunschträume der Paläontologen. Zerfallene DNA wieder zu vollständigen Chromosomen zusammenzusetzen ist jenseits aller wissenschaftlichen Kunst. Noch komplizierter wäre es, aus Chromosomen eine funktionierende Eizelle zusammenzuflicken, aus der sich Leben entwickeln könnte. Die Steuer und Regelungsenzyme, die beim Heranreifen längst ausgestorbener Lebewesen eine Rolle spielten, haben die Dinosaurier mit ins Grab genommen.
Je älter die Erbsubstanz, desto mehr zerfällt sie in unleserliche Schnipsel. Ein Rückgriff auf Jura, Trias oder Kreide, die Erdzeitalter der Riesenechsen, ist angesichts des DNA-Verfalls eine viel zu große Rolle rückwärts. Bei 50.000 Jahren ist Schluss. Mehr Erfolg versprechen jüngere Epochen, aus denen ebenfalls Überreste von Lebewesen überliefert sind. Auf der Suche nach lohnenswertem Untersuchungsmaterial wurden Paläogenetiker an den Wurzeln der Menschheit fündig.
Der deutsche Paläogenetiker Matthias Krings aus München wagte 1996 ein Aufsehen erregendes Experiment: die Suche nach menschlicher Erbsubstanz in den Knochen eines Neandertalers. Tatsächlich fanden Krings und sein Team nach dreijähriger Vorbereitung, vielen Tests und zwei Versuchen eine Sequenz Neandertaler-Erbmaterial. Das älteste Erbgut der Menschheit war sichergestellt. Ein Vergleich mit den DNA-Strängen anatomisch moderner Menschen ergab: Unsere Gene sind neandertalerfrei.
Diese Meldung ging Anfang 1997 um die Welt. Seither hat sich die Verbindung von Archäologie und Genetik als fruchtbar erwiesen. Heute ist Erbmasse nicht länger ein Brei von Basenpaaren, sondern ein klar strukturiertes Datengerüst, ein historischer Fahrplan durch die Geschichte der Biologie und die Kulturentwicklung des Menschen. Nächste Haltestelle: Evolution.