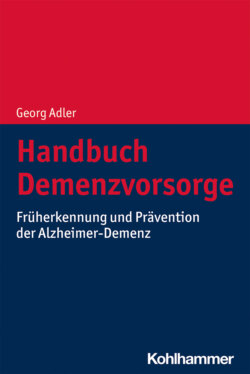Читать книгу Handbuch Demenzvorsorge - Georg Adler - Страница 7
Оглавление
1 Epidemiologie und gesellschaftliche Bedeutung der Demenzerkrankungen
Bis zum Jahr 2040 werden in Deutschland die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge, also die Personen, die zwischen 1950 und 1970 geboren wurden, ins Rentenalter eingetreten sein. Die auf sie folgenden Jahrgänge sind deutlich schwächer besetzt ( Abb. 1.1), so dass es binnen weniger Jahre zu einem erheblichen Anstieg der absoluten Anzahl und des Bevölkerungsanteils der Personen im Rentenalter kommen wird. Der sogenannte Altersquotient der Bevölkerung, also die Anzahl von Personen im Rentenalter, die auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter kommt, wird auf einen Wert von über 80 ansteigen.
Dieser demographische Wandel wird mit einer erheblichen Zunahme der altersassoziierten Erkrankungen und damit auch der Demenzerkrankungen verbunden sein. Die weitaus häufigste Ursache einer Demenz ist die Alzheimer-Krankheit. Ihre Häufigkeit nimmt im höheren Lebensalter erheblich zu und erreicht jenseits des 85. Lebensjahres Werte um 30 Prozent ( Abb. 1.2) (Wu et al. 2016).
Hingegen ist vor dem 50. Lebensjahr die Häufigkeit von Demenzen sehr niedrig und liegt bei etwa 0,25 Promille, wobei nur etwa 30 % der Demenzerkrankungen in dieser Altersgruppe auf die Alzheimer-Krankheit zurückzuführen sind (Lambert et al. 2014).
Die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Demenzerkrankungen in Deutschland wurden für das Jahr 2016 auf 54 Mrd. € geschätzt und werden sich erwartungsgemäß bis zum Jahr 2060 auf 145 Mrd. € erhöhen (Michalowsky et al. 2019). Derzeit werden diese Kosten jeweils zu ungefähr der Hälfte durch das Gesundheitssystem und durch die Familien aufgebracht. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate, der hohen Scheidungsrate und des steigenden Anteils von im Alter allein lebenden Personen wird die Leistungsfähigkeit der Familien für die Versorgung der Demenzkranken abnehmen. Dementsprechend wird sich der Kostenanteil des Gesundheitssystems in Zukunft erhöhen.
In epidemiologischen Untersuchungen wurde eine Reihe von beeinflussbaren Faktoren identifiziert, die das Risiko für die Entwicklung einer Alzheimer-Demenz erhöhen. Zu diesen beeinflussbaren Risikofaktoren gehören Diabetes mellitus, Bluthochdruck im mittleren Lebensalter, Übergewicht im mittleren Lebensalter, körperliche Inaktivität, Depressivität, Rauchen und schlechte Bildung. Die Stärke des Zusammenhangs zwischen diesen Faktoren und dem Risiko für die Entwicklung einer Demenz lässt vermuten, dass etwa ein Drittel aller Demenzerkrankungen durch gezielte Einwirkung auf diese Risikofaktoren verhindert werden kann (Norton et al. 2014).
Abb. 1.1: Bevölkerungsstruktur Deutschlands 2020 (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2019, Bevölkerungspyramide: Altersstruktur Deutschlands von 1950 – 2060 (destatis.de)). In dieser Abbildung ist die Personenanzahl der einzelnen Jahrgänge für Männer und Frauen dargestellt. Die Jahrgänge der Babyboomer, also der Personen, die derzeit etwa zwischen 45 und 65 Jahre alt sind, sind erheblich stärker besetzt als die folgenden Jahrgänge.
Für diese Vermutung spricht auch, dass die altersbezogene Neuerkrankungsrate für Demenzen in Europa in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken ist. So wurde in der Rotterdam-Studie bei zwei Kohorten, die 1990 bzw. 2000 untersucht wurden, eine Abnahme der altersbezogenen Neuerkrankungsrate für Demenzen um 24 % beobachtet (Schrijvers et al. 2012). Diese Abnahme ging mit einer Intensivierung der Behandlung von Gefäßrisikofaktoren bei der später untersuchten Kohorte einher. Auch bei der englischen Cognitive Function and Ageing Study (CFAS), bei der mehr als 7.500 über 65-jährige Personen in zwei Kohorten zwischen 1989 und 1994 und zwischen 2008 und 2011 untersucht
Abb. 1.2: Altersbezogene Häufigkeit der Demenz in Europa (Wu et al. 2016). In dieser Abbildung ist die Häufigkeit der Alzheimer-Demenz, wie sie in verschiedenen epidemiologischen europäischen Studien ermittelt wurde, in % über den entsprechenden Altersgruppen dargestellt. Die Häufigkeit nimmt mit dem Lebensalter stark zu und erreicht bei den über 85-Jährigen Werte um 30 %.
wurden, wurden vergleichbare Ergebnisse gefunden (Matthews et al. 2013). In den zwanzig Jahren, die zwischen der Untersuchung der beiden Kohorten liegen, nahm die standardisierte Querschnittshäufigkeit der Demenz von 8,3 % auf 6,5 % ab. Bessere Bildung und eine intensivere Behandlung von Gefäßrisikofaktoren in der jüngeren Kohorte wurden von den Autoren dafür als Ursachen angenommen. Diese Faktoren scheinen stärker wirksam zu sein als die im Intervall zwischen der Untersuchung der beiden Kohorten eingetretenen entgegengerichtet wirksamen Veränderungen, vor allem die größere Häufigkeit von Übergewicht und Diabetes mellitus sowie die besseren Überlebenschancen nach Schlaganfällen.
Allerdings wirkt sich der demographische Wandel auf die Anzahl und den Bevölkerungsanteil der an Demenz Erkrankten erheblich stärker aus als die Abnahme der altersbezogenen Neuerkrankungsrate. Dennoch besteht die begründete Hoffnung, dass durch gezielte Präventionsmaßnahmen etwa 30 % der Demenzerkrankungen, die anhand der Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung zu erwarten sind, vermieden werden können (Luck und Riedel-Heller 2016). Um dieses Präventionspotenzial ausschöpfen zu können, sind allerdings zielgerichtete gesundheitspolitische Maßnahmen erforderlich. Vor dem Hintergrund des allgemein gestiegenen Gesundheitsbewusstseins könnte eine intensive und erfolgreiche Beteiligung der Bevölkerung an geeigneten Präventionsmaßnahmen möglich werden, wie es sich bei einem Projekt abzeichnet, das von uns gemeinsam mit der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz durchgeführt wird (Adler 2019).
Bei den über 50-jährigen nicht dementen Teilnehmern dieses Demenz-Präventionsprogramms wurde eine starke Häufung beeinflussbarer Risikofaktoren der Alzheimer-Demenz festgestellt. Das waren insbesondere
• Übergewicht (bei 61,7 %),
• nicht oder unzureichend behandelte Hypercholesterinämie (bei 38,9 %),
• niedrige kardiorespiratorische Fitness (bei 37,1 %),
• niedrige motorische Fitness (bei 33,6 %),
• Hyperhomocysteinämie (bei 29,0 %),
• nicht oder unzureichend behandelte arterielle Hypertonie (bei 22,5%),
• Prädiabetes oder Diabetes mellitus (bei 20,7 %) und
• Rauchen (bei 12,3 %) (Adler 2019).
Bei über 20 % der untersuchten Personen bestanden vier oder mehr dieser Risikofaktoren. Für die meisten dieser Risikofaktoren zeigten sich im Querschnitt bei den untersuchten Personen Zusammenhänge mit Gedächtnisstörungen. Dies gilt in besonders hohem Maß für eine schlechte körperliche Fitness sowie für Prädiabetes oder Diabetes mellitus. Bemerkenswert waren signifikante Querschnittskontingenzen einerseits zwischen Gesundheitsmerkmalen, die eng mit dem Lebensstil zusammenhängen wie Übergewicht, schlechte körperliche Fitness oder Rauchen, und andererseits medizinischen Risikofaktoren der Alzheimer-Demenz wie Bluthochdruck, Prädiabetes oder Diabetes mellitus, Hypercholesterinämie und Hyperhomocysteinämie. Diese Zusammenhänge, die auch in der von uns untersuchten Altersgruppe noch im Querschnitt nachweisbar waren, weisen auf ein beträchtliches Präventionspotenzial hin, das durch Änderungen des Lebensstils erschlossen werden kann.
Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang die zunehmende Häufigkeit von Übergewicht und Diabetes mellitus bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Außer der individuellen Beratung und Behandlung der Betroffenen spielen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Ernährung und körperliche Aktivität eine große Rolle, wobei auch die Politik Einflussmöglichkeiten hat und Verantwortung trägt (Tataranni 2003).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Identifikation beeinflussbarer Risikofaktoren für die Entwicklung einer Demenz und die Häufung dieser Risikofaktoren bei älteren Erwachsenen eine ausgezeichnete Basis für wirksame Maßnahmen zur Demenzprävention darstellt. Die daraus ableitbaren Maßnahmen betreffen sowohl den Lebensstil als auch die medizinische Behandlung der Risikofaktoren. Auf diese Weise könnte die durch den demographischen Wandel bedingte starke Zunahme von Demenzerkrankungen erheblich abgemildert werden.