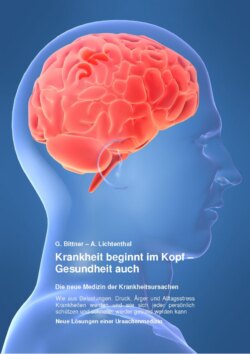Читать книгу Krankheit beginnt im Kopf – Gesundheit auch - Gerhard Dr. Bittner - Страница 21
3.3 Evidenzbasierte Daten zum Erfolg von Stressmanagement-Therapien
ОглавлениеDarüber hinaus liegen auch evidenzbasierte Daten vor, die zeigen, dass durch Interventionen mit kognitivem Stressmanagement als Therapie gute Erfolge erzielt werden konnten. Dies zeigte die Arbeitsgruppe von James Blumenthal et al. mehrmals 1997 und 2005.
Bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung wurde eine Gruppe konventionell medikamentös behandelt, eine zweite Gruppe bekam Trainingspläne zu regelmäßigen körperlichen Bewegungseinheiten, während die dritte Gruppe eine StressmanagementTherapie erhielt. Es zeigte sich, dass die Verbesserungen der Teilnehmer mit körperlichem Training und der Gruppe mit einer Stresstherapie gleich gut waren. Während diese Effekte bei der konventionell therapierten nicht auftraten. So waren die Schweregrade der depressiven Episoden in den beiden zusätzlich nicht medikamentös behandelten Gruppen ebenfalls gleichartig reduziert (Beck-Depression-Index).
Als ein wichtiger Parameter der Gefäß- und Endothelfunktion wurde die flussabhängige Dilatation (Flowmediated Dilatation, FMD) bei allen Teilnehmern gemessen. Es fanden sich besonders in den Gruppen mit körperlichem Training Verbesserungen. Erstaunlicherweise, dies war nicht ohne weiteres vorhersagbar, verbesserte sich auch in der Gruppe mit Stressmanagement die Gefäß- und die Endothelfunktion signifikant, obwohl keine zusätzlichen körperlichen Trainings stattgefunden hatten.
Es zeigte sich in der Blumenthal-Studie weiterhin, dass die Patienten mit auffällig veränderten Herzwandbewegungen die stärksten Effekte in der mental antistress-trainierten Gruppe aufwiesen.
Die Effekte waren hier deutlich stärker ausgeprägt als in der sportlich aktiven Gruppe. Die medikamentös geführten Patienten zeigten keine positiven Veränderungen der Herzwandbewegungen. Die Ergebnisse waren überzeugend. So berichtete DER ARZNEIMIT-TELBRIEF 2006 zu dieser Studie und empfahl entsprechende Methoden eines zusätzlichen Stressmanagements für diese Patienten in der Arztpraxis.
In mehreren Metaanalysen zeigte sich weiterhin, dass sich auch eine nicht medikamentöse Therapie, bestehend aus einer Patientenaufklärung (Schulung) und einem Stress-Management auf die Mortalität und Morbidität im Zeitverlauf (Linden et al., Arch Intern Med 1996) deutlich positiv auswirkt. Dusseldorp et al. (1999), vertreten insgesamt 37 klinische Studien, die den Anforderungen der evidenzbasierten Kriterien entsprechen, aus.
Die berücksichtigten Studien mussten entsprechende Kriterien von validen Studiendesigns und methodischen Ansätzen erfüllen.
Sie zeigten, dass die nicht medikamentöse Intervention, bestehend aus Aufklärung und Stressmanagement, die Mortalität um 34% und die Re-Infarktrate um 29% reduzierten. Die Teilnehmer profitierten zusätzlich durch die gleichzeitige Reduktion der Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Hyper-Cholesterinämie, Körpergewicht, Rauchen und mangelnde Bewegung. Insgesamt veränderte sich die Lebensstilführung der Teilnehmer hin zu mehr Bewegung, weniger Rauchen und zu neuem vorteilhafteren Ernährungsverhalten.
Übersicht über Publikationen und Metaanalysen (EBM)
In Zeiten der evidenzbasierten Medizin erreichen besonders Metaanalysen eine hohe Aussagekraft für die Beurteilung medikamentöser und/oder nicht medikamentöser Therapiestrategien. Metaanalysen bilden auch eine der wichtigsten Säulen für die evidenzbasierte Stressmedizin. Metaanalysen zeichnen sich insbesondere durch deren hohe generelle Einschätzung ihres Evidenzgrades aus.
Einige der wichtigsten Metaanalysen im Bereich der Stressmedizin sollen hier nur kurz aufgeführt und genannt werden:
1 R. Rugulies, Depression as a predictor for coronary heart disease, a review and meta-analysis, Am J Prev Med 23 (2002), pp. 51-61 ,
2 M.R. DiMatteo, H.S. Lepper and T.W. Croghan, Depression is a risk factor for noncompliance with medical treatment, metaanalysis of the effects of anxiety and depression on patient adherence, Arch Intern Med 160 (2000), pp. 2101-2107 ,
3 van Melle J.P., de Jonge P., Spijkerman T.A., Tijssen J.G., Ormel J., van Veldhuisen D.J., van den Brink R.H., van den Berg M.P. Prognostic association of depression following myocardial infarction with mortality and cardiovascular events: a metaanalysis. Psychosom Med 2004;.66.:814-822 ,
4 M. de Groot, R. Anderson, K.E. Freedland, R.E. Clouse and P.J. Lustman, Association of depression and diabetes complications: a metaanalysis, Psychosom Med 63 (2001), pp. 619630,
5 S.L. McElroy, R. Kotwal, S. Malhotra, E.B. Nelson, P.E. Keck Jr and C.B. Nemeroff, Are mood disorders and obesity related? A review for the mental health professional, J Clin Psychiatry 65 (2004), pp. 634-651.
Allerdings sei auch erwähnt, dass trotz teilweiser guter Studiendaten im Bereich der Stressmedizin weitere Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Datenlage weiter zu verbessern und die Zusammenhänge weiter abzusichern. Umfangreiche Forschungsgelder sind notwendig, um dies zukünftig zu erreichen.