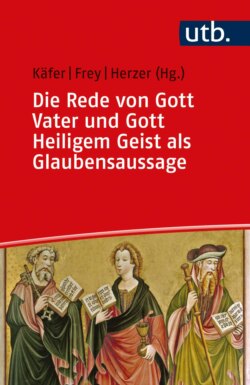Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 12
|37|3.2. (Fast) zurück zu den Aposteln: Die frührömischen Tauffragen
ОглавлениеBei alledem ist unbestritten, dass ein in Rom genutzter Bekenntnistext vor dem 4. Jahrhundert nicht zu identifizieren ist – wenn man nicht aus dem Brauch der Taufkatechese automatisch auf ein dieser zugrundeliegendes Bekenntnis schließen will, was reine Spekulation wäre. Der vielleicht ernüchternde Befund passt freilich zu der weiter ausgreifenden These, dass überhaupt erst die Reichssynoden des 4. Jahrhunderts deklaratorische Bekenntnisse formuliert hätten. Das betonte nicht erst Markus Vinzent, sondern schon lange zuvor Hans von Campenhausen, und Adolf Martin Ritter ist ihm darin mit guten Gründen und weitgehender Zustimmung der Zunft gefolgt.[60] Das Nizänum (oder das in seiner Authentizität freilich notorisch umstrittene und zudem nur in späterer syrischer Übersetzung erhaltene Credo der Synode von Antiochien 324/25) wäre dann das erste Bekenntnis seiner Art.[61] Hingegen handelt es sich bei dem von Euseb von Caesarea († ca. 340) auf dem Konzil von Nizäa vorgelegten Bekenntnis entgegen einer lange vorherrschenden Ansicht[62] nicht um das in seiner Heimatgemeinde übliche Taufbekenntnis, sondern um ein frühes Exemplar der sogenannten »Theologenbekenntnisse«, wie es im selben Zeitraum z.B. auch Arius und ihm folgende alexandrinische Kleriker verfassten.[63]
Wie aber konnte man in der älteren Forschung auf den – teils auch noch in der gegenwärtigen Literatur nachwirkenden – Gedanken kommen, dass es schon länger das Romanum und damit eine Vorstufe |38|des Apostolikums gegeben habe, wenn dies doch textlich nicht nachweisbar ist? Dafür lassen sich drei Gründe nennen, denen neuerdings einhellig widersprochen wird:
1 Die Unterscheidung von Glaubensregeln und deklaratorischen Bekenntnissen wurde nicht hinreichend beachtet.[64] Es gibt durchaus konfessorische Kontinuität seit dem frühen Christentum, nur liegt diese offensichtlich nicht in der Existenz und Nutzung von textlich fixierten Bekenntnissen zu antihäretischen, katechetischen oder liturgischen Zwecken, sondern in dem flexiblen Instrument der regula fidei, das etwa bei Irenaeus von Lyon oder Tertullian belegt ist. Deklaratorische Bekenntnistexte sind vor dem 4. Jahrhundert nicht belegt, weder in Rom noch anderswo.
2 Freilich hat man seit der Entdeckung der Traditio apostolica und deren Zuschreibung an Hippolyt von Rom († ca. 235) gemeint, einen direkten Blick in die Praxis der römischen Kirche werfen und aus der Nähe des (postulierten) Taufbekenntnisses dieses Textes mit dem Romanum und einigen Texten bei Tertullian eine römische Bekenntnistradition rekonstruieren zu können.[65] Die Möglichkeit, aus der nicht im Original erhaltenen und wohl fälschlich Hippolyt zugewiesenen Traditio apostolica Schlussfolgerungen über römische Riten im frühen 3. Jahrhundert ziehen zu können, ist mittlerweile allerdings nachhaltig erschüttert.[66] Gerade die Tauffragen scheinen das Gepräge der trinitätstheologischen |39|Debatten der Zeit nach Markell zu tragen. Würde man daher die lateinische Übersetzung der Traditio apostolica auswerten, die in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts entstand, hätte man es mit einem zeitlich nach Markells Brief zu verortenden Text zu tun,[67] nicht mit einer älteren oder gar apostolischen Tradition.
3 Schließlich ist die Forschung über weite Strecken davon ausgegangen, dass auch schon in vorkonstantinischer Zeit die Taufunterweisung anhand eines fixierten Bekenntnisses vorgenommen worden sei, obwohl dafür ein klarer Beleg aus der Zeit vor Kyrill von Jerusalem, Augustin und anderen fehlt.[68] Weithin üblich waren hingegen Tauffragen, meist in trinitarischer Gestalt, und blieben es auch im 4. Jahrhundert und weit darüber hinaus.[69] Nicht deklaratorische, wohl aber interrogatorische Bekenntnisse hat es also im Christentum lange vor den Konzilien der Reichskirche gegeben! Auf Tauffragen weist möglicherweise schon der »westliche« Einschub in der Perikope über die Taufe des Kämmerers aus Äthiopien hin (Apg 8,37), der ins 2. Jahrhundert gehört;[70] sicher ist der Bezug auf Tauffragen bei Cyprian von Karthago, d.h. in der Mitte des |40|3. Jahrhunderts.[71] Und dieser Brauch, der zunächst ein rein »westliches« Phänomen gewesen zu sein scheint, führt uns sehr wohl auf römische Spuren.
Es ist eine bemerkenswerte Ironie der Forschungsgeschichte, dass von Harnack und Kattenbusch bis Lietzmann und Kelly die in der Traditio apostolica und anderen Texten überlieferten Tauffragen, die es offensichtlich gab, immer wieder zur Rekonstruktion von etwas anderem benutzt worden sind, was es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gab – ein deklaratorisches Bekenntnis, das in der Katechese oder Taufliturgie Verwendung gefunden hätte.[72] Dagegen hat Wolfram Kinzig gezeigt, dass die Tauffragen für sich genommen Interesse verdienen, wenn es um eine römische Traditionslinie geht. Dieses Set von Fragen ist im Sacramentarium Gelasianum Vetus, der ältesten erhaltenen römischen Agende aus dem 7. Jahrhundert,[73] überliefert und wird hier den Tauffragen aus der Traditio apostolica gegenübergestellt:
| |41|Traditio apostolica (lat.) | Sacramentarium Gelasianum Vetus |
|---|---|
| [Credis in deum, patrem omnipotentem?] [74] | Credis in deum, patrem omnipotentem? |
| Credis in Christum Iesum, filium dei, | Credis et in Iesum Christum, filium eius unicum, dominum nostrum, |
| qui natus est de spiritu sancto ex Maria virgine | natum |
| et crucifixus sub Pontio Pilato et mortuus est et sepultus | et passum? |
| et resurrexit die tertia | |
| et ascendit in caelis et sedit ad dexteram patris | |
| venturus iudicare vivos et mortuos? | |
| Credis in spiritu sancto | Credis et in spiritum sanctum, |
| et sanctam ecclesiam | sancta ecclesia, |
| remissionem peccatorum, | |
| et carnis resurrectionem? | carnis resurrectionem? |
Auf den ersten Blick erkennbar ist, dass der zweite – christologische – Artikel im Sacramentarium Gelasianum Vetus viel weniger entfaltet ist als in der Traditio apostolica und im oben zitierten Romanum (markellischer oder rufinischer Provenienz). Während die Fragen nach Gott, Geist, Kirche, Sündenvergebung und Auferstehung im »Altgelasianum« und im Romanum praktisch identisch sind und lediglich in Bezug auf die Sündenvergebung ein Unterschied zur Traditio apostolica festzustellen ist, beschränken sich die christologischen Prädikate hier auf Jesus Christus als eingeborenen Sohn Gottes und unseren Herrn sowie auf seine Geburt und Passion. Der Modus dieser Geburt – in der Traditio apostolica und im Romanum durch den doppelten Verweis auf Geist und Jungfrau markiert – und der Verlauf der |42|Passion sowie deren Folgeereignisse werden dagegen nicht erwähnt. Handelt es sich eingedenk der oben erwähnten Datierung des Sakramentars in das 7. Jahrhundert um eine spätere Modifikation, um eine parallele Fassung oder – gegen den ersten Anschein – gar um eine ältere, im Romanum erweiterte Form des christologischen Artikels?
Die Dinge liegen in der Tat kompliziert. Wie Wolfram Kinzig gezeigt hat,[75] existieren von der Spätantike bis zur Reformationszeit zahlreiche Formen der Tauffragen, sowohl mit einem kurzen zweiten Artikel (natum et passum) als auch mit erweiterten christologischen Prädikaten. Ein Zeitpunkt oder ein sachlicher Anlass, an bzw. aus dem dieser Artikel gekürzt worden wäre, lässt sich nicht dingfest machen. Um zu erklären, warum die Tauffragen im ersten und dritten Artikel des Sacramentarium Gelasianum Vetus mit dem Romanum identisch sind, der zweite Artikel aber sehr viel knapper ist, argumentiert Kinzig, dass die in dem frühmittelalterlichen Sakramentar tradierten Tauffragen älter sein müssen als das Romanum. Sie gehen mindestens auf das 3. Jahrhundert zurück, wo, wie erwähnt, Cyprian die Verwendung von Tauffragen in Rom bezeugt.[76] Den sachlichen Anlass zu Textveränderungen im Sinne eines ausführlicheren Christussummariums wie im Romanum findet Kinzig nun in der Diskussion um »monarchianische« Theologen in Rom wie Noët, Calixt und vor allem Praxeas: Diese bestimmten um das Jahr 200 den theologischen Diskurs in Rom, indem sie in antignostischer Absicht die Einheit Gottes, d.h. seine μοναρχία, in den Vordergrund stellten.[77] Dagegen argumentierte Tertullian, dass die Akzentuierung der Einheit nicht auf Kosten der Dreiheit, d.h. der Unterscheidung von Vater, Sohn und Geist gehen dürfe, und untermauerte dies in verschiedenen Traktaten mit Summarien des Christusgeschehens, die dem im Romanum auffallend ähneln.[78] Das Resultat dieser Diskussion war offensichtlich, dass die schlichte Beschreibung des irdischen Wirkens Christi mit natum et passum nicht mehr hinreichend präzise erschien, sondern |43|dass es ausführlicherer Bemerkungen sowohl zu seinem Kommen in die Welt als auch zu den Stationen seines Leidens und Sterbens einschließlich dessen Umkehrung durch Auferstehung und Himmelfahrt bedurfte, um einerseits das Heilshandeln Christi zureichend zu bestimmen und andererseits dem Eindruck zu wehren, das alles habe der eine, transzendente, leidenslose Gott getan, ja erlitten. Die christologische Taufunterweisung hatte, wenn man so sagen darf, ihre Unschuld verloren; und dass mit der Erweiterung des zweiten Artikels noch keineswegs eine definitive Antwort gegeben war, sondern man vielmehr die Büchse der Pandora überhaupt erst geöffnet hatte, zeigen die anhaltenden trinitätstheologischen und christologischen Debatten des 4. bis 7. Jahrhunderts.
Für die hier behandelte Fragestellung ist Kinzigs m.E. sehr plausible These weiterführend, dass die Tauffragen des »Altgelasianums« sogar als Quellen für das 2. Jahrhundert gelten und damit das »missing link« zwischen frühen konfessorischen Formeln im Neuen Testament sowie bei den Apologeten und der späteren Produktion von Bekenntnissen darstellen könnten.[79] Wann freilich die Tauffragen um einen erweiterten zweiten Artikel ergänzt wurden, ob dies vor der Entstehung des Romanums geschah oder ob hier eine Rückwirkung des werdenden Apostolikums auf die Tauffragen, die oft einen längeren christologischen Teil besitzen, zu veranschlagen ist, wie sich das über Jahrhunderte hinweg in Rom in Gebrauch befindliche Altgelasianum präzise zu den Tauffragen der Traditio apostolica und zur Verwendung des Nizäno-Konstantinopolitanums in der römischen Taufliturgie seit dem 6. Jahrhundert[80] verhält, während sich ansonsten im Abendland überall Formen des Apostolikums durchsetzten – das sind Fragen, die noch einer befriedigenden Antwort harren. Festzuhalten ist, dass das |44|Werden des Apostolikums als Bekenntnistext von seiner Vorgeschichte in Form von Tauffragen zu unterscheiden ist, bei starker Kontinuität im ersten, leichtem Wachstum im dritten und erheblichen Zuwächsen im zweiten Artikel.