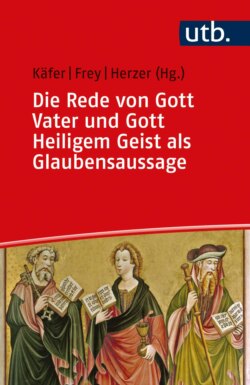Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 15
5. Fazit: Das vielfältige Werden des einen Glaubensbekenntnisses
ОглавлениеMit dem 4. und den folgenden Jahrhunderten sei, wie in der Forschung (nicht nur) zu Glaubensbekenntnissen verschiedentlich beklagt worden ist, eine »Zeit liturgischer Starrheit und Uniformität« angebrochen.[112] Auch über den Katechumenat, in dessen Zentrum die Belehrung über den christlichen Glauben stand, wurde noch vor nicht allzu langer Zeit geschrieben, dieser sei »als Institution in der Kirche des Römischen Reiches schon lange vor der Amtszeit des Ambrosius als Bischof von Mailand verfallen« gewesen.[113] Ambrosius und seine Zeitgenossen in der zweiten Hälfte des 4. und in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts wären demnach lediglich Sachwalter einer einst blühenden, jetzt aber vom Massenansturm der Taufwilligen |56|erdrückten Praxis der Glaubensunterweisung gewesen – und das Romanum und andere Texte wären entsprechend eine Notmaßnahme, um eine Basisration an Glaubenswissen unters Volk zu bringen, wie gut oder schlecht dies auch verstanden worden wäre. Das Bemühen der Apostel, gemäß dem Auftrag ihres auferstandenen Herrn »alle Welt zu Jüngern zu machen«, wäre dann gewissermaßen am eigenen Erfolg gescheitert – und das Apostolikum müsste als Symptom dieses Pyrrhussieges der apostolischen Mission gelten.
Wie die letzten Abschnitte gezeigt haben, kann und muss das Werden des Apostolikums aber keineswegs als Inbegriff einer Dekadenzgeschichte beschrieben werden (und auch die Urteile über die Taufunterweisung in der Reichskirche fallen in neuerer Zeit differenzierterer aus, als das obige Zitat suggeriert). Vielmehr gab es gerade in dem Bereich, der für den vorliegenden Band von Interesse ist, weniger einen dramatischen Niedergang als signifikante Transformationen. Das bedeutet nicht, die eine »goldene Zeit« – die Märtyrerkirche der vorkonstantinischen Jahrhunderte mit ihrem spontanen Bekenntnis »Ich bin Christ, ich bin Christin!« – durch eine andere – die triumphierende Reichskirche mit ihren elaborierten Glaubensformeln – zu ersetzen. Vielmehr könnte man von Konjunkturen des Apostolischen sprechen, und hier ist das 2. Jahrhundert mit den apokryphen Apostelakten, der apostolischen Sukzession und den frühen Glaubensregeln ebenso eine Epoche sui generis wie die Reichskirche mit ihrem Bestreben, das apostolische Erbe theologisch eindeutig, katechetisch nutzbar und frömmigkeitspraktisch anwendbar zu formulieren. Dazu bedurfte es ganz offensichtlich mehrerer Anläufe: Bis das Werden »des« Apostolikums zur Einheitlichkeit eines Textus receptus gediehen war, sollte es Jahrhunderte dauern, und diesem Prozess eignet eine spezifische Unübersichtlichkeit, die ich zumindest andeuten wollte. Umgekehrt haben die Ausführungen zu den Unterschieden zwischen den einzelnen Bekenntnistexten aber auch gezeigt, dass im 4. Jahrhundert der Grundbestand unstrittig war und in der Folgezeit in allen Regionen stabil blieb – das Apostolikum führt unhinterfragt mit, was zu früheren Zeiten unter Inanspruchnahme des Apostolischen ausgehandelt und festgestellt worden war, z.B. dass von einem Gott und von Jesus Christus als dem einen Erlöser zu sprechen sei. All dies ist bei der Herausbildung von deklaratorischen und katechetisch genutzten Bekenntnissen schon vorausgesetzt. In dem Moment, als das Apostolische in Textform gefasst wurde, stand es inhaltlich schon weitgehend fest – bemerkenswerterweise haben |57|die trinitätstheologischen Diskussionen im Westen in der Tradition katechetischer (und später liturgischer) Bekenntnisse keine Spuren hinterlassen, und das Athanasianum, in dem das greifbar ist, hat für die kirchliche Praxis nur geringe Bedeutung gewonnen. Das Nizäno-Konstantinopolitanum stellt diesbezüglich einen Sonderfall dar, denn trotz (oder wegen?) des Teilartikels über Einziggeborenheit, Präexistenz und Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater wurde es in Byzanz, aber auch im Westen zu einem liturgisch verwendeten Bekenntnis (und in Rom für Jahrhunderte zum Taufbekenntnis). Aber das ist eine andere Geschichte.[114]
Die Entwicklung im Westen war, wie beschrieben, von einer Vielfalt von Bekenntnistexten geprägt. Auch hier war es aber nicht so, dass sich das Apostolikum (um Karl Barths Diktum über den biblischen Kanon abzuwandeln) der Kirche »imponiert« hätte, vielmehr wurde der uns vertraute Text erst durch reformfreudige karolingische Könige reichsweit bis nach Rom eingeführt. Dem apostolischen Charakter der zahlreichen in Gebrauch befindlichen Bekenntnistexte tat das grundsätzlich keinen Abbruch. Es war gerade die Vielfalt von Varianten und Traditionen, die mit der Berufung auf den apostolischen Ursprung, ja auf die von allen Aposteln stammende Formulierung des einen Glaubensbekenntnisses eingehegt werden sollte. Was herauskam, war – zumindest für einige Jahrhunderte – gesteigerte, verwirrende, aber im historischen Rückblick auch ermutigende Pluralität. »Das« Apostolikum war lange im Werden, und dieses Werden war von theologischer Folgerichtigkeit wie von Kontingenzen geprägt. Es ist erstaunlich, welche Karriere ein Bekenntnis machte, das mit den Aposteln selbst nur vermittelt zu tun hatte – es war eben nicht »ein Symbol, welches nur etwa zwei Menschenalter von der apostolischen Zeit entfernt liegt und direct oder indirect die Wurzel aller Symbole der Christenheit geworden ist«, wie Harnack meinte.[115]
Über die Inhalte des Apostolikums und ihre Deutung wird in dem vorliegenden Band vor allem das Gespräch zwischen exegetischer und systematisch-theologischer Wissenschaft geführt. Der Beitrag eines |58|Kirchengeschichtlers konnte dabei nur darin bestehen, ein Stückchen historische Aufklärung beizusteuern. Insofern aber in Gottesdiensten und bei anderen Gelegenheiten der Glaube in Verbundenheit mit der communio sanctorum bekannt wird, die nicht nur gegenwärtige Räume, sondern auch vergangene und – so hoffen wir – künftige Zeiten umfasst, ist die Besinnung auf die geschichtliche Entstehung des Credos und die dabei obwaltenden Kontingenzen weit mehr als nur der Rahmen für das »Eigentliche«. Historische Tiefenschärfe in die Betrachtung einzubeziehen, dürfte vielmehr unmittelbar dazu beitragen, diesen grundlegenden Baustein unserer konfessionellen und ökumenischen Tradition in evangelischer Freiheit wahrzunehmen, zu schätzen und bewusst im Munde zu führen.