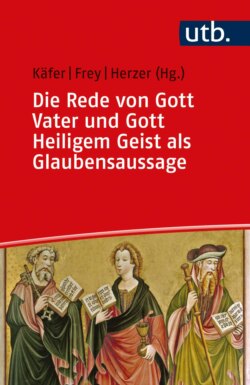Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 14
|48|4.2. Pneumatologische und ekklesiologische Zugewinne
ОглавлениеDem inhaltlichen Aspekt dieser Pluralität soll ein letzter Gedankengang gewidmet sein. Vorausgeschickt sei, dass die Abweichungen unter den Texten nicht immer theologisch sinntragend waren, weshalb es im Folgenden nicht darum gehen kann, sämtliche Unterschiede zwischen den bisher diskutierten und noch vielen anderen Textfassungen zu behandeln. Ich beschränke mich auf einen Vergleich zwischen dem Romanum und dem Apostolikum:[88]
| Romanum (R) | Apostolikum (T) |
|---|---|
| Credo in deo, patre omnipotente, | Credo in deum, patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae. |
| et in Iesu Christo unico filio eius, domino nostro, | Et in Iesum Christum filium eius unicum, dominum nostrum. |
| qui natus est de spiritu sancto ex Maria virgine, | Qui conceptus est de spiritu sancto natus ex Maria virgine. |
| crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, | Passus sub Pontio Pilato crucifixus, mortuus et sepultus. |
| Descendit ad inferna. | |
| tertia die resurrexit; | Tertia die resurrexit a mortuis. |
| ascendit in caelos; sedet ad dexteram patris; | Ascendit ad caelos; sedit ad dexteram dei, patris omnipotentis. |
| inde venturus iudicare vivos et mortuos; | Inde venturus iudicare vivos et mortuos. |
| et in spiritu sancto, | Credo in spiritum sanctum. |
| sanctam ecclesiam, | Sanctam ecclesiam catholicam. |
| remissionem peccatorum, | Sanctorum communionem, remissionem peccatorum. |
| carnis resurrectionem. | Carnis resurrectionem, vitam aeternam. |
Da der vorliegende Band dem ersten und dritten Artikel des Apostolikums gewidmet ist und es schon einen weiteren Band zum zweiten Artikel gibt,[89] konzentriere ich mich auf den ersten und den dritten Artikel. Entsprechend werden die Unterschiede im christologischen |49|Abschnitt übergangen, einschließlich des – wie gesehen – erstmals bei Rufin als Glaubensartikel bezeugten descensus ad inferna.[90]
Blicken wir auf den ersten Artikel des Apostolikums, so bildet die Schöpfertätigkeit Gottes (creatorem caeli et terrae) einen Überschuss gegenüber dem Romanum, womit freilich nur aufgegriffen wurde, was in östlichen Bekenntnissen seit jeher präsent war, allen voran das Nizänum und das Nizäno-Konstantinopolitanum, und was auch in der westlichen Theologie in der Spätantike keinen Diskussionsgegenstand bildete.[91] Präziser wäre zu sagen, dass im Nizänum vom »Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge« (πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν) die Rede ist, während »Himmel und Erde« erst das Bekenntnis von 381 benennt. Eine vergleichbare Varianzbreite von Aussagen ergeben die lateinischen Texte ausweislich des von Kinzig gesammelten Materials: So bietet Caesarius von Arles (†542) in einer als Expositio vel Traditio Symboli überlieferten Predigt einen dem Apostolikum schon weitgehend entsprechenden Bekenntnistext mit creatorem caeli et terrae,[92] allerdings ohne in der Erklärung darauf einzugehen. Hingegen spricht eine noch ins 5. Jahrhundert zu datierende, also vergleichsweise frühe anonyme Expositio de fide catholica von Gott dem Vater als invisibilem visibilium et invisibilium conditorem.[93] In Credotexten aus dem 4. und 5. Jahrhundert fehlt der Passus ansonsten überwiegend, wie die Bekenntnistexte, die aus der Explanatio symboli des Ambrosius von Mailand oder aus den Predigten der Bischöfe von Ravenna und Rom, Petrus Chrysologus (†458) |50|und Leo I. (†461), rekonstruiert werden können, belegen.[94] Kellys Beobachtung: »Lange Zeit scheint die westliche Tradition zwischen conditorem und creatorem geschwankt zu haben«,[95] ist so nicht aufrechtzuerhalten, da tatsächlich nur wenige Textzeugen für conditorem zu finden sind.[96] Wo der Schöpfer überhaupt erwähnt wird, steht fast durchweg creatorem, wobei dieses Prädikat erst in karolingischer Zeit endgültig als Textbestandteil durchgesetzt worden zu sein scheint.
Als Problem erschienen solche Zusätze offenbar nicht, selbst wenn es sich nicht um kleine Änderungen, sondern um dogmatisch relevante Varianten handelte[97] – und darum handelt es sich bei den ekklesiologischen Präzisierungen catholicam und vor allem sanctorum communionem. Beide Wendungen erscheinen zuerst im Bekenntnis des Niketas von Remesiana (um 370/375),[98] etwas später auch in einem pseudo-hieronymianischen Bekenntnis, der sogenannten Fides Hieronymi.[99] Das Prädikat »katholisch« reflektiert, was die seit jeher als »allumfassend« betrachtete Kirche im 4. Jahrhundert tatsächlich auch quantitativ, geographisch und politisch wurde. Es ist kein Zufall, |51|dass die »heilige katholische Kirche« erstmals in einem lateinischen Bekenntnistext bei Niketas begegnet, einem Bischof aus Dakien, der quasi auf der sich verfestigenden Grenze zwischen Ost und West lebte und diese literarisch überbrückte, auf jeden Fall aber die Taufkatechesen Kyrills von Jerusalem kannte und nutzte,[100] beschrieb letzterer doch die Katholizität der Kirche knapp und pointiert:
»Die Kirche heißt katholisch, weil sie auf dem ganzen Erdkreis, von dem einen Ende bis zum anderen, ausgebreitet ist, weil sie allgemein und ohne Unterlaß all das lehrt, was der Mensch von dem Sichtbaren und Unsichtbaren, von dem Himmlischen und Irdischen wissen muß […].«[101]
Die »katholische« Kirche ist also nicht nur der Raum, in dem Christen auf aller Welt miteinander leben, sie vermittelt auch die notwendige und d.h. orthodoxe Lehre – womit implizit Bischöfe, Katecheten und andere ekklesiale Lehrer die Katholizität sowohl vermitteln als auch verkörpern. Was daraus resultiert, ist – mit einem weiteren Begriff, der seit dem späten 4. Jahrhundert in die Bekenntnistradition hineingelangt – die »Gemeinschaft der Heiligen«. Der Begriff sanctorum communionem spricht dabei gleich mehrere Dimensionen an: die Gemeinschaft am Heiligen, d.h. an den eucharistischen Elementen; das Bewusstsein, dass die »katholische« Gemeinschaft Zeit und Raum übersteigt und auch die Verstorbenen einbezieht; schließlich die Vorstellung der Gemeinschaft von und mit »besonderen«, später »kanonisierten« Heiligen.[102] Es ist deutlich, dass die Textgeschichte des Apostolikums Wandlungen der kirchlichen Praxis und des Kirchen- und Frömmigkeitsverständnisses reflektiert. Zugleich implizierte die Polyvalenz eines Begriffs wie sanctorum communio Deutungsoffenheit: Mit der Präzisierung des Bekenntnistextes war die Frage, was an der Kirche und wer in der Kirche heilig sei, nicht beantwortet, sondern allererst gestellt. Die Ambiguität des Bekenntnistextes in Bezug auf lebende und tote, normale und besondere Heilige bringt Niketas von Remesiana in seiner Auslegung des Credos differenziert zu Ausdruck:
|52|»Nach dem Bekenntnis zur seligen Trinität sollst du nun bekennen, dass du eine heilige katholische Kirche glaubst. Was ist aber die Kirche anderes als die Versammlung aller Heiligen? Denn von Anbeginn der Welt an sind alle, die [Heilige] waren, sind oder sein werden – seien es die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob, seien es die Propheten, Apostel und Märtyrer, seien es die übrigen Gerechten –, eine Kirche, weil sie durch einen Glauben und durch eine Lebensführung geheiligt, mit einem Geist bezeichnet, zu einem Leib gemacht sind. Als das Haupt dieses Leibes wird uns Christus gezeigt, wie geschrieben steht [Eph 1,22; 5,23; Kol 1,18]. Um es noch deutlicher zu sagen: Auch die Engel, auch die übernatürlichen Gewalten und Mächte sind in dieser einen Kirche zu einem Bund vereinigt, wie der Apostel uns lehrt [Kol 1,20], weil in Christus alles versöhnt ist, nicht nur was auf Erden, sondern auch was im Himmel ist. Also glaube, dass du in [sc. nur als Glied] dieser Kirche der Gemeinschaft der Heiligen folgen wirst. Wisse, dass es eine katholische Kirche ist, die auf dem ganzen Erdkreis gegründet ist – die Gemeinschaft mit ihr sollst du unerschütterlich bewahren. Es gibt auch gewisse Pseudo-Kirchen, aber mit diesen sollst du nichts gemein haben (ich meine diejenigen der Manichäer, Kataphryger [sc. Montanisten], Marcioniten und all der anderen Häretiker und Schismatiker), weil sie aufgehört haben, zu jener heiligen Kirche zu gehören, insofern sie – von dämonischen Lehren verführt – anders glauben und anders handeln, als es Christus, der Herr, befohlen hat und als es die Apostel überliefert haben.«[103]
Die Traditions- und Interpretationsgeschichte der communio sanctorum im Westen ist lang und verwickelt;[104] sie kann hier nicht nachgezeichnet werden. Festgehalten sei aber, dass am Anfang dieser Geschichte nicht die exklusive Perspektive der besonderen – später dann |53|kanonisierten – Heiligen stand, sondern eine Hoffnungsperspektive für alle Christen, die in der Zweideutigkeit der Jetztzeit lebten. Sogar ein Theologe wie Augustin, der zu Beginn seiner kirchlichen Karriere dem Heiligenkult und dem damit verbundenen Wunderglauben sehr skeptisch gegenüberstand, entfaltete am Ende von De civitate dei ein solches Panorama einer über Zeiten und Räume hinweg verbundenen Kirche:
»In der Offenbarung [20,4] heißt es: ›Und die Seelen derer, die um des Zeugnisses von Jesus willen und um des Wortes Gottes willen getötet sind […] herrschten mit Jesus tausend Jahre.‹ Gemeint sind die Seelen der Märtyrer, denen ihre Leiber noch nicht zurückgegeben wurden. Denn die Seelen der verstorbenen Frommen sind nicht etwa von der Kirche getrennt, die schon jetzt das Reich Christi bildet. Denn sonst würde ihrer nicht am Altar in der Gemeinschaft am Leib Christi gedacht werden […] Nur die Seelen der Märtyrer aber erwähnt Johannes hier, weil diese Toten, die bis zum Tode für die Wahrheit stritten, vornehmlich zum Herrschen berufen sind. Doch vom Teil aufs Ganze schließend müssen wir dies so verstehen, dass auch die übrigen Toten zur Kirche gehören, die das Reich Christi ist.«[105]
Dazu passt, dass ganz am Ende des dritten Artikels noch eine weitere Änderung gegenüber dem lateinischen Romanum erscheint: vitam aeternam (während Markells griechische Fassung des Romanums bereits ζωὴν αἰώνιον bietet). Nach Kelly sollte diese Ergänzung dem Eindruck entgegenwirken, »die Auferstehung der Gläubigen folge eher dem Beispiel des Lazarus als dem Christi«;[106] es sollte demnach die Furcht ausgeräumt werden, nach der Auferstehung sei mit einem weiteren physischen Tod zu rechnen. In der Tat wandte sich Augustin gegen solche Vorstellungen und betonte, dass die Auferstehung des Fleisches derjenigen Christi gleiche und zu ewigem Leben führe (wenn auch durch das Endgericht hindurch).[107] Daneben ist aber |54|schon bei Kyrill von Jerusalem zu beobachten, dass die Klausel καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον nicht nur den andauernden Realitätsgehalt der Auferstehung begründete, sondern sich darüber hinaus auf das Reich Gottes richtet, in dem die Auferstandenen verweilen würden: »Der Vater ist wirklich und wahrhaftig das Leben […] Das ewige Leben aber hat er in seiner Menschenfreundlichkeit uns Menschen untrüglich verheißen.«[108] Auch Niketas von Remesiana verstand diesen letzten Satz des Bekenntnisses als exklusive Verheißung ewigen Lebens für Christen, die auf Erden keusch gelebt hatten.[109] Die entscheidende Frage scheint demnach nicht zu sein, warum dieser Satz im Apostolikum steht, sondern warum er im Romanum fehlt – denn er begegnet in der großen Mehrheit der überlieferten Bekenntnistexte, und zwar in allen Epochen und Regionen. Das Romanum und die Traditio apostolica belegen also einen Sonderweg. Dass ausgerechnet der römischen Gemeinde das ewige Leben nicht so wichtig erschienen sei, wäre allerdings eine überzogene Schlussfolgerung.
Hingewiesen sei zum Schluss noch auf eine Variante, die das ewige Leben ausdrücklich an die Kirche zurückbindet: Augustin und einige seiner nordafrikanischen Zeitgenossen verwendeten offenbar das Credo mit dem abschließenden Satz vitam aeternam per sanctam ecclesiam.[110] Diese Wendung findet sich auch bereits bei Cyprian von |55|Karthago (†258) in einer Auseinandersetzung mit der um Novatian gescharten Gruppe von Konfessoren in Rom, die offenbar die Tauffrage »Glaubst du an die Vergebung der Sünden und an das ewige Leben durch die heilige Kirche?« verwendeten – woraufhin Cyprian ergänzte: »Sie lügen bei der Befragung, denn sie haben die Kirche gar nicht!«[111] Ewiges Leben konnte es nach Cyprians Ansicht nur durch die richtige Kirche geben, von der sich die Novatianer schuldhaft getrennt hatten. Diese Argumentation setzt freilich die Heiligkeit der Kirche voraus, die unter irdischen Bedingungen – wie nicht zuletzt Augustin selbst in seiner großen Schrift De civitate dei argumentiert hat – stets im Zweideutigen verbleibt und nur als geglaubte den Weg zum ewigen Leben bereiten kann. Dieses differenziertere Verständnis der »heiligen Kirche« dann auch liegt dem entstehenden Apostolikum sachlich zugrunde.