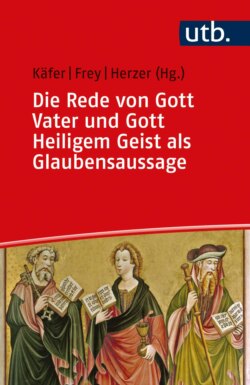Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 13
4. Vom Altgelasianum zum »Textus receptus« des Apostolikums 4.1. Lehrbekenntnisse und katechetisch gebrauchte Bekenntnisse
ОглавлениеNachdem wir das Werden des Apostolischen Glaubensbekenntnisses von neutestamentlichen Zeugnissen bis zu den ersten Textzeugen des Romanums (2.) und von diesem zurück zu den Tauffragen des Altgelasianums (3.) verfolgt haben, bleibt nun noch, diesen Weg ein weiteres Mal abzuschreiten, diesmal wieder in korrekter chronologischer Richtung. Es ist unstrittig, dass sich die Herausbildung bündiger Formeln des christlichen Glaubens biblischen Vorbildern verdankt. Dazu gehört insbesondere 1 Kor 8,6 (»So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn«), sozusagen ein Archetyp des zweigliedrigen Bekenntnisses zu Gott dem Vater und Christus dem Herrn, das im 2. Jahrhundert freilich schon regelmäßig mit triadisch strukturierten Formeln verbunden wird, in denen die Wirkung des Taufbefehls in Mt 28,19f. zutage tritt.[81] Offenbar erfuhr die trinitarische Grundstruktur schon bald eine christologische Erweiterung; die Tauffragen des Sacramentarium Gelasianum Vetus, die, wie gesehen, wohl bis ins 2. Jahrhundert zurückgehen, bieten mit natum et passum eine Kurzform der Christologie, die angesichts der nun aufbrechenden Fragen über das Verhältnis von Gott Vater und Sohn bzw. von Gott und Mensch in Christus als nicht mehr suffizient erschien. Das bedeutet einerseits, dass wir zwar nicht das Apostolikum als Bekenntnistext, wohl aber den in charakteristischer Weise ausgebauten christologischen Teil im Werden beobachten |45|können, wie er sowohl zur konzisen Bekräftigung des Christusglaubens bei der Taufe als auch in antihäretischer Absicht in Glaubensregeln formuliert wurde.[82] Beides ist freilich zu unterscheiden: Von den Glaubensregeln führt kein direkter Weg zur Taufunterweisung anhand von Bekenntnissen, wie es seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts üblich wurde, sondern allenfalls zu »Privatsymbolen« oder, wie man zutreffender sagen könnte, zu »Theologenbekenntnissen« – diese finden wir zuerst im 3. Jahrhundert bei Heraclides in seiner Disputation mit Origenes,[83] dann bei Arius (†336) und bei Markell von Ankyra. Ob dieser das Romanum selbst ad hoc formulierte, muss aus den oben genannten Gründen offenbleiben; doch selbst wenn er einen bereits vorliegenden Text zitiert, bleibt der Befund, dass weder Markell noch Julius von Rom ausdrücklich sagen, dass es sich um ein in der römischen Gemeinde seit jeher bekanntes und gebrauchtes Bekenntnis handelt. Der »Sitz im Leben« dieses Textes bleibt unklar, was für Uta Heils Hypothese einer anlassbezogenen Formulierung nicht durch Markell, sondern durch die römische Synode spricht.
Hinzu kommt, dass, wie gesehen, die Tauffragen der Traditio apostolica keineswegs sicheren Aufschluss über die Frühgeschichte des Romanums geben und dass die Herausbildung dogmatisch-polemischer deklaratorischer Bekenntnisse sich generell der neuen Situation der werdenden Reichskirche verdankt. Man darf daher mit Kelly und Ritter das Konzil von Nizäa als Ort einer symbolgeschichtlichen »großen Revolution«[84] ansehen. Dann wäre aber auch die Einführung von Bekenntnissen in die vorösterliche Taufunterweisung, die wir erstmals 351 in Jerusalem dokumentiert finden, nicht ein Ergebnis der antihäretischen Diskussionen der vorkonstantinischen Zeit, sondern stünde im Zusammenhang der Institutionalisierung des Katechumenats in |46|der Spätantike.[85] Die Taufunterweisung erfuhr offenbar um die Jahrhundertmitte an mehreren Orten eine vergleichbare Strukturierung, die uns vor allem durch katechetische Predigten, später dann auch durch die diesen zugrundeliegenden Bekenntnissen zugänglich ist. Dieser Usus verdankte sich den veränderten katechetischen Bedürfnissen angesichts steigender Zahlen von Taufbewerbern, aber auch theologischer Debatten in den Gemeinden: Im Kontext der beschleunigten Debatte über trinitätstheologische Fragen war positiv wie negativ eine klarer fassbare Eindeutigkeit der Glaubensinhalte gefragt. Doch geht es nicht darum, diese Entwicklung als Indikator einer schweren Krise zu beschreiben, wie es schon manche Zeitgenossen taten. Das würde der Virtuosität nicht gerecht, mit der Bischöfe und Katecheten der veränderten Situation begegneten. Zweifellos stellte der wachsende Zustrom von Taufbewerbern und am Christentum Interessierten in die Gemeinden eine Herausforderung für das katechetische Handeln dar. Die erhaltenen Predigtreihen aus Jerusalem (Kyrill), Antiochien (Johannes Chrysostomus), Mopsuestia (Theodor), Hippo (Augustin) oder Ravenna (Petrus Chrysologus) machen allerdings nicht den Eindruck der Schnellabfertigung!
Der Trend der Zeit, dogmatische Positionen in Form deklaratorischer Bekenntnisse zu formulieren, hatte also in der Katechese eine signifikante und nachhaltige Parallelentwicklung – die innerhalb der neuen Gattung »Bekenntnis« zu einem Typ sui generis führte. Denn man muss die Lehrbekenntnisse, die sich nach dem von Vinzent so genannten »antilogisch-traditionellen Baukastenmodell« aufeinander beziehen und voneinander abgrenzen,[86] von katechetisch genutzten Bekenntnissen unterscheiden. Jene geraten teils überaus ausführlich und sind geprägt vom Streben nach möglichst präziser theologischer Terminologie (bisweilen auch von deren Vermeidung, wie die homöischen Bekenntnisse der späten 350er Jahre, die dann aber in anderer Weise ihren Punkt so genau wie möglich zu markieren trachten). Diese hingegen folgen sämtlich der Grundstruktur der Tauffragen und nehmen die immer differenzierteren christologischen Bestimmungen gerade nicht auf – schon das Nizänum, später dann das Nizäno-Konstantinopolitanum unterscheiden sich insofern signifikant von den |47|Bekenntnissen, aus denen sich das Apostolikum entwickelt. Das heißt nicht, dass es hier nicht um dogmatische Korrektheit ginge. Nicht nur das Einschärfen der Verbindlichkeit der Entscheidung für den Empfang der Taufe und das christliche Leben, sondern auch die Einweisung in den orthodoxen Glauben, ist bereits in den Katechesen Kyrills von Jerusalem zu beobachten, die, wie gesagt, erstmals die Verwendung eines lokalen Glaubensbekenntnisses dokumentieren.
Zwar findet später im Osten, wie die Katechesen Theodors von Mopsuestia (†428) zeigen, auch das Nizänum als katechetisches Bekenntnis Verwendung; hingegen bleibt es im Westen für traditio und redditio symboli bei einer Vielfalt lokaler Bekenntnisse, die weitgehend dem Romanum entsprechen, im Detail allerdings Besonderheiten aufweisen, die sich einer einfachen Erklärung entziehen.[87] Das 4. Jahrhundert erlebte insofern nicht nur dogmengeschichtlich, sondern auch bildungsgeschichtlich eine Revolution, und dies an vielen Orten gleichzeitig. Während die kirchengeschichtliche Forschung lange versucht hat, Bekenntnisse zu finden, wo es keine gibt, hat sie sich davon abhalten lassen, zu untersuchen, anhand welcher Gattungen und Texte zu welchem Zeitpunkt an konkreten Orten die Unterweisung von taufwilligen Christen tatsächlich vonstattenging. Bevor in karolingischer Zeit eine forcierte Durchsetzung des Apostolikums als Normbekenntnis erfolgte, herrschte – um es pointiert auszudrücken – eine gesteigerte Pluralität von apostolischen Glaubensbekenntnissen.