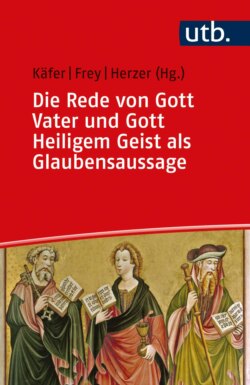Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 19
2. Gottesverehrung und Gottesbekenntnis
ОглавлениеDer Begriff der Gottesverehrung umfasst auch im Blick auf die Geschichte des Alten Israel die Vielfalt und Vielgestaltigkeit von Gottesvorstellungen und religiösen Praktiken, mit der sich in unterschiedlichen sozialen Kontexten die Gottesbeziehung der Menschen Ausdruck und Form gibt. In ihr bleiben Elemente der Mythen wie der heilsgeschichtlichen Narrationen einer ständig neuen Aktualisierung und Transformierung unterworfen.
Gottesbekenntnisse bilden indes Kern und Fokus einer identitätsbildenden Darstellung eines Vorstellungskomplexes, der von der sie initiierenden und explizierenden formbildenden Generation Schriftgelehrter in einer bestimmten historischen Auseinandersetzung formuliert und verschriftet wird, und, seine gemeinschaftsstiftende Deutungskraft vorausgesetzt, fortan als weithin durch die Religionsgemeinschaft anerkannte normative Gestalt erhält. Die Phasen der Ausbildung solcher Gestalten können annäherungsweise benannt und beschrieben werden. Gleichwohl nimmt bekanntlich die Religionspraxis, also die Gottesverehrung selbst, auf diese Gestalten keineswegs überall und zu allen Zeiten gleichermaßen Bezug, sodass immer ein Hiatus zwischen formulierter und erzählter Religion und gelebter und praktizierter Religion besteht. Da nun aber der diskursive Charakter der schriftgelehrten Fortschreibungsarbeit an dem Fluss der Auseinandersetzungen um beides immer Anteil hat, ergibt sich aus dem alttestamentlichen Schrifttum auch schon aus formalen Gründen keine gedanklich geschlossene religiöse und philosophische Systematik und Lehre, sondern vielmehr eine Sammlung von anerkannten |63|Leittexten,[7] die ihrerseits nach stets neuer Deutung verlangen, welche wiederum auch nur auf diskursive Weise und strittig gewonnen werden kann. Die Einheit dieses Diskursfeldes ist durch den Gegenstand bestimmt und durch die Übereinkunft der gemeinsamen Orientierung auf diesen Gegenstand. Dass Jhwh der Gott Israels ist, muss darum immer wieder neu erkannt werden, so wie die andere Seite, dass und in welcher Hinsicht die Gemeinschaft der im Diskurs Stehenden das Volk des Gottes Israels sind. Es steht im Zeichen der Verschmelzung der alttestamentlichen Bundesformel und der Erkenntnisformel, wie sie die Priesterschrift in Ex 6,7 formuliert: »Und ich nehme euch an als mein Volk und ich werde euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass ich Jhwh, euer Gott, bin, der euch herausführt aus der Fron Ägyptens.«[8]
Hinzu kommt die Heterogenität der Gottesaussagen selbst. Die Zuschreibungen bestimmter Wirkmächtigkeiten und Eigenschaften an eine Gottheit, die mit dem Epitheton des »Vaters« verbunden sind, hat es in unterschiedlichsten Gestalten in den Religionen des Alten Orients gegeben, also auch in der alttestamentlichen Religion. Religionsphänomenologisch gibt es keine differencia specifica der Jhwh-Religion gegenüber den nicht-jahwistischen Religionen. |64|Gleichwohl war es im Überlebenskampf der Stammesgesellschaften der Levante im Verlauf der Geschichte des 1. Jahrtausends v. Chr. notwendig für Israel, um die Identität des Volkes zu wahren, eine mosaische Unterscheidung zu formulieren, was zu der durchaus sehr spezifischen Ausprägung der israelitischen Religion geführt hat.[9] Diese hat die Phasen ihrer Ausbildung in einem Narrativ ausgeprägt, der die eigene Religionsgeschichte als gestufte Offenbarungsgeschichte beschreibt, was dazu geführt hat, dass die Tradenda aus diesen Phasen jeweils in neuer differenzierter Rahmung und Neudeutung integriert werden konnten und keinesfalls alle abgestoßen werden mussten. Es ist auch nicht möglich, mythische Elemente der religiösen Metaphorik als eine frühe, unausgeprägte Entwicklungsstufe späterer systematisch-philosophischer Konzeptionen auszugrenzen. Auch unter den Bedingungen eines ausgeprägten monotheistischen Gottesbildes bleiben die Elemente des Mythischen als offensichtlich notwendige symbolische Formen religiöser Aussage erhalten und werden nur teilweise retuschiert oder umgedeutet.
Die Theologie wird also dazu tendieren, die Leitgedanken der konzeptionellen Formen der Gottesbekenntnisse zur Orientierung aufzunehmen und dabei die wechselhaften Impulse integrativer und exklusiver Prozesse in unterschiedlichem Gewicht zu verarbeiten. Für eine Theologie, die konsequent aus der Perspektive kontextueller Herausforderungen arbeitet, sind dabei integrative Prozesse meist interessanter als für eine Theologie, die nach Leitsätzen gemeinschaftsstiftender Narrative sucht. Keine Form der Theologie ist dabei frei davon, selbst Teil einer Religionsgeschichte zu sein und an deren Dynamiken mitzuwirken. Theologie ist selbst Teil einer bestimmten Form der Religionskultur, insofern aber diese von ihr auch reflektiert werden muss, bildet Theologie selbst auch eine reflexive kritische Systematik gegenüber der Religionskultur aus, an der sie gestaltenden Anteil hat.
Dies war schon eine Eigentümlichkeit der alttestamentlichen Schriftgelehrtheit und bestimmt insofern die normativen Texte, die |65|den Ausgangspunkt im Diskursgeschehen der jüdischen und christlichen Religionskulturen und Theologien bilden. Traditionsgeschichtlich sind an den Narrativen, die sie uns vermitteln, unterschiedlichste Ursprungselemente altorientalischer und israelitischer Gottesverehrung erkennbar, dennoch versuchen die Schriftgelehrten in immer neuen Anläufen, diese Elemente in eine einheitliche, sinnstiftende Erzählung zu gießen, die ihrerseits mit Mitteln der Mythenbildung operiert, um aus dieser hinwiederum Gottesbekenntnisse zu formen, die der Identitätsstiftung in ihrer jeweiligen Entstehungszeit dienen und in Verbindung von Ritus und Bekenntnis soziale und religiöse Integration ermöglichen. Dabei verarbeiten die Narrative historische und religiöse Erfahrungen in metaphorischen Gestalten und ermöglichen so die Generierung einer geschichtsbezogenen Verantwortung von theologischer Rede. Die Technik, die die Schriftgelehrten dabei anwenden, ist sowohl mit Hinsicht auf die einzelnen Elemente der heterogenen Gottesaussagen als auch mit Hinsicht auf die heterogenen Ausformungen ihrer Narrative die der komplementären Lesung, gleichsam der narrativen Gestalt eines Diskurses, in welchem harmonisierbare und widersprüchliche Elemente in ein narratologisches Verweissystem gebracht werden, aus welchem dann die Rezipienten ihrerseits anwendungsbezogene Auslegungen gewinnen können.[10] Wie auf diese Weise Religionsgeschichte und Theologie in ein diskursives Dienstverhältnis zueinander treten, möchte ich anhand des Beispiels der Diskussionen um die Ursprünge des Jahwismus veranschaulichen. Dazu soll zunächst die Vielfalt der gegenwärtigen Theorien über den Ursprung des Jahwismus (1) dargestellt werden. Sodann ist zu zeigen, dass der Pentateuch selbst eine Theorie von den Ursprüngen und der Entfaltung des Jhwh-Glaubens bietet, dabei allerdings die Form einer Narration über die stufenweise Selbsterschließung Gottes (2) ausbildet. Schließlich ist zu zeigen, wie sich spätere Schriftgelehrte in ihrer |66|Bearbeitung des Stoffes (3) zu dieser Theorie verhalten haben und wie sowohl hinsichtlich einer Protologie der Menschheitsgeschichte als auch hinsichtlich einer Eschatologie eine universale Offenheit der kanonischen Texte entsteht. In einem Ausblick sollen dann einige Folgen für das Verhältnis von historischer und theologischer Exegese bedacht werden.