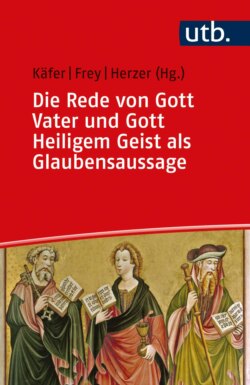Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 20
3. Theorien über die Ursprünge der Jhwh-Religion und der Rede von Gott als Vater: Mythos, Metaphorik und Narration
ОглавлениеWie immer eine christliche Theologie die metazeitliche und metasubjektive Wahrheit ihres Gottesgedankens begründet, sie muss sich darüber Rechenschaft geben, dass die der historischen Forschung zugänglichen Hinweise auf die Ursprünge des Jhwh-Glaubens nur annäherungsweise Rückschlüsse auf die hierin beteiligten Prozesse der Generierung und Ausformung der Jhwh-Religion zulassen und dass zweitens diese Religion menschheitsgeschichtlich eine ausgesprochen junge Gestalt repräsentiert. Das gilt nicht nur angesichts der Ausprägung der altorientalischen ägyptischen, sumerischen und mesopotamischen Hochkulturen und ihrer Religionen, sondern schon angesichts der monumentalen Zeugnisse neolithischer Kultanlagen aus dem 10. Jahrtausend v. Chr., beispielsweise vom Göbekli Tepe, die machtvoll zur Geltung bringen, dass die israelitische Religion zunächst einmal ein Spätling in der antiken Religionsgeschichte war. Sie muss also einen Weg finden zu plausibilisieren, dass sich in einer relativ spezifischen Religionsgeschichte eine Erfahrung manifestiert, die mit Hinsicht auf Ewiges und Infinites zu gültigen Aussagen führt. Der von Jürgen van Oorschot und Markus Witte edierte Sammelband über »The Origins of Yahwism«[11] bietet einen höchst instruktiven Einblick in die gegenwärtige Diskussion. Das bisher älteste Zeugnis einer Namensform YHW findet sich auf Inschriften in einem nubischen Amun-Tempel von Soleb aus der Zeit Amenhoteps III (ca. 1386–1349 v. Chr) und in einem Tempel in Amarah-West aus der Zeit Ramses II. (ca. 1279–1213) sowie in weiteren Namenlisten aus Medinet Habu aus der Zeit Ramses III (ca. 1221–1156). In diesen wird der Name in einer Reihe mit anderen lokalen Namen in Verbindung mit dem Beduinenstamm der Shasu aufgeführt, sodass er |67|zunächst einmal in einem lokalen Konnex zu verstehen ist. Neben den »Yahu-Shasu« gibt es noch »Se’îr-Shasu«, »Laban-Shasu« etc.[12] In welcher Beziehung diese lokalen Bezeichnungen zu einer Gottheit YHW stehen, lässt sich aus dem Material nicht erkennen. Gleichwohl wird es von einer Reihe von Exegeten als ein Indiz zur Unterstützung der Annahme angesehen, dass es eine solche Gottheit im Gebiet südlich des Negev und des Seïr im 13. und 12. Jahrhundert gegeben hat, dass somit das Narrativ von der Begegnung einiger aus Ägypten entwichener Hebräer im 12. Jahrhundert mit dieser Gottheit möglicherweise hier einen Anhalt hat.[13] Das Etymon Jhwh wird meist von einem verbalen Ursprung hergeleitet und als Gottesname i.S. eines Wettergottes oder auch eines Berggottes deutbar ist (»Er weht«).[14] Allerdings sind die ältesten Schichten der literarischen Überlieferungen, die von der wundersamen Errettung der Hebräer am Schilfmeer erzählen (Ex 14,21b)[15] als auch der literarische Kern der Erzählung von einer Theophanie des Wettergottes am Gottesberg |68|(Ex 19,16) nur noch annäherungsweise zu erahnen,[16] ein traditionsgeschichtlicher Zusammenhang des Etymons mit dementsprechenden Urerfahrungen von Rettung und Gottesbegegnung ist denkbar, die literarische Gestalt, in welcher dieser Konnex hergestellt wird, kann nur annäherungsweise in der vorexilischen Königszeit datiert werden.
Dass Jhwh der Gott der im ostjordanischen Gebiet ansässigen Israeliten war, bezeugt die moabitische Meschastele für die Mitte des 9. Jahrhunderts.[17] Älteste Stufen der Psalmen lassen hingegen Jhwh in Analogie zu nordwestsemitischen Wettergottheiten des sog. Baal-Hadad-Typos als einen ebensolchen Wettergott erscheinen (vgl. Ps 29,3–5*.7–9; 18,8–16*; 77,17–20; 65,10–14), der analog dem Baal im siegreichen Kampf gegen die Chaosmächte den Thron über Götter und Menschen erringt (Ps 24,7–10) und sodann auch als Königs- und Kriegsgottheit verehrt wird (Ps 29,1–2.9–10; Ps 93,1–5*), dessen Züge und Eigenschaften dem von Kanaanäeren verehrten Göttervater El gleichen.[18] Die Zuschreibung und Amalgamierung von Motiven des El-Mythos und des Baal-Mythos an die Jhwh-Gestalt sowie die ikonographische Assoziierung Jhwhs mit Cherubenthron, Stier, Götterberg (Zaphon, Sinai, Zion), Regentschaft im göttlichen Thronrat, die Rede von Jhwh als dem Gott der Zebaot, die analoge Prädizierung Jhwhs als ‘Elyôn, ausgestattet mit einem feurig leuchtenden Kavôd-Lichtglanz, ja, möglicherweise auch die Übernahme von ursprünglich an Baal oder El gerichteten Gebetstexten in den Jhwh-Kult,[19] all das zeigt allerdings, dass die Jhwh-Religion ihre charakteristische Ausprägung, wie sie in den ältesten literarischen Schichten des Alten Testaments zutage tritt, erst im Kulturraum der Königreiche |69|Israel und Juda und mit zunehmender Ausprägung einer israelitischen und judäischen Stadtkultur erhalten hat.[20] Mit der Überformung lokaler Traditionen und ihrer ursprünglich kanaanäischen Kulte kommt es zur Adaptation weiterer mythologischer Motivgruppen. So hat etwa Othmar Keel die umfängliche Prägung der Jerusalemer Tempel- und Lokaltradition durch solare Motivik aufgezeigt, die Glyptik bezeugt etwa die Übernahme der Symbolik der geflügelten Uräusschlangen, der Serafim, als deren Herr die Gottheit Jhwh gilt. Die Ausprägung einer Präsenzsymbolik durch die sphingischen Mischwesen des Cherubenthrones ist Anzeichen für eine umfängliche Ausprägung der mit dem Jhwh-Kult verknüpften Bildwelt, in deren vor-deuteronomistischen Gestalt die rettende Göttin Aschera Jhwh zur Seite getreten ist.[21] Kosmische Tempelideologie und göttliche Herrschaftslegitimation führen zu einer Anreicherung des mit Jhwh verknüpften mehrfach konnotierten Metaphern-Repertoires, auf das die hymnischen und narrativen Deutungstexte in immer neuen Varianten zugreifen.
Das gilt natürlich auch für das Motiv der göttlichen Vaterschaft, das in der Königsideologie Ägyptens am stärksten ausgeprägt ist, aber auch im hethitischen, sumerischen, babylonischen, assyrischen, ugaritischen und ptolemäischen und seleukidischen Kulturraum unterschiedliche Ausformungen erfährt.[22] Wie in Ugarit El so gilt auch |70|im judäischen Jerusalem Jhwh, der ja die Position des El Israels einnimmt, als Vater von Göttersöhnen (Ps 82,6; Gen 6,1–4) und Vater des Königs.[23] Im Kontext der Orakel zur Herrschaftslegitimation und Inthronisation spielt das Motiv eine wichtige Rolle (2 Sam 7,14–15; Ps 89,27f.31–34; 1 Chr 17,13; 22,10; 28,6f.). In Ps 2,7 haben sich über Jahrhunderte hinweg vermutlich aus frühester Zeit Anklänge an Einflüsse eines kanaanäisch-ägyptisch geprägten Königsprotokolls erhalten, die in dem aus makkabäischer Zeit stammenden Psalm 110,3 noch um solare Motive erweitert sind.[24] Die Deutung und Legitimierung neuer Herrschaftssituationen und damit der Neukonstituierung gesellschaftlicher, politischer und kultureller Konstellationen bedarf jeweils auch einer Neuformierung des mythologischen Repertoires im Sinne einer Reaffirmation und Transformation der religiösen Erfahrung und der mit ihr verbundenen Einsichten. Das führt zu einer Reihe jeweils neuer, programmatischer Königspsalmen, die dann – viel später – sogar zur Strukturierung der Psalmensammlung herangezogen werden können.
Ein Motiv der Königsideologie ist die göttliche Auffindung und väterlich-mütterliche Adoption eines Herrschers. Schon Sargon I., der Begründer des altassyrischen Reiches, nennt die Gottheit Enlil seinen Vater,[25] Gudea von Lagasch betet zur Göttin Gatumdu mit den Worten (Gudea Cyl. A IIII,6–7): »Für den, der keine Mutter hat, bist du die Mutter, für den, der keinen Vater hat, bist du der |71|Vater.«[26] In der sumerischen Gebetsliteratur wird der Himmelsgott Anu als abu shamê – himmlischer Vater – angeredet, in einem Shu-íl-lá Gebet an den Mondgott Sin heißt es: »Barmherziger, gnädiger Vater, in dessen Hand erfasst ist das Leben der Gesamtheit der Erde.«[27] Götter, Menschen, Könige und sozial Schutzbedürftige verehren in den Hochgöttern väterliche und mütterliche Aspekte und suchen bei ihnen Lebenskraft und Hilfe. In einem Hymnus des Assurbanipal an Ishtar von Arbela bekennt dieser etwa: »Ich kannte weder einen Vater noch eine Mutter, im Schoß meiner Göttinnen wuchs ich auf und die großen Götter erzogen mich wie einen Säugling.« (SAA 3,3 Z. 4. 13f.; V. 14–16).[28] Die Analogien der Auffindungsmythe Sargons und Moses sind hinlänglich aufgezeigt worden.[29] Bekannt ist das Motiv der Suche nach einem Herrscher durch Marduk im Kyroszylinder und durch Jhwh im Kyrosorakel (Jes 45,1–7).[30] In den Spruchsammlungen, die die Grundlage des Hoseabuches gebildet haben, wird – nach dem Verlust des Königtums von Ephraim – das Motiv der Erwählung des Sohnes auf Ephraim selbst übertragen: »Als Israel ein Knabe war, da liebte ich ihn und rief meinen Sohn aus Ägypten […]« (Hos 11,1). Von hierher findet es Eingang in die weitere Deutung der Geschichte Israels als erwähltes Volk, so in Verbindung mit der Einführung des Glaubensmotivs in Dtn 1,31–32, als Gegenstand der Gotteserkenntnis (Dtn 8,2–6). Sodann findet es Eingang in die redaktionelle Ausformung der nachexilischen Exoduserzählung im Motiv der Rettung des »Erstgeborenen Jhwhs« (Ex 4,22) und als Teil der Geschichtsreflexion in der schriftgelehrten Ausgestaltung der Prophetie (Jer [2,27]; 3,4.14.19.27; 31,9; Jes 63,8–9.16; 64,7; Mal 1,6; 2,10; 3,17). Im Horizont der Gebetsfrömmigkeit tritt Jhwh in den Blick als Schutzmacht der personae miserae: »Vater der Waisen, Richter der Witwen ist Elohîm in seiner heiligen Wohnung!« (Ps 68,6a).
|72|Der Gedanke der Vaterschaft Gottes wird zudem verschmolzen mit der Vorstellung einer Erschaffung des Einzelnen durch die providenziell wissende väterliche Gottheit im Dunkel der Erde, im Uterus der Frau (Ps 139,13–16): In dem Prophetengedicht des Mose Dtn 32,6 ist darum Jhwh Israels Vater und Schöpfer, der gleichwohl seine abtrünnigen Söhne und Töchter im Zorne verwirft (Dtn 32,19), doch sodann die Macht der fremden Götter bricht und sich als einziger, lebendig machender ewiger Gott erweist (Dtn 32,39–40), indem er Israel errettet. Mose blickt hier über das Ende des Exils hinaus in eine alles weitere Prophezeien umspannende eschatologische Zukunft, in der Israel als Mitte und Exemplum der Völkerwelt die Universalität des Wirkens des Gottes Israels veranschaulicht. So vermag an die Stelle des Königs den Ps 47,7 als Elohîm bezeichnet, von Gott selbst gesalbt und gesegnet, der Mensch in seiner Gottesebenbildlichkeit und Gottesnähe treten (Ps 8,6f.). Nicht das metaphorische mythische Repertoire der genannten Texte steht in einer differencia specifica zu den Gottesvorstellungen der Umwelt, sondern die je und dann aktualisierte und kontextualisierte Anordnung desselben im kulturellen, sozialpsychologischen, religiösen, metaphysischen und theologischen Deutungsraum Israels.[31]