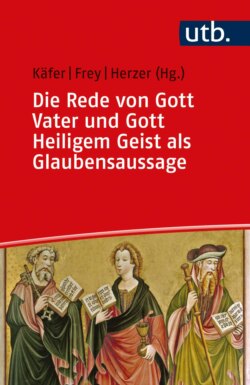Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 18
1. Theologie im Horizont der Religionsgeschichte
ОглавлениеDie alttestamentlich jüdische und damit auch die christliche Jhwh-Gottes-Verehrung hat ihren historischen Ursprung in der Religionsgeschichte des Alten Orients. Daran haben auch die symbolischen und metaphorischen Zuschreibungen an Wesen und Wandel der Gottheit des Abend- und des Morgenlandes ihren Anteil. Der Gedanke einer die Religionsgeschichte umgreifenden Wirklichkeit, die den Aspekt des Metaphysischen mit einschließt,[1] wird in der alttestamentlichen Gedankenwelt nicht abstrakt systematisch erfasst, wie auch ein Geschichtsgedanke nicht abstrakt gefasst wird. Anstelle dessen tritt im biblischen Hebräisch die Benennung von Vorgängen und Erzählungen als devarîm: Beide sind allein in der Gestalt eines Narrativs zu haben.[2] Die systematische Erfassung solcher Narration erfolgt einerseits in den Sinnstrukturen der Natur, die von dem Göttlichen wortlos Rechenschaft geben (Ps 19,2–5).[3] Diese wird als |60|Schöpfung aus einem göttlichen Reden verstanden. Der Gedanke der Erfassung von Wirklichkeit durch Narration stammt seinerseits aus der Tradition weisheitlicher Erziehung in Gestalt mündlicher und schriftlicher Lehren: Die väterlichen oder mütterlichen Reden nehmen Gestalt an durch Schriftgelehrte, sopherîm. Es sind also die Erzählungen, die die Wirklichkeit erschließen, und die in einer für den Menschen transzendenten Erschlossenheit des Wirklichkeitsbezugs ihren Ursprung erkennen.[4] Diese Identifikation wirkt sich im religiösen Bewusstsein bis heute aus, wenn nämlich in der Narration selbst die referenzielle Unterscheidung von Textebene und Sachebene changiert. Unterscheidet man aber zwischen dem Vorgang und der Erzählung, so bleibt doch das, was vom Vorgang erfassbar wird, wiederum lediglich der Stoff des Erzählten, der gleichwohl nun der historisch kritischen Betrachtung genauso unterliegt wie die Narration selbst.
Dennoch gibt es bekanntlich im Alten Testament eine Narration, die zwischen allgemeinmenschlichen religiösen Vorstellungsgehalten von der Welt des Göttlichen und der spezifischen Erfassung derselben in der Epoche der Ursprünge der Religion Israels unterscheidet. Somit wird innerhalb der religiösen Narration selbst eine Erzählung von den Ursprüngen der Religion in einem allgemeinen humanen Sinne möglich in Gestalt der Elohîm-Theologie des Pentateuch. Hinzu kommt, dass der – auch für das Bewusstsein der jüdischen Weisheit – infinite Charakter der vorfindlichen Wirklichkeit und der dahinterstehenden Gottheit (Prov 8; Hi 28)[5] auch für den Prozess |61|weisheitlich-gedanklicher Erschließung bedeutet, dass dieser zwangsläufig infinit sein muss. Der Pluralität der im Universum zu erfassenden Phänomene, die das »Spiel der Weisheit vor Gott« hervorgebracht hat, entspricht darum selbst im Horizont der alttestamentlichen Schriftensammlung eine Pluralität der Narrationen, die nun ihrerseits das Universale nur dadurch abbilden kann, dass sie sich selbst im Horizont der Gegenwart, des Angesichts Gottes expliziert und so sich selbst und die Welt versteht und deutet, also in demütiger Ehrfurcht wie in lustvoller Abbildhaftigkeit, und dass dabei die Erfassung von normativen Aussagen allein auf der Grundlage nur einer Aussage in einer Perspektive überhaupt nicht möglich ist. Vielmehr erschließt sich die Wirklichkeit des Besprochenen stetig neu in einem Diskursverfahren komplementärer Denkungsarten, das Widersprüchliches nicht nur aushält, sondern geradezu als notwendig zur Erfassung der Wirklichkeit und »wahrer«, d.h. Bestand habender Aussagen (hebr. ’æmæt), empfindet. Es ist dies ein Denken, das seinerseits infinit ist und darum ja in der jüdischen Tradition auch in der haggadischen und halachischen Auslegungsliteratur mündet, die schon in den Spätschriften der Bibel ihren Anfang nimmt.
Da diesem Denken der Gottesbegriff und der Gottesname selbst ja schon in letzthinniger Weise nicht fasslich erscheint, verbleibt es in Bezug auf seinen Gegenstand immer in einer spannungsvollen Korrelation von Interiorität und Exteriorität, Benennung und Umschreibung, Metapher und Symbol, und verweist somit stets auf den Umstand, dass der Mensch von der Wahrheit ergriffen sein kann, ohne doch dabei die Grenzen des Aussagbaren und des Unsäglichen je vollkommen zu erreichen. Die Illusion, hieraus eine systematische Theologie gewinnen zu wollen, die nicht im Moment ihrer Fixierung schon immer auch in sich überholt sein muss, lässt sich vor diesem Gegenstand nicht halten.
Wie aber innerhalb eines solchermaßen gearteten Prozesses dennoch Orientierung, ja tiefste Überzeugung einer Orthopraxie entsteht, wie Identität, ist die Frage. Die Antwort besteht eigentümlicherweise darin, dass in dem aus ökonomischer Pragmatik und religiöser Überzeugung gewonnenen Kanon selbst die Spannung zwischen Heiligem und Profanem, zwischen Gottesnähe und Gottesferne, zwischen |62|Gotteswirklichkeit und Negation derselben, zwischen Inklusivität und Exklusivität integriert ist. Die von Friedhelm Hartenstein in seinem Aufsatz über »The Beginnings of YHWH and ›Longing for the Origin‹«[6] beklagte Spannung zwischen religionsgeschichtlichen und theologischen Aussagen hat hier ihren Ort. Die Frage ist also, welche Faktoren bei der Generierung der biblischen Narration und der darin zutage tretenden Gottesbekenntnisse eine Rolle gespielt haben.