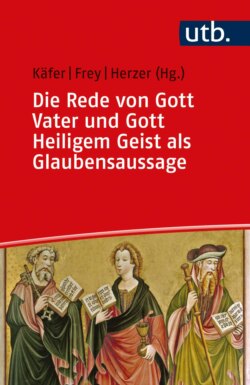Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 9
2. Vom apostolischen Kerygma zu apostolischen Glaubensbekenntnissen 2.1. Das eine Symbolum und die vielen Apostel
ОглавлениеDie Vorstellung, die auf dem Göttinger Barfüßeraltar dokumentiert ist, dass die zwölf Apostel je einen Satz zum authentischen Bekenntnis des christlichen Glaubens beisteuerten, begegnet – wie gesagt – erst am Ausgang der Spätantike. Der Gedanke einer gemeinsamen Verantwortung der Apostel für den von ihnen zu verkündigenden Glauben und seine Formulierung ist jedoch erheblich älter. Das Missionsnarrativ der Apostelgeschichte wurde seit dem 2. Jahrhundert |24|einerseits im Blick auf das individuelle Geschick der ersten Jünger Jesu fortgeschrieben – das Ergebnis ist das Corpus der sogenannten apokryphen Apostelakten.[16] Doch gilt schon dem 1. Clemensbrief (verfasst um das Jahr 100 n. Chr.) auch die kollektive Tätigkeit der Apostel als fundamental für die Ausbreitung des Evangeliums:
»(Die Apostel) wurden durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus mit Gewißheit erfüllt und durch das Wort Gottes in Treue gefestigt, zogen dann mit der Fülle des Heiligen Geistes aus und verkündeten die frohe Botschaft vom Kommen des Gottesreichs.«[17]
Ein Dreivierteljahrhundert später stellt Irenaeus von Lyon († nach 190 n. Chr.) fest, die christliche Wahrheit sei nirgendwo anders als in der Kirche zu finden, »denn die Apostel haben in ihr wie in einem großen Vorratsraum alles in größter Vollständigkeit zusammengetragen, was zur Wahrheit gehört, so daß jeder, der will, aus ihr den Trunk des Lebens nehmen kann (vgl. Offb 22,17).«[18] Tertullian († nach 215) beschreibt, wie Christus seine zwölf Jünger als »Lehrer für die Heiden bestimmte«,[19] und postuliert (wie bereits Irenaeus), dass die rechte christliche Lehre in den von den Aposteln selbst gegründeten Gemeinden zu finden sei, da die Wahrheit das sei, »was die Gemeinden von den Aposteln, die Apostel von Christus, Christus von Gott empfingen.«[20] Wir beobachten hier jenen Prozess der Formierung kirchlicher Identität, den Georg Kretschmar vor dreißig |25|Jahren treffend als »Sammlung um das apostolische Evangelium« bezeichnet hat,[21] den man in moderner Diktion aber auch als Institutionalisierung beschreiben könnte, als Entwicklung von Formen und Medien der Gewährleistung von Dauerhaftigkeit im Wandel.[22] In einer Phase der Herausbildung trennscharfer Unterscheidungen von »Orthodoxie« und »Häresie« – was voraussetzt, dass solche Differenzbestimmungen material und kategorial eben noch nicht fixiert waren – diente die Berufung auf »das Apostolische« als Kriterium,[23] und zwar gerade nicht aufgrund der individuellen, sondern der kollektiven Verkündigung der Apostel. Die rechten Jünger Jesu konnten in Bezug auf den ihnen von Christus anvertrauten Glauben auf keinen Fall uneins gewesen sein!
Die Frage ist nun, in welcher Form der apostolische Glaube zugänglich war, den die Apostel den Gemeinden hinterlassen hatten. Für spätere Generationen galt diese Frage längst als geklärt. Ambrosius von Mailand (†397) leitete seine Explanatio Symboli ad initiandos, eine Darlegung des bei der Taufe zu bekennenden Glaubens, die um 390 geschrieben wurde, mit einer Bezugnahme auf die Gestalt dieses Glaubens ein:
»Die heiligen Apostel kamen also zusammen und verfertigten eine kurze Zusammenfassung des Glaubens, damit wir in knapper Form die folgerichtige Anordnung des ganzen Glaubens erfassen sollen. Kürze tut nämlich not, damit dieser stets im Gedächtnis und in lebhafter Erinnerung gehalten werden möge.«[24]
|26|Wenige Zeilen später spricht Ambrosius ausdrücklich von einem symbolum – einem »Erkennungszeichen« für Christen, mit dem die Katechumenen, an die er seine Predigt richtete, vertraut gemacht werden sollten.[25] Zutreffend leitet Ambrosius den Begriff symbolum aus dem Griechischen ab, bestimmt seine Bedeutung im Lateinischen aber irrigerweise als collatio, dessen Etymologie nicht zu σύμβολον, sondern zu συμβολή führt.[26] Auch Rufin von Aquileia (†411/12) referiert die fälschliche Ableitung, bietet daneben als Alternative jedoch die zutreffenden Synonyme indicium und signum.[27] Der Begriff symbolum, den später auch Pirmin verwendet, begegnet im Christentum seit Tertullian, jedoch erst seit dem späten 4. Jahrhundert mit Bezug auf einen fixierten Text.[28] So definiert der jüngere Zeitgenosse des Ambrosius, Niketas von Remesiana († ca. 414), symbolum wie folgt:
»Ein symbolum ist ein Medium der Erinnerung an den Glauben und ein heiliges Bekenntnis, welches gemeinschaftlich von allen gehalten und gelernt wird.«[29]
Hier und ebenso bei etwa zeitgleich wirkenden Theologen wie Rufin oder Augustin (†430), aber schon bei Ambrosius sind die symbola, die Katechumenen erklärt werden, Glaubensbekenntnisse im Sinne feststehender Texte, die dem uns bekannten Apostolikum mehr oder weniger ähneln. Auf die Textgestalt(en) kommen wir noch zu sprechen. Hier sei zunächst darauf hingewiesen, dass die Autorisierung durch alle Apostel, die schon im frühen Christentum zu beobachten ist, bei Ambrosius noch durch die Präzisierung als zwölf Apostel erweitert wird: »Da es nun also zwölf Apostel sind, gibt es auch zwölf einzelne Sätze«[30] – die dann auch zitiert werden, aber ohne sie in |27|diesem Text ausdrücklich mit Namen zu verbinden. Umgekehrt zählen die zwischen 375 und 400 n. Chr. in Antiochien aus teils viel älterem Material kompilierten Apostolischen Konstitutionen namentlich alle zwölf Apostel (nach Mt 10,1–4 und Apg 1,26) auf, referieren aber ohne eine konkrete Aufteilung in Bekenntnissätze »die katholische Lehre als Stütze für euch, denen die Aufsicht über die ganze (Kirche) anvertraut ist.«[31] Eine ähnliche Transformation ist im 4. Jahrhundert in frühchristlichen Kirchenordnungen zu verzeichnen: So wurden Textteile aus der um 100 n. Chr. verfassten Didache in mindestens zwei Fällen auf elf (!) Apostel aufgeteilt.[32] Es lag offensichtlich nahe, auch das dem Apostelkollektiv zugeschriebene symbolum des Glaubens zu (re-)individualisieren.