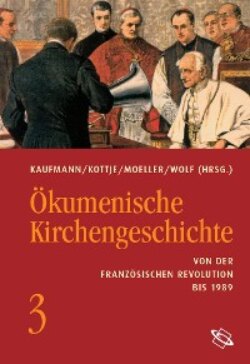Читать книгу Ökumenische Kirchengeschichte - Группа авторов - Страница 37
Weltmissionskonferenz 1910
ОглавлениеVom 15. bis 23. Juni 1910 fand in Edinburgh eine internationale Missionskonferenz mit mehr als 1.300 Teilnehmern statt. Die Delegierten vertraten eine beeindruckend große Zahl von Missionsgesellschaften und Kirchen. Die Hauptlast der Vorbereitungen hatte John R. Mott (1865–1955) getragen, ein Mann, der als Organisator des amerikanischen Studentenmissionsbundes, dem 1888 gegründeten Student Volunteer Movement for Foreign Missions, bereits auf reiche Erfahrungen zurückblicken konnte. Die missionswillige studentische Jugend Amerikas gehörte zu einer Generation, die auch an einer aktiven Rolle Amerikas in der Außenpolitik interessiert war. Die panic of 1893, verursacht durch Überproduktion und Arbeiterunruhen, legte die Verbindung von Mission und internationalem Engagement Amerikas im Wirtschaftsbereich zusätzlich nahe. Mott war ein Missionar und interkultureller Brückenbauer von staatsmännischem Format, 1946 erhielt er den Friedensnobelpreis.
Bei der Anreise der Delegierten in Edinburgh besaßen größere Missionskonferenzen schon eine Tradition: in Bremen seit 1866, in London seit 1878. Vorläufige Höhepunkte waren im Jahr 1888 die „Hundertjahrskonferenz“ der Äußeren Mission in London gewesen, sodann die Ökumenische Missionskonferenz in New York 1900 mit Vertretern aus 162 Missionen. An den lockeren Dezennienrhythmus 1878, 1888 und 1900 knüpfte Edinburgh 1910 an, stellte damit allerdings auch – ebenso durch die Wahl des Tagungsorts – das anglo-amerikanische Übergewicht heraus. Sekretär Motts war Joseph H. Oldham (1874–1969), geboren in Bombay als Sohn eines britischen Offiziers, dann Student der Theologie am New College in Edinburgh, anschließend Missionar in Indien.
Edinburgh war ein Prisma des Zeitalters der nationalen Kolonialmission und zugleich ein neuer Anfang. Maßgeblich bei der Vorbereitung der Konferenz waren:
(1) Macht- und Einflussverhältnisse der Missionen (Ausschluss der personell und finanziell schwachen Missionsträger);
(2) Ausgrenzung strittiger Verhandlungsgegenstände (Mission in christlichen Gebieten, Glaubensfragen, Kirchenordnung);
(3) Suche nach Wegen der Kooperation, wenn auch nur auf dem Beratungsweg, um die Verstetigung der Missionsarbeit zu sichern. Schon die Vorarbeit für Edinburgh war immens, umso mehr erhoffte man sich von der Konferenz selbst.
Die Hauptmasse der Teilnehmer stand der protestantischen Erweckungsbewegung mit ihrer im Jahr 1910 schon mehr als hundertjährigen Tradition nahe. Mott gehörte der Erweckungstradition ebenso an wie Oldham, dessen „Devotional Diary“ sich weiter Verbreitung erfreute. Mitglieder aus den „jungen Kirchen“ waren in Edinburgh mit 17 Teilnehmern nur spärlich vertreten. 14 waren durch jene Gesellschaften ernannt, die ihre Gebiete missioniert hatten. Drei von ihnen passierten die enge Pforte der Wahl in den Fortsetzungsausschuss, dessen Installierung wahrscheinlich der größte Erfolg von Edinburgh war. Auf die kontinentaleuropäischen Kirchen strahlte Edinburgh nur wenig aus. Sie bildeten angesichts der britischamerikanischen Übermacht eine Minderheit. Die katholische Kirche und die Orthodoxie waren gar nicht eingeladen. Ein Vertreter der London Missionary Society sehnte sich „nach der Zeit, da wir wieder eine Konferenz haben werden, auf der Männer der griechischen und der römischen Kirche im Dienste Christi die Fragen mit uns besprechen werden“ (World Missionary Conference 1910. Report of Commission, Bd. 8, Edinburgh u.a. 1910, 234). Der „Edinburghismus“ gehörte zu den wichtigsten Anstößen der Ökumenischen Bewegung des 20. Jahrhunderts.