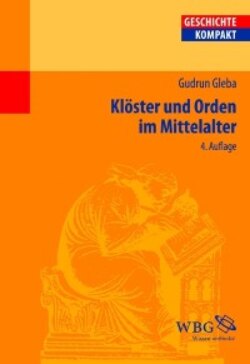Читать книгу Klöster und Orden im Mittelalter - Gudrun Gleba - Страница 10
2. Die Entwicklung des Christentums zur „Staatsreligion“
ОглавлениеDie Entwicklung des Christentums zu einer „Kirche“ entschied sich sowohl im oströmischen wie im weströmischen Reich im 4. Jahrhundert. Der Schwerpunkt lag zunächst im oströmischen Reich. Im Jahr 311, noch kein Jahrzehnt nach der letzten großen Verfolgungswelle, ließen die Kaiser Galerius (284 – 311) und Lizinius (306 – 337) per Edikt das Christentum als erlaubte Religion, religio licita, anerkennen, unter der Bedingung, dass seine Anhänger nichts gegen die öffentliche Ordnung unternehmen und Kaiser und Reich in ihre Gebete einschließen würden. Bis dahin waren Christen von Positionen in der Armee, im Hofdienst und in der Administration ausgeschlossen gewesen. Dem folgte 313 als sicherlich einschneidendstes Ereignis für die Etablierung und Durchsetzung des Christentums das Toleranzedikt von Mailand. Es garantierte völlige Religionsfreiheit und die Anerkennung des Christentums als gleichberechtigte Religionsgemeinschaft neben allen anderen, dazu die Rückgabe des christenkirchlichen Eigentums und die Abschaffung der Kulte der Roma und des Augustus.
Der nächste bedeutsame Schritt zur Festigung der christlichen Religion war das Konzil von Nicäa im Jahr 325, eine kirchliche Vollversammlung der geistlichen Amtsträger. Laien nahmen an den Konzilien nicht teil, rezipierten aber deren Ergebnisse in ihrer praktischen Umsetzung durch die geistlichen Würdenträger. Auf dem Konzil von Nicäa formulierte man ein Glaubensbekenntnis, das große Bedeutung für die weitere Entwicklung insbesondere der lateinischen Christenheit erlangte. Es richtete sich gegen den Arianismus, eine Ausprägung des Christentums, die sich in Kleinasien, aber eben auch in Europa ausgebreitet und zahlreiche Anhänger gewonnen hatte. Nach der Lehre des Arianismus haben Gottvater und Sohn nicht eine gleiche Wesenheit, sondern es handelt sich letztlich um zwei Wesenheiten. In Nicäa dagegen hieß es abschließend: Sohn und Gott sind wesensgleich, bilden eine Einheit. Damit wurde die Wesensgleichheit von Gottvater und Gottsohn festgeschrieben. Kaiser Konstantin der Große (288– 337) wandte sich in den folgenden Jahren immer stärker dem Christentum zu. Unter Kaiser Theodosius (347 – 395) wurde es zur Staatsreligion.
Konzil von Nicäa
Das Konzil wurde 325 vom römischen Kaiser Konstantin einberufen. Zwei wichtige Punkte erfuhren eine definitive Klärung. Der erste war die Festlegung des Termins des Osterfestes auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, wobei der Frühlingsbeginn auf den 21. März festgesetzt wurde. Auf diese Weise sollten alle Christen die Auferstehung Christi gemeinsam am gleichen Tag feiern. Der zweite Punkt war die Klärung der Wesensart Jesu Christi. Das Konzil definierte Jesus Christus als wesensgleich mit Gott und damit als fähig, die Menschheit zu erlösen.
Arianismus
Die Entscheidung des Konzils von Nicäa, dass Jesus Christus wesensgleich mit Gott anzusehen sei, bedeutete eine klare Stellungnahme gegen den Arianismus, einer Lehre des Presbyters Arius (ca. 250 – 337) aus Alexandria. Sie ging von der Wesensverschiedenheit von Gott und Jesus Christus aus, dergestalt, dass Jesus Christus zwar überwiegend eine göttliche, aber eben auch eine menschliche Wesenheit innewohne. Jesus Christus galt als ein von Gott geschaffenes Wesen, das wie alle Menschen der göttlichen Erlösung bedürfe.
In diesem Zusammenhang ist die Bekehrung Kaiser Konstantins von Interesse, über die bereits im Mittelalter verschiedene Versionen verbreitet wurden. Die Legenden erzählen von unterschiedlichen Beweggründen zur Bekehrung, führen aber beide Gottes gnädige Hilfe an. Nach der einen Version schloss Konstantin einen politischen „Deal“ auf Gegenseitigkeit ab: Bekehrung gegen gewährtes Schlachtenglück. Nach der anderen Fassung wurde dem Kaiser ganz individuelle Hilfe zuteil, nämlich die Heilung vom Aussatz durch Papst Silvester (314 – 335). Insbesondere die Bekehrung aufgrund göttlicherseits zugestandener Schlachtenhilfe wurde später zum Vorbild schlechthin für eine der wichtigsten europäischen Herrscherbekehrungen: des Frankenkönigs Chlodwig im Jahr 496 (vgl. S. 12). Konstantin bekräftigte seinen Übertritt zum Christentum durch mehrere Kirchengründungen an symbolträchtigen Orten: Alt St. Peter in Rom, die Grabeskirche in Jerusalem, die Geburtskirche in Bethlehem, die Apostelkirche und die Sophienkirche (Hagia Sophia) in Konstantinopel.
Im 4. Jahrhundert entwickelte das Christentum also bereits ambivalente Züge, die es auch in den nächsten Jahrhunderten prägten: Auf der einen Seite stand das gemeinschaftliche Leben aller Gläubigen als Mitglieder ihrer jeweiligen Gemeinde, mit Formen von Mitsprache und gegenseitiger Fürsorge. Auf der anderen Seite spiegelte die Monarchie auf Erden das Königtum Gottes im Himmel und rechtfertigte somit die Herrschaft eines Einzelnen. Für einen Herrscher war das Christentum damit nicht nur eine Frage der inneren Überzeugung, sondern auch der politischen Nützlichkeit.
381 bestätigte das Konzil von Konstantinopel die Beschlüsse von Nicäa. Dies wiederholte sich auf den weiteren Konzilien von Ephesus 431 und Chalcedon 451. Diese höchst wichtigen Kirchenversammlungen fanden alle auf dem Boden des oströmischen Reiches statt; ihre Beschlüsse galten aber ebenso gut im westlichen Teil. Sie alle fanden in Kleinasien statt, und zwar aufgrund der Initiative und unter dem Schutz der Kaiser, die mittlerweile nicht mehr in Rom, sondern in Konstantinopel residierten und regierten. Ihre Aufgaben waren einerseits die Formulierung eines verbindlichen Glaubensbekenntnisses und die Weiterentwicklung des Glaubens zu einer festen Lehre, andererseits die Ausarbeitung von Disziplinarvorschriften, die das Leben in den christlichen Gemeinschaften regeln sollten.