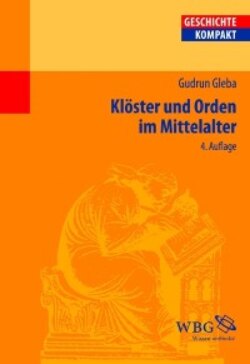Читать книгу Klöster und Orden im Mittelalter - Gudrun Gleba - Страница 15
4. Die Ausbreitung des Christentums im westlichen Teil des Imperiums
ОглавлениеDie Christianisierung Europas setzte verstärkt in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts ein. Begünstigt wurde dies nicht zuletzt durch die Schaffung eines wirksamen Kanons von Texten, die elementare Funktionen im christlichen Kultus und in der Vermittlung der christlichen Lehre übernahmen. Die Männer, die diese Texte schufen, zählten als Bischöfe allesamt zur Spitze der Kirchenhierarchie. Ein Bischof von Rom ist im 4. Jahrhundert noch nicht unter den Kirchenlehrern.
Der bereits erwähnte Athanasius, Bischof von Alexandria, machte durch seine Vita des hl. Antonius die eremitische Lebensform des Christentums auch in Europa bekannt. Er musste Ägypten mehrmals während der dortigen Christenverfolgungen verlassen und ging nach Rom ins Exil. Seine Vorstellungen vom frommen Eremitentum begleiteten ihn, fassten dort Fuß, vermischten und überlagerten sich mit anderen Entwürfen zönobitischer Lebensgemeinschaften.
Ein anderer bedeutender Vermittler christlicher Lehren war Hieronymus (345 – 420). In päpstlichem Auftrag überarbeitete er ab ca. 382 die biblischen Texte. Für das Alte Testament nutzte er hebräische, für die Evangelien griechische Vorlagen. Latein wurde zur Sprache der westlichen Gelehrten schlechthin.
War die Vulgata ein grundlegender Text zum Verständnis der christlichen Lehre, schrieb Ambrosius (340 – 397), Bischof von Mailand, einen wichtigen Traktat über die Präsentation dieser Lehre im Kultus: De officiis ministrorum. Die Verehrung Gottes erhielt in festgeschriebener Form einen rituellen Rahmen.
Schließlich ist noch Augustinus (354 – 430) zu nennen, Bischof von Hippo Regius in Nordafrika. Besonders zwei seiner Bücher erlangten in Europa große Bedeutung. In den Confessiones legte er ein individuelles Zeugnis seiner Bekehrungsgeschichte ab, das viele gebildete Christen nachvollziehend als Suche nach Wahrheit und Gotteserkenntnis lasen. In seinem Traktat über den Gottesstaat, De civitate Dei, entwickelte er Überlegungen, wie sich die christliche Gemeinschaft organisieren könne.
Zu Beginn des 4. Jahrhunderts entstanden im westlichen Teil des römischen Imperiums nach Rom und Mailand christliche Gemeinden auch in Marseille, Arles, Vienne, Lyon, Auxerre, Bordeaux, Trier und Köln, also in den großen Verwaltungszentren der römischen Provinzen Gallia und Belgica. Zönobitische Gemeinschaften entwickelten sich im Westen offenbar zunächst in Rom. Insbesondere Frauen der römischen Senatorenaristokratie initiierten, organisierten und leiteten christliche Hausgemeinschaften, die sich dann auf den außerstädtischen Latifundien – und damit ausgestattet mit allem wirtschaftlich Notwendigen – zu klösterlichen Gemeinschaften wandelten. Bereits 353 hatte Marcellina, die Schwester des Bischofs Ambrosius von Mailand, eine solche Gemeinschaft begründet. Aus den folgenden Jahrzehnten weiß man von Gründungen einer Marcella (385), einer jüngeren Melania (um 400), einer Ascella (405) und einer Paula.
Die Gruppen, die sich hier im christlichen Bekenntnis zusammenfanden, in relativ großer Abgeschiedenheit außerhalb der urbanen Zentren in einer, wenn auch gemilderten Form der Weltentsagung, betrachteten ihre Entscheidung noch als eine Art Protesthaltung gegen die sie umgebende römische Zivilisation.
Eine andere Entwicklung jedoch nahm die Ausbreitung mönchischer Lebensweise im gallischen Raum. Zum Teil war sie im 4. / 5. Jahrhundert an die stadtbischöfliche Herrschaft gekoppelt, wie es beispielhaft an der Gestalt des Martin von Tours (316 – 397) gezeigt werden kann. In seiner Funktion als Bischof hatte er die Aufgabe, die Gläubigen seiner Diözese zu erfassen sowie die Vermittlung der Glaubensinhalte und das gemeindliche Leben als solches zu organisieren. Darüber hinaus sollte er einerseits in seinem ihm unterstellten Gebiet gegenüber Nicht-Christen missionarische Überzeugungsarbeit leisten und andererseits seine Gemeinde in politischen Fragen nach außen vertreten. Als Klostergründer schuf er seinem Bistum in Tours ein geistiges Zentrum. Diesem konnte er zum einen geistliche Aufgaben übertragen. Zum anderen konnte dort das für die kirchlichen Institutionen notwendige Personal ausgebildet werden. Das Kloster entwickelte sich zur Stütze der bischöflichen Herrschaft und diese wiederum wurde in den Städten zu einem immer wichtigeren Stabilitätsfaktor, je mehr sich die römischen Verwaltungsstrukturen aufgrund der allgemeinen Zerfallserscheinungen des Imperiums auflösten.
Die auf Grund bischöflicher Initiative gegründeten monastischen Gemeinschaften folgten unterschiedlichen Regeln des Zusammenlebens. Sie alle enthielten, wie schon für die Pachomiusregel beschrieben, bestimmte gemeinsame Forderungen: das Absolvieren einer Probezeit, ein öffentliches Gelöbnis beim Eintritt in die Gemeinschaft, die Aufgabe weltlicher Bindungen, z. B. durch das Ablegen der weltlichen Kleidung und die Annahme eines neuen, einfachen und für alle in der Gemeinschaft gleichen Habits. Dies gilt auch für solche Klöster, die nicht als bischöfliche Stadtklöster, sondern, asketischen Idealen folgend, von Gleichgesinnten in eher menschenarmen, siedlungsfeindlichen Gebieten errichtet wurden.
Im 4. Jahrhundert hatte sich nach Verfolgung, dann Duldung und schließlich Bevorzugung durch den Kaiser selbst das Christentum im östlichen wie im westlichen Teil des römischen Reiches als legitime und gleichberechtigte Religion durchgesetzt. Bereits während des 3. Jahrhunderts hatten, in Zentralasien ihren Ausgang nehmend, große Wanderungsbewegungen ganzer Völkerstämme begonnen, die sich immer weiter nach Westen fortsetzten. Etwa 200 Jahre lang zwischen der Mitte des 4. und des 6. Jahrhunderts hielt diese Wanderungsbewegung an und veränderte die Bevölkerungsstrukturen in vielen Teilen der römischen Provinzen. Auf dem Boden des alten römischen Imperiums, das zwar in seinen generellen Verwaltungsstrukturen noch bestand, seine innere Festigkeit aber längst verloren hatte und von demographischen, sozialen und politischen Umbrüchen erschüttert wurde, entstanden kleinere Reiche, deren führende Mitglieder sich an ihrer jeweiligen militärischen Leitfigur orientierten und die teilweise eine Akkulturation, eine Romanisierung, durchlebten. Der größere Teil der Bevölkerung dieser neuen Reiche gehörte nicht-christlichen Religionen an, einige zählten zu den Arianern. Am Ende des 5. Jahrhunderts war das Reich der Franken nur ein kleines Reich unter vielen anderen. Sein Kerngebiet lag in der ehemaligen römischen Provinz Belgica II zwischen den Mündungen von Seine und Somme in die Nordsee einerseits und den Mündungen von Maas, Mosel und Marne andererseits. Die militärischen Erfolge in Verbindung mit der Annahme des Katholizismus zeichnete es schließlich im 6. Jahrhundert vor allen anderen aus. Im Laufe seiner Herrschaft konnte der Frankenherrscher Chlodwig (481 – 511) das ursprünglich von ihm kontrollierte Territorium weit nach Süden und Osten ausdehnen. Seine frühen militärischen Erfolge erreichte er 486 gegen Syagrius (487), der sich vom römischen Statthalter zum König aufgeschwungen hatte und in einem Gebiet herrschte, das in etwa die Provinz Lyon und Teile der Belgica II umfasste. Mit seinem Sieg über Syagrius gewann Chlodwig deutlich bis über die Seine hinaus an Einfluss. Weniger überzeugend, als es der Bischof und Historiograph Gregor von Tours (538 / 9 – 594 / 5) in seinem Werk zur Geschichte der Franken, Historiarum libri decem, glauben machen will, war wohl Chlodwigs Sieg im Jahr 491 gegen die Thüringer im Osten seines Reiches. Mit der letztlich erfolgreichen Schlacht von Zülpich gegen die Alamannen war ein wichtiger Schritt zur Festigung der Herrschaft Chlodwigs getan. Seine Expansionsbestrebungen setzten sich allerdings noch in kleineren Schritten gegen die Burgunder im Süden sowie die Goten südlich der Loire fort. Die größte Ausdehnung erreichte das Frankenreich um das Jahr 561: Im Norden erstreckte es sich nun bis in den friesischen und sächsischen Raum, im Osten schloss es Hessen, Thüringen und Teile von Bayern ein, im Süden reichte es bis zu den Alpen und zu den Pyrenäen bzw. zum Mittelmeer.
Die Ereignisse um Chlodwigs Bekehrung während der Schlacht von Zülpich und seine spätere Taufe sind deshalb von so einschneidender Bedeutung, weil sich durch die weiteren Erfolge des Herrschers und seiner Nachkommen das Christentum im westlichen Europa nördlich von Alpen und Pyrenäen durchsetzen konnte. Dies geschah nicht auf der Grundlage individueller Bekehrung, sondern als Entscheidung der jeweiligen Führungsgruppen, in einem Ineinandergreifen von politischer Herrschaft und Missionsbestrebungen.
Welches waren nun die Umstände von Chlodwigs Bekehrung und Taufe? Sie gelten als gesicherte Tatsache, ungesichert ist jedoch das Datum. Zur Diskussion stehen die Jahre 496, 497 und 506. Insbesondere drei Quellen geben dazu Auskunft.
Die erste ist ein Absatz aus der fränkischen Geschichte des Gregor von Tours, im Abstand von ca. zwei Generationen nach den Ereignissen und in enger Anlehnung an die konstantinische Bekehrung verfasst. In aussichtsloser Lage ruft Chlodwig den Gott der Christen an, der seine Macht in der Schlacht unter Beweis stellen soll und dies auch zu Chlodwigs Gunsten tut. Chlodwig erfüllt im Anschluss seinerseits sein Versprechen und lässt sich taufen. Diese Taufe wird jedoch nicht als Bekenntnis aus innerer Überzeugung, sondern als politischer Akt dargestellt: Nach dem König lassen sich auch zahlreiche seiner militärischen und politischen Gefolgsleute taufen – Gregor spricht von 3000 –, die damit ihre Treue und Anhängerschaft bezeugen. Die zweite Quelle ist ein anlässlich der Taufe abgefasstes Glückwunschschreiben des Bischofs Avitus von Vienne (494 – 518). Zum Ersten hebt er hervor, dass Chlodwig mit seiner Taufe vorbildlich innerhalb der eigenen Familie wirkte – seine Schwester Lantechildis schwor bei Chlodwigs Taufe dem Arianismus ab –, zum Zweiten, dass die Taufe des Herrschers auch ein Signal für seine gesamte, nicht nur die verwandtschaftliche Anhängerschaft war, wie es später ja auch Gregor gesehen hat. Avitus erklärt: „Indem ihr für euch wählt, gebt ihr das Urteil für alle, so ist euer Glaube unser Sieg.“ Drittens betont Avitus die göttliche Stellvertreterrolle des Königs. Er verkörpere das Licht Christi auf Erden und trage den „Helm des Heils“ in sich, d. h. ihm wird als König Gottes Hilfe zuteil. Mit diesem königlichen Heil mag sich einerseits Kriegsglück verbinden, andererseits weist es der Person des Königs aber auch persönliche Tugenden oder überirdische Kräfte zu; den französischen Königen schrieb man später heilende, wundertätige Hände zu. Als vierten Punkt spricht Avitus die dem König nun aufgegebene Missionspflicht an: „Gott werde durch ihn, den König, sich den Frankenstamm zu Eigen machen; ja, der König möge die Glaubenssaat auch unter den ferner wohnenden Stämmen ausstreuen.“ Bischof Remigius von Reims (458 – 525), der Chlodwig taufte, fügte in einem Brief darüber hinaus hinzu, der König möge Sorge tragen für die Bestellung guter Räte, die Anerkennung der Bischöfe, die Befolgung der bischöflichen Ratschläge, den Schutz von Armen, Witwen, Waisen und Bedrückten, die Freilassung von Sklaven und Gefangenen sowie die Durchsetzung der Gerechtigkeit als Ausdruck höchster Herrschertugend.
Massentaufe und Missionsauftrag sind es nun, die die Bekehrung Chlodwigs an das Thema der Entwicklung der frühmittelalterlichen Klöster koppelt. Ähnlich wie die Bischöfe ließen es sich von da an die Könige angelegen sein, Klöster einzurichten und als geistige und geistliche Stützpunkte ihres Einflussgebietes zu nutzen. Sich an das Vorbild des Herrschers anlehnend, taten es die Angehörigen der politischen und militärischen Führungsgruppen ihm gleich. Ebenso folgten bei den weiteren Expansionen, die vom Frankenreich ausgingen, oftmals die Bekehrungsanstrengungen der militärischen Eroberung und Klöster entwickelten sich als die dafür funktionalen Einrichtungen.