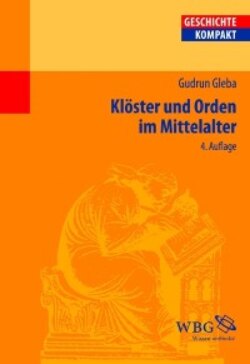Читать книгу Klöster und Orden im Mittelalter - Gudrun Gleba - Страница 19
2. Aufbau und Funktion der irischen Klöster
ОглавлениеEinige Klöster wurden bereits Ende des 5. Jahrhunderts gegründet. Eine regelrechte Welle von Klostergründungen erlebte Irland in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Zu den bekanntesten Gründern zählten Brigit von Kildare († um 524), Enda von Aran († um 530), Finnian von Clonard († 549), Ciarán von Clonmacnois († 549). Diese Bewegung setzte sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts und noch in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts fort, so dass sich schließlich ein breites Band von Klöstern durch die Mitte des Landes von Südwesten nach Nordosten zog. Ihre Gründer stiegen alle in den Rang von Heiligen auf. Brendan (484 – 577) gründete Clonfert 559, Comgall (516 – 600) rief Bangor 555 / 59 ins Leben, Colum Cille (Columban der Ältere, 521 – 597) gründete Derry (549), Durrow (556) und Iona (563), Kevin (angebl. 470 / 80 – 618 / 622) baute die Zellen von Glendalough, um nur noch einige wenige weitere Namen zu nennen.
Es bildeten sich hauptsächlich zwei unterschiedliche Klosterformen aus. Die eine Gruppe fand ihre Heimstatt in den abgelegensten Gebieten, zum Teil auf den vielen kleinen, dem Festland vorgelagerten, felsigen Inseln. Dazu gehörten z. B. Scalic Rock vor der westirischen Grafschaft Kerry oder Inishmurray, eine heute unbewohnte Insel vor Sligo. Ein Ringwall umgab das dortige Kloster, von dem nur noch die Ruinen stehen, und umschloss eine steinerne kleine, fast fensterlose Kirche mit einem sehr steilen Dach und einem kleinen Eingang sowie mehrere Rundlinge. Diese Rundlinge findet man vorwiegend auf den Inseln oder den windumtosten Küstenstreifen. Die Mönche errichteten sie aus Stein, ohne Mörtel, mit einem falschen Gewölbe, d. h. sie ließen im oberen Bereich flache Steine sich Reihe um Reihe dergestalt überlappen, dass sie schließlich ein geschlossenes Dach bildeten. In dieser Form boten sie Wind und Sturm kaum Angriffsfläche. Drei bis vier Mönche fanden in einer solchen Zelle Platz.
In einer zweiten Gruppe entwickelten sich einige der Klöster zum Zentrum einer parochia, die den Klosterverband und eine Kirchengemeinde umfasste. Deren Mitglieder wandten sich nicht nur in Glaubensfragen und Belangen der Seelsorge, sondern in allen Angelegenheiten des kirchlicherseits geregelten Miteinanders an den Abt, der der für sie zuständige Vertreter der Kirche war. Die erhaltenen Ruinen dieser Klöster zeigen nicht mehr den ursprünglichen Bauzustand der Gründungszeit, als mit einfachsten Materialien – Holz, Lehm und Flechtwerk – gearbeitet wurde, sondern die bereits steinernen Gebäudereste. Auch hier lassen sich in der Regel bestimmte architektonische Grundbestandteile ausmachen: Ein Ringwall umgab eine oder mehrere Kirchen, die in ihrer Form oftmals an Reliquienkästchen erinnern, einen Friedhof sowie die für die Funktionstüchtigkeit eines Klosters notwendigen Einrichtungen wie Refektorium (Speisesaal), Wohnzellen, Pilgerherberge und Schule. Wohl erst im ausgehenden 8. und 9. Jahrhundert kamen die für Irland typischen steinernen Rundtürme dazu, die man von Klosterbauten des europäischen Festlandes sonst nicht kennt. Sie dienten vielleicht als Wachttürme oder Vorratskammern, erfüllten jedenfalls keine Funktion im Rahmen liturgischer Zeremonien.
Einige der Kirchen bildeten, wie bereits gesagt, das Zentrum der monastischen Gemeinde ebenso wie der umliegenden gläubigen Laiengemeinden. Eine einzige große Gemeinschaft bildeten die Mönche, Nonnen und gläubigen Laien deshalb aber auch beim Gottesdienst keineswegs. Die sozialen Hierarchien wurden auch hier als die rechte und notwendige Ordnung in begehbare Architektur umgesetzt. Die Anlage der Kirche des von der hl. Brigit gegründeten Doppelklosters Kildare wird in ihrer Vita beschrieben: Sie trennte nicht nur Männer und Frauen, sondern deutlich auch Laien und Kleriker in strikter Ordnung voneinander (s. Quelle).
Das irische Erbrecht behinderte im Übrigen die Bildung von Frauenklöstern ganz erheblich. Wenn ein Mann die Entscheidung traf, sich als Mönch in ein Kloster zu begeben, behielt er das Erbe, das ihm von Seiten seiner Familie zustand und überführte es bei seinem Eintritt in den Besitz der Klostergemeinschaft. Wenn eine Frau den Nonnenschleier nahm, fiel ihr mobiler und immobiler Besitz an ihre Familie zurück.
Die Klöster waren, in Irland wie später auch auf dem Kontinent, betende Gemeinschaften. Sie waren in ihrem Tun auf das Jenseits ausgerichtet, aber sie waren keineswegs der Welt entrückt. Im Gegenteil spielten sie zur Festigung des politischen und sozialen Einflusses ihres Gründers bzw. ihrer Gründerfamilie eine wichtige Rolle. Denn das Kloster blieb über die eigentliche Gründung hinaus eng mit dieser Familie verbunden, die die klösterliche Kirche als ihre eigene betrachtete. Ein Gründer legte den wirtschaftlichen Grundstock, indem er der klösterlichen Gemeinschaft Landbesitz übertrug; er bekleidete oftmals als Erster das Amt des Abtes und diese Position wurde über Generationen fast wie in Erbfolge einem Sohn oder einer Tochter der Familie überantwortet; die Familienmitglieder fanden dort ihre Grablege und damit eine Stätte, an der man sich ihrer und ihrer Taten erinnerte. Die Herrschaft über ein Gebiet beinhaltete auch die Nutzung der dortigen Klöster; die führende Position in einem Kloster war verbunden mit der herausragenden Stellung in einem Herrschaftsgebiet. Ein Abt war nicht nur der Vater seiner Mönchsgemeinschaft, sondern ein aktiver Organisator in der ihn umgebenden Laienwelt.
Zum Aufbau einer irischen Klosterkirche aus der Vita der hl. Brigit
(zitiert nach: Bieler, Ludwig: Irland. Wegbereiter des Mittelalters, S. 36)
Die Kirche hat … im Innern drei große Beträume. Sie sind durch Bretterwände abgeteilt, liegen aber alle unter einem einzigen Dach. Die eine Wand, mit Linnenvorhängen bedeckt und mit gemalten Bildern geschmückt, durchzieht den östlichen Teil der Kirche von einer Seite zur anderen. An ihren beiden Enden hat sie Türen: Durch die Tür zur Rechten betritt man das Heiligtum und geht zum Altar, wo der Bischof mit seiner Klosterschule und denen, die zur Feier der heiligen Mysterien bestimmt sind, dem Herrn das göttliche Opfer darbringt. Durch die andere Tür am linken Ende jener Querwand tritt die Äbtissin mit ihren Jungfrauen und mit frommen Witwen ein, um am Mahl des Leibes und Blutes Jesu Christi teilzunehmen. Die restliche Fläche des Hauses ist durch eine andere Wand, die sich von der Westseite bis zur Querwand erstreckt, in zwei gleiche Teile geteilt. Die Kirche hat viele Fenster. Durch ein Tor mit Verzierungen, zur rechten Seite, wird sie von Priestern und Laien männlichen Geschlechts betreten, durch ein anderes Tor zur linken Seite treten Frauen und Jungfrauen ein. So kann in ein und derselben geräumigen Basilika eine große Volksmenge, durch Teilungswände nach Stand, Grad und Geschlecht getrennt, doch einig im Geist, zum allmächtigen Herrn beten.