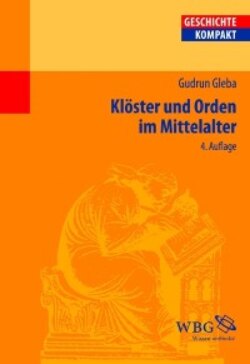Читать книгу Klöster und Orden im Mittelalter - Gudrun Gleba - Страница 9
1. In communitate – in der Gemeinschaft
ОглавлениеDie christliche Glaubensgemeinschaft konstituierte sich anfänglich in ihren Zusammenkünften und im Bekenntnis zu gleichen geistlichen Inhalten ohne jegliche institutionelle Ausformung. Eine kleine Gruppe jüdischer Männer und Frauen in Judäa, das im Jahr 33 Annex der römischen Provinz Syrien war, erkannten in dem gekreuzigten Jesus von Nazareth den verheißenen Sohn Gottes, in menschlicher Gestalt geboren, der als Mensch gelebt und gewirkt hatte, zur Erlösung der sündigen Menschheit gestorben und schließlich nach dem Sieg über den Satan in den Himmel aufgefahren war, um an der Seite seines göttlichen Vaters zu herrschen.
Die räumliche Expansion des Christentums bzw. die Verbreitung christlicher Lehrsätze erfolgte schnell, ohne dass aber größere zusammenhängende Bevölkerungsgruppen davon erfasst worden wären. Kleine Gruppen Christgläubiger lebten verstreut in den verschiedenen Provinzen des römischen Reiches und übten den Kult ihres Glaubens als klandestine Gemeinschaften aus. Klöster, bewohnt von Mönchen und Nonnen, gab es in den frühchristlichen Gemeinden der ersten Jahrhunderte des Christentums nicht – weder dem Inhalt noch der Form nach.
Christliche Gemeinden entstanden bereits wenige Jahrzehnte nach dem Kreuzestod Jesu in Kleinasien, Ägypten und Griechenland, schließlich noch im ersten Jahrhundert in Rom, dem Zentrum des römischen Reiches. Die Briefe des Paulus z. B., die zu den wichtigsten Quellen zum Verständnis des Urchristentums zählen, richteten sich an die Gemeinden von Korinth, Galatien, Ephesus, Philippi, Kolossai und Thessaloniki. Die Apostelgeschichte nennt viele dieser Orte als Stätten seines Wirkens. In Nordägypten wuchs insbesondere die Gemeinde von Alexandria zu großer Bedeutung heran, die möglicherweise mit verschiedenen Philosophenschulen der Stadt in Austausch stand.
Die Christgläubigen weigerten sich, den Kulten der Roma und des Augustus durch entsprechende kultische Handlungen die geforderte formale Anerkennung zu leisten. Die Verehrung der Göttin Roma als Personifikation der Stadt Rom und des Kaisers als Gott war essentieller Bestandteil des römischen Kaiserkultes seit den Zeiten des Kaisers Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.), der sich als Sohn des vergöttlichten Cäsars (100 – 44 v. Chr.) verstand. Die Akzeptanz oder eben die Verweigerung der Ausübung des Kaiserkultes wurde in den folgenden Jahrhunderten zu einem staatlichen Kontrollmittel: Die Akzeptanz war gleichbedeutend mit der Loyalität gegenüber dem römischen Staat, die Verweigerung wurde als Opposition geahndet. Die Nichtausübung des Kaiserkultes durch die Christen erklärt sich durch das Gebot ihrer monotheistischen Religion, das verlangt, nur einen einzigen Gott zu verehren. Doch ihre konsequente Haltung in dieser Frage machte sie zu Staatsfeinden und lieferte die Legitimation für ihre Verfolgung. Am Ende des 1. Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung setzten die ersten systematischen Christenverfolgungen ein. Allein das Bekenntnis zum christlichen Glauben rechtfertigte eine Verurteilung. Eine erste größere Verfolgungswelle im Jahr 64 unter Kaiser Nero (54 – 68) beschränkte sich auf römisches Stadtgebiet, so auch die weiteren Verfolgungen im ersten Jahrhundert. Die nächsten Wellen unter den Kaisern Decius (249 – 251) im Jahr 249, Valerian (253 – 260) im Jahr 257 und Diokletian (293 – 306) im Jahr 303 erfassten das ganze Reich. Nach römischem Denken bestrafte man mit der Verurteilung von Christen notorische Gesetzesbrecher, nach christlichem Verständnis starben Märtyrer für ihren Glauben.
Erklärungen für die Bereitschaft zum Martyrium, eine endgültige und sicherlich nicht leichte Entscheidung, sind gewiss nicht ohne Schwierigkeiten zu finden und lassen sich wohl nur nachvollziehen, wenn man akzeptiert, dass einige essentielle Glaubensinhalte im Bewusstsein eines Menschen alles andere überlagern können. Ein theologischer Erklärungsversuch lautet: Die Bekehrung zum Christentum bedeutete eine Hinwendung des ganzen Menschen zu seinem Gott und dessen Geboten, innerlich und äußerlich, in seinem Verhalten, in seiner Lebensweise und in seinem Verhältnis zu Anderen. Sie veränderte ihn grundlegend, machte geradezu einen anderen Menschen aus ihm, einen Menschen, der sein ganzes Fühlen, Denken und Handeln auf seinen Gott ausrichtete und damit alle anderen Bindungen familiärer oder gesellschaftlicher Art aufgab. Es scheint auch diese Bereitschaft zum Martyrium, zur Aufgabe des leiblichen Lebens bis zur letzten Konsequenz gewesen zu sein, die einen Teil der Faszination des Christentums ausmachte. Dieses Martyrium wurde scheinbar problemlos als Bestandteil der Glaubensausübung akzeptiert. Der Glaube an den einen Gott verlieh offenbar die enorme seelische Kraft, die notwendig war, um allen Widerständen – und allem, wenn auch vielleicht nur formalen Einlenken – zu trotzen. Ein zweiter Ansatz nennt als Erklärung ein Angebot, das sonst keine andere der im Imperium Romanum ausgeübten Religionen machen konnte: Mit der Hinwendung zum Christentum erreicht der Mensch seine Aufnahme bei Gott, da jedem einzelnen Menschen Christus innewohnt, wenn er denn diesen Gott und seine Liebe in sich aufnimmt.
Trotz der schnellen Ausbreitung christlicher Ideen war die Wirkmächtigkeit dieser Religion in den ersten drei Jahrhunderten ihrer Existenz eher begrenzt. Das Christentum stellte nur eine unter vielen anderen Glaubensgemeinschaften des römischen Reiches dar. Man schätzt, dass noch zu Beginn des 4. Jahrhunderts erst etwa 5 – 7% der gesamten Bevölkerung des römischen Imperiums dem christlichen Glauben angehörten und selbst zur Mitte des 4. Jahrhunderts lediglich mit 15 – 20% Christen zu rechnen ist. Mit dem offiziellen Ende der Verfolgungen konnten die christlichen Gemeinden fortan zwar ihren Glauben öffentlich ausüben, die Zahl ihrer Anhänger stieg deshalb jedoch nicht sprunghaft an, sondern wuchs weiterhin kontinuierlich.
Gerade aber weil die Gemeinschaften bis in das 4. Jahrhundert klein waren, verstreut über größere Entfernungen, illegal und teilweise kriminalisiert, bedurfte es eines engen sozialen Zusammenhaltes sowie intensiver Kontaktpflege der Mitglieder untereinander, durch die sie sich gegenseitig stets aufs Neue in ihren Glaubensauffassungen bestätigen konnten. Schutz gegen die immer wieder aufbrandenden Verfolgungswellen konnte nur die Solidarität der Gemeinschaft bieten, in der man vielleicht auf Unterstützung, sei es in Form aktiver Fluchthilfe oder gebotener Verschwiegenheit, hoffen durfte. Den eigentlichen inneren Zusammenhalt jedoch dürften das liturgische Zeremoniell in der gemeinschaftlich begangenen Messfeier und die gegenseitige Unterweisung in der Glaubenslehre geschaffen haben.