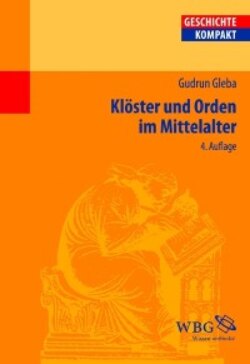Читать книгу Klöster und Orden im Mittelalter - Gudrun Gleba - Страница 11
3. In eremo – in der Wüste
Оглавление„Die Geschichte christlicher Askese ist eine Geschichte verlassener Räume und Menschen: der Flucht aus den Städten mit ihren vielfältigen sozialen Verbindungen, des Ausbrechens aus der durch den pater familias regierten domus, des Verlassens der steinernen Tempel und des Rückzugs vor der Masse in Theater und Zirkus. Mit dem Exodus in die in mehrerer Hinsicht leeren Räume von Wüste, Gebirge und Einöde entäußerte sich der asketisch lebende Mensch auch der Koordinaten seiner sozialen Verortung, war nicht mehr länger Sohn oder Tochter, nicht mehr Vater oder Mutter, Ehemann oder Ehefrau.“ (Zeddies, S. 10)
Vornehmlich in Nordägypten entwickelten sich zwei verschiedene Ausprägungen christlichen Gemeinschaftslebens: 1. die Formierung der Gemeinden zu einer Kircheninstitution hierarchischer Ordnung und 2. das asketisch-eremitische Leben.
Zur Selbstorganisation der wachsenden christlichen Gemeinden erwies es sich bald als notwendig, einzelne Mitglieder mit bestimmten Aufgaben zu betrauen. Um das liturgische Zeremoniell zu wahren und die kontinuierliche Bildung der Gemeindemitglieder in Glaubensfragen zu gewährleisten, bedurfte es der Schaffung von Zuständigkeitsbereichen und der Benennung von Verantwortlichen: die Vorbereitungen für den Gottesdienst, der Erwerb und die Instandhaltung der dazugehörigen liturgischen Gerätschaften, das Abhalten der Messen in korrekten Formen und mit angemessenen Inhalten, die Unterweisung von Kindern und Erwachsenen, die Kontaktpflege zu anderen Gemeinden und den Institutionen der jeweiligen Herrschaft. Oberhalb der Ebene der einfachen Mitglieder entwickelte sich innerhalb der Gemeinden zügig eine professionalisierte Hierarchie vom Diakon bis zum Bischof. Die Gemeindemitglieder waren in das städtische Milieu integriert, sie gingen ihren verschiedenen Berufen nach und bekannten sich mehr oder weniger aktiv zu ihrem Glauben, den sie zwar als Bestandteil, aber nicht als ausschließlichen Sinn ihres Lebens und Strebens, ihres ganzen Seins ansahen.
Allein für den Glauben und die Erkenntnis Gottes zu leben war dagegen Ziel und Zweck eremitischen Daseins, das sich zeitgleich und teilweise in Konkurrenz zu den, zunächst auf Gemeindeebene beschränkten, kirchlichen Institutionen entfaltete.
Die historischen und die theologischen Betrachtungen des Eremitentums finden unterschiedliche Erklärungen für diese Bewegung. Von historischer Seite wird das Spannungsverhältnis betont, das sich aus zwei differierenden Verständnisformen des Glaubens entwickelte. Auf der einen Seite organisierte und institutionalisierte sich die christliche Glaubensgemeinschaft in der sie umgebenden Welt, suchte und fand (außerhalb der Verfolgungswellen) einen Platz innerhalb des bestehenden Staatswesens. Auf der anderen Seite stieß genau diese Anpassung, das Sich-Einfinden und Einfädeln in die existierenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen, auf die Kritik einzelner Gläubiger. Sie erachteten gerade das urbane Ambiente mit seinen vielfältigen Angeboten – und Verführungen – für Leib und Seele als Gefahr für die Reinheit des Glaubens. Das Ausweichen in die Wüste war danach weniger Flucht als Protest gegen die Institutionalisierung des Glaubens.
Von theologischer Seite werden als Gründe für die Entstehung einer Askesebewegung eher die Vorgehensweise bei der Gewinnung neuer Glaubensanhänger durch die kirchlichen Institutionen und deren mangelnde Erfüllung ihrer Aufgaben angeführt: Die kirchlichen Funktionsträger überprüften kaum das Wissen um die Inhalte des Glaubens bei potentiellen neuen Mitgliedern; es war viel zu einfach geworden, Christ zu werden; die Beachtung der christlichen Lehren im gemeindlichen Alltag wurde nicht ausreichend kontrolliert, viele Gebote zu großzügig ausgelegt bzw. ein Verstoß nicht streng genug geahndet. In salopper Form zusammengefasst: Die Kirche hatte es zugelassen, dass der christliche Glaube verwässerte. Nach dieser Sichtweise verließen die Asketen die städtischen christlichen Gemeinden aus Protest gegen die zu große Toleranz gegenüber vielen Mitgliedern und deren moralischer Laxheit.
Asketentum und Einsiedlertum gingen zunächst eine enge Verwandtschaft ein. In Ägypten orientierte sich der Begriff der Askese an der griechischen Philosophie und wurde in christlicher Zeit in der Katechetenschule von Alexandria als Weg zur Vervollkommnung gelehrt. Ziel der Askese war die Befreiung von sittlicher Schuld. Dazu musste man einen Zustand absoluter Leidenschaftslosigkeit und vollkommener Genügsamkeit erreichen, in dem die Sorgen um körperliche Bedürfnisse auf ein Minimum reduziert waren. Askese bedeutete die vollständige Abkehr von der Welt, die größtmögliche Loslösung von allen menschlichen Bindungen, seien es die Forderungen des eigenen Körpers, verwandtschaftliche Beziehungen oder soziale Kontakte jedweder Art. Eine Voraussetzung für ein asketisches Leben konnte z. B. darin bestehen, räumlich sichtbar alle Beziehungen zu menschlichen Gemeinschaften abzubrechen, eben in die Wüste zu gehen. Äußere Härten sollten dabei nicht als Entbehrungen, sondern jede Möglichkeit des Überlebens als göttliches Geschenk angesehen werden. So erzählt es z. B. der Kirchenlehrer und Übersetzer griechisch-christlicher Werke Tyrannius Rufinus (345 – 410) in seiner Geschichte der Mönche, Historia monachorum, in der legendenhaft ausgeschmückten Vita des Einsiedlers und späteren Klostergründers Or, was sich mit gleichem Tenor in den Lebensbeschreibungen etlicher Wüstenheiliger wiederholt: In der Wüste nährte er sich von Kräutern und Wurzeln und diese schmeckten ihm süß. Wasser, wenn es welches gab, trank er unter Gebeten und Hymnen, die ihn alle Zeit, am Tag und in der Nacht beschäftigten. In dem Rückblick des heiligen Mannes auf seine Zeit in der Wüste berichtete er sogar, dass er keinerlei irdische Nahrung zu sich nahm, sondern dass ein Engel ihm alle drei Tage himmlische (= spirituelle) Kost gebracht habe, die ihm Speise und Trank war.
Die Asketen und Einsiedler, die später als Anachoreten bezeichnet wurden (abgeleitet vom griechischen Wort anachorein = ausweichen, sich zurückziehen), negierten in ihrer Wüsteneinsamkeit die Institutionen der Kirche. Sie kamen ohne Kultus, ohne Lehre, ohne Predigt, ohne Messe, ohne Abendmahl aus. Letzteres konstituierte zwar die christliche Gemeinschaft der Gläubigen, doch nach Ansicht der Eremiten war dies für sie nicht notwendig. Ihre Kirche war eine immaterielle, die sich v. a. in der geistigen Auseinandersetzung jedes Einzelnen mit seinem Glauben realisierte.