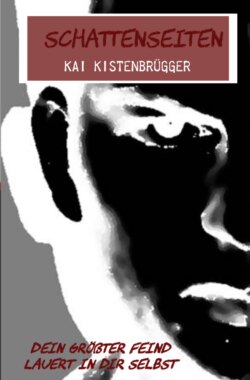Читать книгу Schattenseiten - Kai Kistenbruegger - Страница 13
20 Tage davor
ОглавлениеWie jeder andere Bahnhof ist der Düsseldorfer Hauptbahnhof ein Schmelztiegel für Menschen unterschiedlichster Couleur und Gesinnung, abhängig davon, zu welcher Tages- und Nachtzeit man auf die Idee kommt, dem grauen Betonklotz im Herzen der Stadt einen Besuch abzustatten.
Zur frühen Morgen- und Abendstunde beherrschen die Pendler den Bahnhof, die es in alle denkbaren Himmelsrichtungen zu ihren Arbeitsplätzen oder nach Hause treibt. Sie hetzen auf dem Weg zu ihren Anschlusszügen durch die breiten Gänge, gefangen in einer beängstigenden, alltäglichen Routine der Monotonie. Mit ihrer Tageszeitung unter dem Arm und mit dem dampfenden Kaffee in der Hand, wühlen sie sich durch das Gedränge vor den Zügen, um einen der begehrten, hart umkämpften Sitzplätze zu ergattern. Tagsüber hingegen wird der Bahnhof nur von vereinzelten Fahrgästen frequentiert, die keinem Termindruck unterliegen und entspannter reisen als die Pendler. Oftmals sind es Touristen oder Geschäftsreisende, die unserer schönen Stadt einen Besuch abstatten, oder ein paar verlorene Seelen, die ziel- und heimatlos in der Stadt umherirren.
Am späten Abend jedoch, kurz vor Einbruch der Nacht, zeigt der Hauptbahnhof sein wahres Gesicht. Abends verkommt der Bahnhof zum Revier derjenigen, die sich die kalten Gänge zu ihrem Zuhause auserkoren haben. Zwischen den zahlreichen Putzkolonnen und den regelmäßigen Patrouillen der Bahnhofssicherheit suchen sie nach einem Plätzchen in der Welt, an dem sie ungestört für ein paar Minuten ihren kalten Frieden finden können. Dieses Leben ist ein Leben am Rande der Gesellschaft, ein Leben in einer rechtlichen Grauzone. Wenn sie nicht aus der Not heraus bereits straffällig geworden sind, finden sie sich immer öfter vor Gericht wieder, weil die Bahn sie wegen Hausfriedensbruch vor den Kadi schleift. Vielen von ihnen ist bereits ein Hausverbot erteilt worden, das sie jedoch weder abschreckt, noch daran hindert, wiederzukommen. Als würde der graue Klotz sie magisch anziehen, treibt es sie immer wieder zurück, weil der Bahnhof ihr einziger Zufluchtsort in einer Stadt voll von einsamen Menschen ist.
Als ich an jenem Tag den Bahnhof erreichte, war die große Welle der Pendler bereits zu einem schwachen Strom abgeebbt. Zu dieser Tageszeit versteckten sich die Obdachlosen noch außerhalb der großen Bahnhofshalle vor dem unerbittlichen Sicherheitsdienst, der in den vergangenen Jahren immer weniger Kulanz mit den verlorenen Existenzen der menschlichen Zivilisation walten ließ. Die Deutsche Bahn hatte inzwischen eine beeindruckende Wandlung vom Staatskonzern zu einem kundenorientierten Unternehmen vollzogen, dessen Kunden sich in ihrer heilen Welt zunehmend gestört fühlten, wenn sie auf dem Weg zu ihren Zügen wegen ein paar Euros angebettelt wurden.
Ich hatte am Anfang meiner Karriere in diesem Umfeld einige Jahre als Streifenpolizist Dienst geschoben. Diese wenige Jahre hatten bei mir ihre Spuren hinterlassen. Ich hatte die Stadt auf eine Art und Weise kennen gelernt, die selbst Alteingesessene in ihrem behüteten Leben nur selten zu Gesicht bekamen. Auch wenn viele es nicht wahrhaben wollten; Düsseldorf hatte eine dunkle Seite, und sie zeigte sich vornehmlich in den düsteren Ecken zwischen den zahlreichen, glänzenden Fassaden der Königsallee und all der anderen Straßen, die Anzugspunkt so vieler Menschen und Touristen waren. Es war die Schattenseite der Stadt und die dunkle Seite von uns allen, die wir bevorzugt ignorierten, oder uns sogar einredeten, sie würde nicht existieren.
Viele der Obdachlosen kannte ich noch aus meiner Zeit als Streifenpolizist. Aus den zahlreichen Teenagern, deren Jugend auf den Düsseldorfer Straßen unsanft ihr Ende gefunden hatte, waren inzwischen Erwachsene geworden, deren Leben um keinen Deut besser war als zu der Zeit, zu der ich sie noch jeden zweiten Abend in die Ausnüchterungszelle steckte, um nicht nur die Bevölkerung vor ihnen, sondern auch sie vor sich selbst zu schützen.
Es war deprimierend, ein hoffnungsloser Kampf gegen den zunehmenden Verfall gesellschaftlicher Werte, vor dem der Rest der Bevölkerung die Augen verschloss.
Ich hatte mich in Jeans und Lederjacke geworfen, aber ich gab mich keinen Illusionen hin: Der Beigeschmack nach Polizei klebte an mir wie der stechende Geruch an einem reifen Käse. Ich hätte mir genauso gut ein Schild um den Hals hängen können, das mit Großbuchstaben ‚Polizist’ buchstabierte, und ich wäre vergleichbar auffällig herumgelaufen. Es ist der Alltag eines Polizisten, der sich nicht nur in deinem Verstand, sondern auch in Deiner Körperhaltung niederschlägt. Irgendwann, wenn dir all das Leid über den Kopf gewachsen ist, siehst du keine anderen Menschen mehr, sondern nur noch potenzielle Straftäter und die Abgründe, vor denen sie stehen. Wäre Sandra nicht in mein Leben getreten, hätte ich wahrscheinlich schon längst wie Bobby meinen Weltschmerz im Alkohol ertränkt.
Als ich mich einer Gruppe von Obdachlosen und ihren Hunden näherte, die sich auf dem Boden rund um eine Bank versammelt hatten, waren es die Menschen, die mich zuerst bemerkten. Die Vierbeiner fühlten sich noch nicht einmal dazu genötigt, ihren Kopf zu heben. Zu viele Menschen kamen an ihnen vorbei, ohne ihnen Beachtung zu schenken, und wurden ihrerseits von den Tieren mit Missachtung gestraft.
„Was willst du? Wir haben nichts gemacht!“, verteidigte sich einer der heruntergekommenen Männer prophylaktisch, bevor ich überhaupt den Mund geöffnet hatte. Obwohl sein Gesicht hinter einem struppigen, dreckigen Bart verborgen lag und seine verfilzten Haare tief in sein schmutziges Gesicht hingen, erkannte ich ihn sofort. Er war genau einer der Männer, die ich gesucht hatte, auch wenn er sich seit unserem letzten Treffen vom Straßenkind mit bescheidenen Zukunftsaussichten zum Penner ohne Zukunft heruntergearbeitet hatte. Bereits seit acht Jahren füllte sein bedauernswertes Leben unsere Akten. Ferdinand Müller – Ferdi – war mit 12 das erste Mal von zu Hause ausgerissen. Obwohl er von der Polizei einige Male aufgegriffen und zu seinen Eltern zurückgebracht worden war, hatte er es nie länger als zwei Wochen am Stück mit seinen Erzeugern ausgehalten. Ehrlich gesagt, verwunderte es mich auch nicht. Sein Vater war schwerer Alkoholiker, und seine Mutter hatte nie die Stärke aufgebracht, sich oder ihre Kinder vor ihrem brutalen Mann zu schützen. Als Ferdi endlich zu seinem Schutz ins Heim gekommen war, war sein Leben bereits verpfuscht gewesen. Die Schule hatte er abgebrochen, seine Chancen auf eine Lehrstelle tendierten damals gegen Null. Seine Freunde hatten ebenfalls auf der Straße gelebt, boten ihm also kein sicheres soziales Gefüge, das einen Neuanfang ermöglicht oder gar versprochen hätte. Sein bester Freund war, zumindest damals, Thomas Becher gewesen. Insofern hoffte ich, mit Ferdi den richtigen Ansprechpartner gefunden zu haben.
„Hi, Ferdi“, begrüßte ich ihn jovial, als würde ich einen alten Freund treffen. „Ich könnte deine Hilfe gebrauchen.“
„Warum sollte ich einem Bullen helfen?“, fragte er provokativ und erntete das zustimmende Gelächter seiner Saufkumpane. Eine Ekel erregende Alkoholfahne schlug mir entgegen.
„Ach, Ferdi“, seufzte ich. „Du kennst mich doch. Eine Hand wäscht die andere. Du hilfst mir und ich übersehe großzügig, dass Ihr hier zusammen mit Minderjährigen Alkohol konsumiert.”
Ich nickte übertrieben freundlich in Richtung der beiden jungen Kerle, die ihr 18. Lebensjahr in naher Zukunft definitiv nicht vollenden würden.
„Du kannst mich mal, Scheißbulle!“, krächzte Ferdi und baute sich, befeuert durch die Anwesenheit seiner Freunde, drohend vor mir auf. „Steck mich doch in den Knast! In 24 Stunden bin ich sowieso wieder draußen!” Er lachte vorlaut und entblößte eine Reihe schwarzer Zähne. „Außerdem…“, höhnte er angestachelt, „…könnte ich eine Nacht in einem richtigen Bett mal wieder vertragen!”
Ein lautes Johlen seiner Kumpel trieb ihm ein fettes Grinsen ins Gesicht.
Ich rollte mit den Augen. Diese Sprüche waren nichts Neues für mich. Offensichtlich war es für Ferdi notwendig, mir die Stirn zu bieten, um sich innerhalb seines sozialen Gefüges als Held verkaufen zu können. Ich versuchte es erneut, beschwichtigend: „Ferdi, bitte! Ich habe nur eine Frage, dann bin ich wieder weg. Ein, zwei Minuten, und du bist mich wieder los.“
Ich kam allerdings nicht mehr dazu, meine Frage zu stellen. In diesem Moment beging Ferdi einen folgenschweren wie unverzeihlichen Fehler. Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf ging, als er mir mit seinen dreckigen Griffeln provozierend vor die Schulter schlug. Vielleicht war er etwas übermütig geworden, weil ich seiner kleinen Armee von mindestens sechs Männern plus drei Hunden alleine gegenüberstand, oder er spürte den Kasper in sich aufwallen, doch das war mir in diesem Moment egal. Der Schlag fiel nicht sonderlich stark aus, sondern sollte mir wahrscheinlich nur so etwas wie Respekt einbläuen oder eine simple Drohgebärde sein, doch so etwas ließ ich mir nicht gefallen. Erstens hatte ich lange genug die Annäherungsversuche unseres Gerichtsmediziners stillschweigend erdulden müssen, so dass meine Nerven sowieso etwas dünner als gewöhnlich ausfielen; zweitens hatte so ein Punk nicht das Recht, mich anzufassen. In dem Moment, als ich durch seinen kleinen Schubs erzwungenermaßen einen kurzen Ausfallschritt nach hinten machen musste, schaltete sich irgendetwas in meinem Kopf aus und überließ der plötzlich aufwallenden Wut die Oberhand.
Ich war nicht unbedingt der Sportlichste und kam auch längst nicht an das Gewicht von Bobby heran, aber ich hatte in meiner Polizeiausbildung ein paar Tricks gelernt.
Bevor Ferdi überhaupt wusste, wie ihm geschah, küsste er mit seiner Wange bereits den Betonboden. Ich hatte ihn mit meinem rechten Bein ausgehebelt und bäuchlings zu Boden geworfen. Mein rechtes Knie bohrte sich von hinten in seine Nieren, während meine linke Hand seinen linken Arm schmerzhaft nach hinten bog. Aus dieser Lage würde er sich ohne fremde Hilfe nicht befreien können.
Ferdi fing an zu kreischen wie ein kleines Mädchen, aber ich lockerte meinen Griff keinen Millimeter. Seine Freunde taten so, als würden sie ihn auf einmal nicht mehr kennen. Sie blickten demonstrativ in eine andere Richtung und unterhielten sich angeregt über das Wetter.
„So, mein Freund“, sprach ich in gebührendem Abstand in sein Ohr, um bei seinem Gestank nicht ohnmächtig zu werden. „Jetzt werden wir uns ein bisschen unterhalten.”
Ferdi wimmerte etwas Unverständliches. Routiniert suchte ich mit meiner freien Hand seine Taschen ab, um zu meiner eigenen Sicherheit unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Sicher ist sicher.
Zu meiner Verblüffung förderte ich ein braunes Arzneimittelfläschchen, Aspirin, eine Handvoll unbenutzter Einwegspritzen sowie ein paar Packungen Kaugummis zu Tage. Es sah aus, als hätte er vor kurzem eine Apotheke, oder zumindest einen mittelgroßen Medizinschrank ausgeräumt.
Seine rechte Tasche hingegen hielt etwas bereit, das ich eindeutig als ‚unangenehme Überraschung’ bezeichnen würde. Tief im Innenfutter vergraben fand ich ein großes Springmesser, das beunruhigend schwer in meiner Hand lag. Das Messer war nicht ganz billig, gut gearbeitet und eindeutig gefährlich, zumindest in den Händen eines unberechenbaren Drogensüchtigen.
Die Umstände betrachtet, war es wahrscheinlich ebenfalls geklaut. Ich stopfte alles in die ausgebeulten Taschen meiner Jacke. Diese Dinge gehörten eindeutig nicht in die Hände eines Straßenjunkies. „Das gehört mir“, schniefte Ferdi und versuchte vergeblich, sich unter mir herauszuwinden. Ich erhöhte den Druck auf seinen Arm. „Ehrlich Ferdi, für wie dumm hältst du mich eigentlich?“, fragte ich, ohne eine Antwort abzuwarten. „Dir ist doch schon bewusst, dass der Besitz von Springmessern verboten ist, oder nicht? Willst du wirklich so sehnsüchtig in den Knast?“
Ferdi heulte: „Das gehört nicht mir! Das bewahre ich nur für einen Freund auf!“
„Soeben hast du noch behauptet, das würde alles dir gehören“, warf ich spitzfindig ein. „Pass auf. Ich schlage dir einen Deal vor: Du beantwortest meine Fragen, und ich werde im Gegenzug vergessen, was ich in deiner Tasche gefunden habe. Einverstanden?“
„Ja, JA!“, wimmerte Ferdi, vermutlich auch, weil ich den Druck auf seinen linken Arm erhöhte.
„Gut“, murmelte ich besänftigt. „Ich suche Tommy; weißt du, wo er ist?”
„Tommy?“, fragte Ferdi und versuchte, möglichst unwissend zu klingen, was in seiner misslichen Lage nur bedingt gelang.
„Du wirst doch noch deinen besten Freund kennen, oder?” Ich wechselte die Strategie und versuchte es auf die sanfte Tour. „Ich fürchte, er steckt in üblen Schwierigkeiten. Ich kann ihm helfen“, bot ich an. „Ich muss nur wissen, wo er steckt.“
Ich bezweifelte, dass Ferdi mir meine geheuchelten Worte tatsächlich abnahm, aber wahrscheinlich halfen sie ihm, sein Gewissen zu beruhigen. Jedenfalls fing er plötzlich an zu plaudern, schnell und hastig wie ein Wasserfall. „Ich habe Tommy schon lange nicht mehr gesehen“, brabbelte Ferdi erstickt in den Asphalt. „Er nimmt an einem Resozialisierungsprogramm teil. Er hat eine Wohnung gestellt bekommen, und einen Sozialarbeiter, der ihm unter die Arme greifen soll.“
„Ach ja?“, fragte ich ehrlich verblüfft. Es war selten, dass einer unserer Spezis tatsächlich den Absprung versuchte. Noch seltener war es allerdings, dass sie es auch schafften. Gerade bei Thomas Becher hätte ich nicht damit gerechnet.
„Weißt du auch wo?“
„Ja! Irgendwo in Bilk!“
Ich stand auf und ließ von Ferdi ab. Lässig klopfte ich mir den Staub von der Jacke.
Ferdi rollte sich wimmernd auf den Rücken und rieb seinen Arm.
„Danke, warum nicht gleich so“, sagte ich freundlich und nickte Ferdis Minigang zum Abschied zu. Sie blickten immer noch angestrengt in eine andere Richtung.
Ferdi schrie mir irgendetwas Unanständiges hinterher, während ich langsam über die großen Vorplatz zur Straßenbahn schlenderte. Es war mir egal, ich hatte meine Antworten von ihm bekommen, mehr Ärger war Ferdi nicht wert.
Thomas Becher versuchte also den Ausstieg. Sehr interessant. Aber irgendwie passte das nicht zusammen. Wenn er wirklich den ehrlichen Weg einschlagen wollte, was hatte er dann in Merkmanns Wohnung zu suchen gehabt? Das war jedoch eine Frage, die nur er beantworten konnte. Ich musste mit ihm sprechen. Als erstes würde ich versuchen müssen, seinen Sozialarbeiter ausfindig zu machen. Der würde mir genau sagen können, wo Thomas Becher untergekommen war. Das Sozialamt sollte mir diese Auskunft geben können, wenn Steinmann sie nicht sogar inzwischen schon erhalten hatte.
In diesem Moment klingelte mein Handy und riss mich aus meinen Gedanken. Die Nummer auf dem Display gehörte Bobby.
„Hey, Alter!“, begrüßte er mich lachend. Offensichtlich hatte er im Laufe des Tages doch noch seinen Kater überwunden und seine gute Laune wiedergefunden. „Lust auf ein Feierabendbier? Wenn ich noch eine Akte lesen muss, dann drehe ich bald durch!“
„Und? Erfolg gehabt?“
„Nee, bislang nicht“, verneinte er mit mürrischem Unterton. „Es gab zwar ein paar Fälle, in denen Frauen vor Gericht standen, aber in allen Fällen sind sie auch verurteilt worden. Also kein potenzielles Opfer unseres Serienmörders.” Er seufzte laut. „Und bei dir?“
„Tja, ich war ein bisschen erfolgreicher“, prahlte ich. „Offensichtlich nimmt unser Zeuge an einem Sozialprogramm zur Wiedereingliederung teil. Wer hätte das gedacht? Aber heute ist es sowieso zu spät; sein Sozialarbeiter dürfte inzwischen längst Feierabend gemacht haben. Deswegen steht unserem Bier nichts mehr im Wege.“
„Das wollte ich hören, mein Freund! Es warten gefühlt noch ein paar hundert Akten auf mich, die ich durchgehen muss. Du musst mich unbedingt hier rausholen!“, flehte er. „Besser jetzt als später!“
„Geht klar. Treffen wir uns bei Mike?“
„Das ist Musik in meinen Ohren.” Er lachte. „Bis gleich.“
„Oh, einen Moment noch!“, brüllte ich ins Telefon, bevor er auflegen konnte. „Kannst du Steinmann Meldung machen?”
„Kann ich machen. Aber dafür schuldest du mir was. Ein Bier, nein, warte, zwei!“
„Ja, schon gut. Beeil dich lieber.“
Ich seufzte, als ich auflegte. Eigentlich hatte ich mir den Abend anders vorgestellt, aber Sandra hatte mir vorhin per SMS mitgeteilt, dass sie später nach Hause kommen würde. Recherchen zu ihrem ‚Artikel’, wie sie mir in aller Kürze mitgeteilt hatte. Sie nahm das ‚Short’ in ‚Short Message Service’ sehr wörtlich.
Ich steckte mein Handy wieder ein. Ein Abend alleine Zuhause erschien mir wenig attraktiv zu sein. Ein Abend mit einem guten Freund hingegen bot zumindest etwas Ablenkung. Vor allem, da mich Morgen mit Sicherheit ein anstrengender Tag erwarten würde. Thomas Becher war ein etwas härterer Knochen als Ferdi, bei dem gute alte Überzeugungsarbeit und ein gerütteltes Maß an Diplomatie mehr Erfolg versprachen als die bewährte Verhörmethode, die ich bei Ferdi ein paar Minuten zuvor anwenden durfte.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, dass weder gezielte Gewalt, noch diplomatisches Geschick aus Tommy neue Informationen herauspressen würden. Tommys Uhr hatte bereits zu seiner letzten Stunde geschlagen.