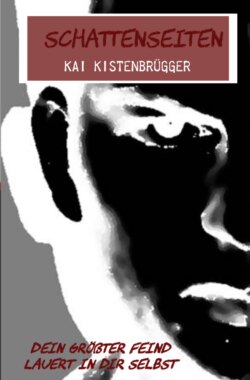Читать книгу Schattenseiten - Kai Kistenbruegger - Страница 18
2 Tage danach
ОглавлениеAm liebsten wäre ich auf ewig im Krankenhaus geblieben, obwohl ich aus medizinischer Sicht als entlassungsfähig eingestuft worden war. Solange ich in meinem Krankenhausbett lag, mit dem stechenden Geruch von Antiseptika in der Luft und dem permanenten, monotonen Gemurmel der Ärzte, Schwestern und Patienten im Hintergrund, konnte ich mich hinter den Betonwänden meiner Krankenstation vor der grausamen Realität verstecken. Das Leben im Krankenhaus folgte den Gesetzen und Regeln einer ganz eigenen Welt. Herausgerissen aus meinem normalen Leben, wurde mein Tagesablauf plötzlich von den Ärzten sowie durch die Terminpläne meiner Untersuchungen und Behandlungen bestimmt, nur von Zeit zu Zeit durch die regelmäßigen, aber geschmacklich anspruchlosen Mahlzeiten unterbrochen. In dem eng getakteten Krankenhausalltag blieb mir nicht viel Zeit, mich mit mir selbst und mit meinem Verlust zu beschäftigen. Doch als die Ärzte mir meine Entlassungspapiere aushändigten, schubsten sie mich zurück in ein Leben, das diesen Namen nicht mehr verdient hatte. Vor den Türen des Krankenhauses wartete nichts mehr auf mich, worauf ich mich hätte freuen können. Mein Leben lag ausgebreitet in Trümmern vor mir, und ich stand alleingelassen vor den Überresten meiner einstigen Hoffnungen und Träume. Als die Verzweiflung in mir aufwallte, brodelnd wie ein Vulkan, fühlte es sich an, als würde es mich innerlich zerreißen. In meiner Brust wurde ein Kampf ausgefochten, an dessen Ende ich entweder meinen emotionalen Verletzungen erliegen, oder gestärkt aus diesen Erfahrungen heraustreten würde. In diesem Moment wünschte ich mir jedoch nichts sehnlicher herbei, als die alles erstickende, barmherzige Umarmung eines schnellen Todes.
Ich nahm die Straßenbahn zu unserer Wohnung. Um mich herum schnatterten unzählige Stimmen, Pendler, die ihren Weg nach Hause antraten, um ihren Tag behütet zwischen ihren Familien ausklingen zu lassen. Es fühlte sich geradezu pervers normal an, zwischen all den anderen Menschen in der Straßenbahn zu stehen, als wäre ich einer von ihnen. Doch das war ich nicht. Ich hatte niemanden mehr, zu dem ich hätte fahren können, und ich allein trug die Schuld daran. Meine Wohnung bot nichts anderes mehr als schmerzhafte Erinnerungen an Sandra, sowie noch schmerzhaftere Erinnerungen an ihren gewaltsamen Tod.
Ich starrte in ausdrucklose, erschöpfte Gesichter und fragte mich, was die anderen Fahrgäste bei meinem Anblick dachten. Dachten sie überhaupt etwas, irgendetwas? Dachten sie darüber nach, welche Schicksalsschläge ich hatte erleiden müssen, was für ein Leben ich führte, oder sahen sie in mir lediglich einen der ihrigen, einen Pendler auf dem Weg nach Hause, ein anonymes Gesicht in der anonymen Masse? Hatte sich ihr Leben verändert, nur weil mein Leben vollständig aus den Fugen geraten war? Wahrscheinlich nicht. Mein Leid war unbedeutend angesichts der Unendlichkeit des Universums.
Aber warum fühlte es sich nicht so unbedeutend an? Warum musste ich jede Sekunde, jeden wachen Augenblick an Sandra denken, bis es mir das Herz zerriss, und ich fürchten musste, inmitten all dieser fremden Menschen in Tränen auszubrechen? Warum war der Schmerz derart allgegenwärtig, dass die ganze Welt unter einem trüben, grauen Schleier der Verzweiflung verschwamm und jegliche Farbe, jede Freude aus meinem Leben entwichen war? Wie sollte ich noch die Kraft aufbringen, dieses graue, farblose Leben weiterzuleben?
Ich fand keine Antworten auf diese Fragen. In mir klaffte ein tiefes Loch. Ich wusste nicht, womit ich dieses Loch jemals würde füllen können.
Als ich an meiner Haltestelle aus der Straßenbahn stolperte, fühlte ich die Augen der anderen Fahrgäste, wie sie sich in meinen Rücken bohrten und jede meiner Bewegungen verfolgten. Vielleicht hatte ich doch geweint, ohne es selbst zu merken. Ihr Mitleid hielt jedoch mit Sicherheit nicht länger an als ein paar Sekunden. Als die Straßenbahn ihre Fahrt fortsetzte, hatten sie mich wahrscheinlich schon längst vergessen.
Ich vermisste Sandra mit jeder Zelle meines Körpers. Nichts konnte die Schuld von mir nehmen, die wie ein Bleigewicht an meinem Herzen zerrte. In einem nicht enden wollenden Gedankenkarussell fragte ich mich ständig dieselben Fragen. „Warum ist es so weit gekommen? Wann habe ich diese dünne Linie überschritten, hinter der ihr Schicksal unabwendbar geworden und wie eine Lawine unaufhaltsam ins Rutschen gekommen war? Wie sollte es weitergehen? Ja, es war meine Schuld, alleinig meine Schuld! Ich hätte es in der Hand gehabt, der Lawine Einhalt zu gebieten, doch ich hatte den richtigen Zeitpunkt ungenutzt verstreichen lassen, bis unser beider Leben zwangsläufig den Höhepunkt in diesem grausamen Moment finden musste.
Als ich vor der Wohnungstür stand, wurde mir schlagartig bewusst, dass tatsächlich kein Weg mehr zurück in mein altes Leben führte. An der Tür klebte gelb leuchtend ein Polizeiabsperrband, das mir den Weg zurück versperrte, und meine Vergangenheit hinter einem dünnen Klebeband versiegelte. Ich konnte nirgendwo mehr hin, zumindest solange, wie meine Wohnung als offizieller Tatort gebrandmarkt war.
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich vor dieser Tür stand. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte; also blieb ich einfach stehen, bewegungslos, ratlos. Es konnten Minuten, Stunden, aber auch Tage gewesen sein, die ich auf der Schwelle zu meiner Wohnung verbrachte, absolut unfähig, eine Entscheidung zu treffen.
Erst als mir jemand sanft eine Hand auf die Schulter legte, wurde ich aus meiner Trance gerissen. Erschrocken fuhr ich herum, doch der Mensch hinter mir verschwamm hinter einem Vorhang aus Wasser. Ohne es zu merken, hatte ich wieder geweint. Ich wischte mir verschämt die Tränen aus den Augen, bis sich mein Blick so weit klärte, dass ich in dem undeutlichen Schemen vor meinen gereizten Augen Bobby erkannte.
„Ich wusste, dass ich dich hier finden würde“, murmelte er erstickt und starrte auf seine Füße. Er war nicht in der Lage, mir direkt ins Gesicht zu schauen.
„Wo sollte ich sonst auch hin?“, erwiderte ich tonlos und stellte ihm genau die Frage, auf die ich selbst keine Antwort gefunden hatte.
Bobby kannte allerdings die einzige richtig Antwort in dieser Situation: „Du kommst mit zu mir“, stellte er mit belegter Stimme fest, als hätte ich kein Mitspracherecht. „Ich glaube, es ist besser, du bist jetzt nicht alleine.” Er legte seinen Arm um meine Schulter und zwang mich langsam die Treppe des Treppenhauses hinunter.
„Du wirst sehen, wir zwei werden die Situation schon gemeinsam schaukeln. Meine Wohnung ist groß genug für zwei!“ Seine Stimme brach. Ob es meine Trauer war, die ihn zum Schweigen brachte, oder die eigenen, schmerzhaften Erinnerungen an Marie, spielte keine Rolle. Es waren Wochen vergangen, und trotzdem waren seine eigenen Wunden immer noch so frisch wie die meinen. Er hatte lediglich gelernt, sein Leben weiterzuleben, ohne daran zu verzweifeln. Vielleicht würden wir es gemeinsam schaffen, diese schreckliche Zeit hinter uns zu lassen. Irgendwie. Bobby war auf jeden Fall der einzige Mensch, der mir noch geblieben war. Sandra war von mir gegangen, genau wie meine Eltern ein paar Jahre zuvor.
„Du kannst auf dem Sofa schlafen“, nahm er seinen Faden wieder auf, nachdem er ein paar Sekunden seinen eigenen, düsteren Gedanken nachgehangen hatte. „Du kannst so lange bleiben, wie du willst.” Er zuckte mit den Achseln. „Falls es dir nicht ausmacht, neben einem Kerl zu schlafen, kannst du auch die rechte Hälfte vom Doppelbett haben. Glaub mir, die ersten Nächte können sehr einsam sein.” Er versuchte ein Lächeln, das aber lediglich zu einer beängstigenden Grimasse verkümmerte. „Nur Kuscheln ist nicht drin, damit wir uns nicht falsch verstehen!“
„Schon gut“, murmelte ich. „Das Sofa wird seinen Zweck erfüllen.”
Er verfrachtete mich in den Dienstwagen, mit dem er die meiste Zeit herumfuhr. Ich bevorzugte in Düsseldorf die öffentlichen Verkehrsmittel, die mich schneller und sicherer ans Ziel brachten als eine dieser fahrbaren Schuhschachteln, mit denen die Autofahrer sowieso die meiste Lebenszeit stehend im Stau verbrachten. Im Moment war ich allerdings froh, nicht mehr unter die missbilligend glotzenden Augen der Düsseldorfer Straßenbahnbenutzer treten zu müssen. Ich verfolgte mit meinen Augen Bobby, der geknickt ums Auto zur Fahrerseite trottete. Bobby hatte seinen Kummer bisher mit Alkohol ertränkt, aber das war keine Lösung, zumindest für mich.
Ich konnte es mir nicht leisten, mich derart gehen zu lassen, jeder Tag ein weiterer Kampf gegen die eigenen Dämonen, ohne Aussicht auf Besserung. Das war kein Leben. Sandra war tot, ja, aber irgendwie musste ich einen Weg finden, mit meinem Leben ohne sie weiterzumachen. Ich wusste noch nicht wie, aber ich würde es angehen müssen, wie einen Marathonlauf. Ein Schritt nach dem anderen, Meter für Meter. Ich musste in dieser Situation einen klaren Kopf bewahren. Ich musste zurück ins Spiel, wenn ich irgendwie körperlich und geistig heil aus dieser Sache herauskommen wollte. Ich hatte gar keine andere Wahl. Mir blieben nur zwei Optionen: Selbstmord, oder aber die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. Ich war noch nicht so weit, mich selbst umbringen zu wollen, auch wenn ein Teil in mir sich das wünschte.
„Ich will zurück!“, stellte ich mit fester Stimme fest.
„Was?“, fragte Bobby irritiert, während er noch am Sicherheitsgurt herumfummelte. „Was willst du?“
„Der Fall. Ich bin wieder dabei!“
Bobby starrte mich entsetzt an. Seine Hand ruhte auf dem Zündschlüssel, ohne den Wagen zu starten. „Bist du sicher?“, hakte er vorsichtig nach, als würde er auf rohen Eiern tanzen. „Ich meine, Steinmann wird das kaum zulassen. Du bist jetzt persönlich betroffen…“
„Das ist mir egal!“, fiel ich ihm wütend ins Wort. „Vor zwei Tagen wurde meine Frau ermordet! Das ist mein Fall! Ich werde nicht zu Hause sitzen bleiben, während ihr euch auf die Suche nach ihrem Mörder macht. Du hast die Wahl: Entweder hilfst du mir, oder ich mache es alleine.” Ich funkelte ihn böse an.
„Nun gut“, seufzte er. „Ich werde bei Steinmann ein gutes Wort für dich einlegen.” Er drehte sich zu mir um und hob drohend den Finger. „Aber du reißt dich zusammen. Ich werde nicht meinen Arsch für dich hinhalten, wenn du Mist baust! Keine Rachenummer, kein Feldzug! Klar?“
„Alles klar“, sagte ich erleichtert. „Danke, Bobby.”
„Ich hoffe, ich bereue meine Entscheidung nicht“, grummelte er und startete den Motor. „Aber erst einmal wirst du duschen, eine Nacht schlafen. Morgen ist auch noch ein Tag.” Er hielt inne. Mit einer ruckartigen Bewegung drehte er den Zündschlüssel wieder um und würgte den Motor brutal ab. „Da ist noch etwas, was du wissen solltest“, sagte er und ließ seine Hände in den Schoß sinken. „Erik, es gibt keine leichte Art, das zu sagen, deswegen sage ich es geradeheraus.” Er atmete tief ein. Seine rechte Hand krallte sich in seinen Oberschenkel, so dass seine Knöchel weiß hervortraten.
„Sandras Obduktionsbericht ist gestern fertig geworden. Sie ist erwürgt worden. Auf ihrer Brust wurde ein ‚R’ eingeritzt, wie bei den anderen Opfern.” Er atmete jetzt schneller. Ich bekam fast Angst, er würde anfangen zu hyperventilieren. „Da ist aber noch etwas…“, besorgt blickte er mir tief in die Augen, als versuchte er zu ergründen, wie viel ich noch ertragen konnte. Nach ein paar Sekunden schien er zu dem Schluss zu kommen, meiner emotionalen Last noch ein paar Zentner aufbürden zu können; jedenfalls sprach er weiter: „Es ist so“, stammelte er, seufzte tief und sagte: „Kurz vor ihrem Tod hatte Sandra Geschlechtsverkehr.“ Er verstummte, jedoch zu kurz, um reagieren zu können. „Der Gerichtsmediziner hat in ihrem Vaginalgang Sperma gefunden. Und es stammt nicht von dir.“