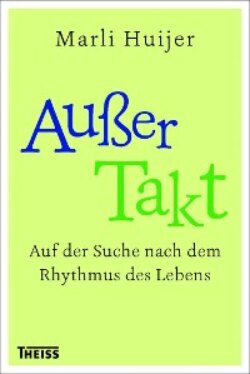Читать книгу Außer Takt - Marli Huijer - Страница 10
Was ist Rhythmus?
ОглавлениеRhythmus kommt vom griechischen Wort rhythmos (ῥuθμός). Es bedeutet so viel wie „periodische Bewegung“ oder „die Ordnung der Bewegung“. Man stelle sich dabei die periodischen Bewegungen beim Tanzen vor, bei denen der menschliche Körper bestimmte Bewegungen ständig wiederholt und gleichzeitig neue Figuren einflicht. Rhythmen bestehen damit aus zwei Komponenten: dem Periodischen, Wiederkehrenden und Sich-Wiederholenden einerseits und der Bewegung oder Veränderung andererseits. Die periodische Bewegung ist keine reine Wiederholung, wie sie bei einem tropfenden Wasserhahn oder einem tickenden Metronom stattfindet. Im Gegenteil: In die Wiederholung wird stets etwas Neues, etwas Unerwartetes, etwas Bewegliches eingebaut.10
Rhythmus gehört zu den Grundprinzipien des Alltagslebens – ein uraltes Prinzip, das sich unter anderem vom Tanz herleitet.11 Doch in Wahrheit ist es noch viel älter und muss in einen Zusammenhang mit den periodischen Bewegungen von Sonne, Mond und anderen Himmelskörpern gebracht werden.
Denker wie Gilles Deleuze, Félix Guattari und Henry Maldiney halten den Rhythmus für das älteste aller Ordnungsprinzipien. Der Rhythmus ist die Form oder die Methode, die für den Übergang vom anfänglichen Chaos zur Ordnung verantwortlich ist.12 Er besitzt eine „kosmogenetische“ Kraft, er ist der „Graupunkt“, das schwarze Loch (das Chaos), der „über sich selbst hinaus“ springt und uns das Licht der Ordnung erkennen lässt, wie der Schweizer Maler und Musiker Paul Klee erklärt, in dessen Arbeiten Rhythmus und Bewegung eine große Rolle spielen.13
Rhythmus ist damit eine Kombination aus Maß und Maßlosigkeit, aus Grenze und Grenzenlosigkeit. Ein Beispiel: Tag für Tag ziehen wir unsere Schuhe an. Zuerst den linken, dann den rechten. Oder umgekehrt. Es wäre merkwürdig, wenn wir zwischen dem Anziehen des einen Schuhs und dem Anziehen des anderen eine Tätigkeit wie das Kaffeekochen oder das Bettenmachen einschieben würden. Das würde die Rhythmik des Schuhanziehens stören. Der Takt des Schuhanziehens – zuerst den einen und dann den anderen – grenzt unsere Handlungen ein, denn während wir die Schuhe anziehen, stellen wir alle anderen Tätigkeiten ein. Dennoch liegt genau in dieser Begrenzung eine Grenzenlosigkeit, wie wir in dem Gedicht „Jeden Morgen“ von Judith Herzberg lesen können:
Jeden Morgen, immerzu
beim Anziehen vom linken und rechten Schuh
sieht er das Leben an sich vorbeifliegen.
Und manchmal bleibt der rechte Schuh dann liegen.14
Die Grenzenlosigkeit (das vorbeiziehende Leben) droht den Takt des Schuhanziehens zu unterbrechen, die Begrenzung des Takts sorgt dafür, dass der rechte Schuh am Ende dann doch angezogen wird.
Unser tägliches Leben ist gespickt mit solchen Rhythmen. Wir stehen jeden Tag ungefähr zur selben Uhrzeit auf, essen zu ähnlichen Zeiten, arbeiten den Tag über oder haben andere Verpflichtungen und gehen dann ungefähr zur selben Uhrzeit wieder ins Bett. Die Summe all dieser Alltagshandlungen ergibt den Rhythmus unseres Lebens. Er strukturiert den Tag, wodurch wir wissen, wann wir was tun müssen, ohne dass wir darüber nachzudenken brauchen. Unbewusst suchen wir auch stets nach einem Rhythmus, den wir als angenehm erfahren. Es fühlt sich gut an, erst den einen Schuh und dann den anderen anzuziehen oder erst Kaffee zu trinken und dann zur Arbeit aufzubrechen.
Haben wir uns erst mal an einem bestimmten Rhythmus in unserem Leben gewöhnt, behalten wir ihn gern bei. Handlungen, die sich immer wiederholen, bringen, auch wenn sie noch so routiniert ausgeführt werden, Ordnung in unser Leben.
Nun könnte man denken, dass es dadurch monoton und langweilig würde, doch dem ist nicht so. Wir können täglich immer wieder dasselbe tun, ohne uns bei dieser Ordnungstätigkeit zu langweilen. Das liegt daran, dass man bei einer Wiederholung zwar etwas verliert, gleichzeitig aber auch etwas gewinnt. Selbst wenn man zehntausend Tassen Kaffee trinken würde, wäre eine nicht wie die andere. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis in exakt derselben Weise noch einmal geschieht, ist so unendlich klein, dass keine zwei Handlungen identisch sind. Unsere Alltagshandlungen mögen sich noch so sehr gleichen, in irgendetwas unterscheiden sie sich stets voneinander.
Sollte in diesen kleinen Variationen, in diesen kaum zu bemerkenden, alltäglichen Neuerungen der Grund dafür liegen, dass Rhythmen unser Leben bunter machen? Das Paradox des Rhythmus ist, dass er durch die Wiederholung sowohl Stabilität schafft als auch Veränderung ins Leben bringt. Durch die ordnungschaffende Wiederholung sind die Dinge weiterhin anwesend und lösen sich auf, bleiben dasselbe und verändern sich zugleich.
Durch dieses Paradox unterscheidet sich der Rhythmus vom monotonen Getrommel, bei dem sich ein Schlag kaum vom anderen unterscheidet. Zwingt uns ein Gerät dazu, stets dieselbe Handlung auszuführen, langweilt uns das. Donnert aus dem Smartphone eines Mitreisenden dauernd derselbe Beat auf uns ein, ärgern wir uns darüber. Doch kaum haben wir selbst dessen Kopfhörer aufgesetzt und bemerken, dass die Wiederholung Variationen aufweist, fällt aller Ärger von uns ab.
Warum haben Rhythmen Einfluss auf uns? Warum empfinden wir Rhythmen, in denen Variationen die Wiederholung und Ordnung unterbrechen, angenehmer als einen Rhythmus, der auf variationsloser Wiederholung beruht? Warum ist uns ein bestimmter Rhythmus angenehmer als ein anderer? Warum wird unser Leben durch den Rhythmus bunter und sinnvoller?
In Judith Herzbergs Gedicht „Jeden Morgen“ gerät der Rhythmus ins Stottern. Zwischen dem Anziehen des linken und des rechten Schuhs zieht das Leben vorbei. Es entsteht eine Pause, eine Lücke. Der Rhythmus des Morgens ist durchbrochen, auf einmal ist alles anders.
Was geschieht eigentlich, wenn Rhythmen anfangen zu stottern, wenn der Strom der Ereignisse, der Tage, Wochen, Jahre miteinander verknüpft, ins Stocken gerät? Steht dann alles still? Gelingt es dann wirklich nicht mehr, den rechten Schuh anzuziehen?
Normalerweise vollzieht sich das Anziehen des zweiten Schuhs vollkommen gedankenlos. Sind wir im Begriff, in die Schuhe zu schlüpfen, überlegen wir uns nicht, wie viel Zeit uns der Vorgang kosten wird und in welcher Reihenfolge wir die einzelnen Handlungsabschnitte auszuführen haben. Es geschieht einfach. Der Rhythmus der Handlungen beruht auf einem Zusammenspiel zwischen Händen, Füßen, Schuhen und Gehirn.
Gelegentlich mischt sich auch der Rhythmus der Umgebung mit ein. Bei Kälte ziehen wir uns die Schuhe schneller an als im Hochsommer.
Rhythmen des Schuhanziehens, aber auch des Ankleidens, des Essens, des Gehens und des Stillstehens drängen sich uns auf, durchziehen unser Leben. Dennoch beachten wir sie kaum, ja sind uns ihrer oft genug nicht einmal bewusst. Doch ändern sich die Rhythmen, geraten ins Stocken oder verlieren ihr Regelmaß – zum Beispiel wenn das Anziehen des rechten Schuhs auszubleiben droht –, dann wird uns bewusst, wie wichtig die Rhythmen sind, die die täglichen Handlungen in eine zeitliche Ordnung bringen.