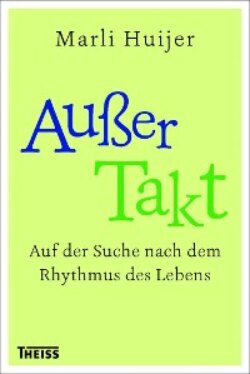Читать книгу Außer Takt - Marli Huijer - Страница 7
Ausblick vom Balkon
ОглавлениеEine ausgezeichnete Methode, sich einen Überblick über Rhythmen zu verschaffen und neue Rhythmen auszuprobieren, bieten die Elements de rythmanalyse des Philosophen Henri Lefebvre (1901–1991). Lefebvre zeigt in dem posthum herausgegebenen und teilweise mit seiner Frau Catherine Régulier zusammen verfassten Buch, wie das Alltagsleben von einer Vielzahl großer (kosmischer, natürlicher, biologischer) und kleiner (alltäglicher, körperlicher) Rhythmen bestimmt wird. Lefebvre und Régulier stellen darin das „rhythmusanalytische Projekt“ vor, das die unterschiedlichsten Rhythmen analysiert – von den Rhythmen der Elementarteilchen bis zu denen der Milchstraße. Das Projekt besitzt einen transdisziplinären Charakter und setzt sich das Ziel, das Wissenschaftliche so wenig wie möglich vom Poetischen zu trennen.2
Das vorliegende Buch will Teil des Projekts werden, das Lefebvre und Régulier begonnen haben. Wer genau hinhört, so schreibt Lefebvre, wird bemerken, dass unser Alltagsleben von zahllosen Rhythmen bestimmt wird. Offen zu sein für diese Rhythmen bedeutet nicht nur, Wörter, Geräusche und Klänge zu vernehmen, sondern auch die Rhythmik von Dingen, Ereignissen und Menschen.
Jede Stadt, jede Straße, jedes Gebäude besitzt einen eigenen Rhythmus. Wer die Rhythmen als Instrument einsetzt, „kann ein Haus hören, eine Straße, eine Stadt, so wie er eine Symphonie oder eine Oper hört“.3
Da sich bis heute kein einziger Philosoph dieses Projekts angenommen hat, tue ich es hiermit. Methodisch folgt daraus, dass ich mich den Rhythmen öffne und sie von innen zu erfahren versuche, wobei ich auch auf bereits gewonnene biomedizinische und philosophische Erkenntnisse zurückgreife.
Rhythmen können äußerlich und isoliert untersucht werden, aber man kann den Begriff des Rhythmus auch als Instrument einsetzen und mit seiner Hilfe das Alltagsleben von innen erforschen. Ein Rhythmus kann nur von innen erfahren und erlebt werden, man muss von ihm erfasst werden, nachdem man sich von allem gelöst hat, und sich ihm hingeben. Aber man muss sich den Rhythmen auch von außen nähern, will man sie wahrnehmen und begreifen – doch sollte die Distanz nicht zu groß sein. Um die Zeitordnung des Alltagslebens zu erkunden, muss man – wie ein Poet oder ein Wissenschaftler – von innen und von außen die Rhythmen des Alltags belauschen.
Um dieses Von-innen-und-von-außen-Belauschen der Rhythmen zu verstehen, bedient sich Lefebvre der Metapher des Balkons, der Ausblick auf eine Kreuzung mehrerer Straßen gewährt. Der französische Philosoph sah vom Balkon seiner Wohnung auf die Pariser Rue Rambuteau hinunter und beobachtete, wie die Fußgänger auf der Straße von einer Fülle an hörbaren Rhythmen überflutet wurden: fahrende oder stehende Autos, Gehupe, Sirenengeheul, sich unterhaltende Fußgänger, Schritte, Ampeln. Er weiß, dass der einzelne Fußgänger diese Geräusche kaum bewusst wahrnimmt.
Auf dem Balkon stehend, isoliert er die verschiedenen Geräusche voneinander und erkennt zahlreiche Strömungen und Rhythmen, die aufeinander einwirken. Er sieht und hört, dass die Fußgänger verstummen, sobald sie die Kreuzung erreichen, um auf die Geräusche und die Rhythmen der anderen Verkehrsteilnehmer zu achten. Während die Autos bremsen und die Fußgängerampel auf Grün schaltet, versuchen sie abzuschätzen, wie lange sie brauchen, um die andere Straßenseite zu erreichen. Sie vergewissern sich schweigend, genug Zeit dafür zu haben, damit sie nicht von den ungeduldig wartenden Autos, Bussen und Motorrädern überfahren werden. Von oben betrachtet, wiederholt sich das Geschehen in einem bestimmten Muster immer wieder – jedenfalls solange es keinen Stau gibt. Es ist ein ständiger Wechsel von Verlangsamung, Stillstand und Sich-wieder-in-Bewegung-Setzen, manchmal aggressiver, manchmal zurückhaltender. Hören und Sehen gehen in dieser Szene eine Harmonie ein; visuelle Rhythmen bilden mit akustischen eine Einheit.
Damit offenbart der Rhythmus seine wichtigste Eigenschaft: Er verbindet alles mit allem, die Schritte der Fußgänger mit der Ampel, ihr Atmen mit den Hupen, die Gespräche mit der Stille. Der Rhythmus richtet die Aufmerksamkeit auf die Pause zwischen den Tönen, aber auch auf den Knall, der die Stille zerreißt. Er betont weniger das künstliche Streben nach Gleichgewicht oder Harmonie, sondern will vielmehr zeigen, wie sich die periodischen Bewegungen von Sonne, Körper, Auto, Smartphone, Musik und Sprache im Alltag vereinigen.
Ich werde mich meinem Thema folgendermaßen nähern: Zunächst wende ich mich im ersten Teil mit dem Titel „Ohne Rhythmen keine Zeit“ dem Verhältnis zwischen Zeit und Rhythmus zu. Was ist mit der Zeit los? Geht alles zu schnell oder fehlt uns die Balance? Was bedeutet der Verlust an gemeinsamer Rhythmik als Folge der allgemeinen Flexibilisierung (Kapitel 1)? Anhand der Frage, ob Zeit als kontinuierlich oder diskontinuierlich zu betrachten sei, will ich darlegen, wie Rhythmus und Zeit voneinander abhängig sind. Dazu betrachte ich die interessante Debatte zwischen den französischen Philosophen Henri Bergson (1859–1941) und Gaston Bachelard (1884–1962) näher: Während Bergson der Ansicht war, dass die Zeit kontinuierlich sei und eine Dauer habe, glaubte Bachelard, sie sei diskontinuierlich und es gebe mehrere jeweils Anfang und Ende besitzende Dauerzustände, die durch Lücken und Brüche voneinander getrennt werden. Die einzelnen, voneinander unabhängigen Dauerzustände verbinden wir mithilfe der Rhythmen und erfahren sie dadurch als Kontinuität. Die Schlussfolgerung daraus ziehe ich dann im 2. Kapitel. Das Verhältnis zwischen den sogenannten linearen und den zyklischen Rhythmen möchte ich im 3. Kapitel näher beleuchten und eine Antwort auf die Frage finden, woraus ein guter Rhythmus besteht und wodurch er gestört wird. Warum weiß fast jeder, was gemeint ist, wenn ein Mann sagt, eine Frau, mit der er Sex hatte, habe keinen guten Rhythmus gehabt?
Der zweite Teil „Ursprung und Funktion von Rhythmen“ behandelt die Ursprünge der modernen Lebens- und Arbeitsrhythmen. Welche Auswirkungen haben religiöse, musikalische, biologische und technologische, das heißt künstlich geschaffene Rhythmen auf die Rhythmik des Alltagslebens? Wie verhält sich in diesem Zusammenspiel der Rhythmen das Verlangen nach Ordnung (das Apollinische, um Nietzsches Begriff zu gebrauchen) zum Verlangen nach Chaos und Exzess (zu dem Dionysischen)? In Kapitel 4 werde ich zeigen, wie die Religion mit ihrer Unterscheidung von heiligen und alltäglichen Tagen die Basis für den rhythmischen Wechsel von Werk- und Feiertagen legte. Im 5. Kapitel vertiefe ich mich in die Wirkung von musikalischen Rhythmen. Rhythmen können magisch sein. Doch können wir diese Magie benutzen, um die Götter in uns und außerhalb von uns zu manipulieren. Im Zentrum des 6. Kapitels steht dann der moderne Begriff des Biorhythmus. Das Interessante an diesem Begriff ist, dass er in vielerlei Hinsicht Parallelen mit den Lebensrhythmen aufweist, wie sie einst die Priester und Astrologen bestimmten. Im 7. Kapitel gehe ich auf die Störungen ein, die von den neuen digitalen Geräten und Apparaten herrühren. Diese Störungen der Rhythmen scheinen jedoch nur vorübergehend zu sein. Die Zeitforschung hat ergeben, dass wir allen Entwicklungen zum Trotz noch immer zwischen 9 und 18 Uhr arbeiten und zwischen 23 und 7 Uhr schlafen.4 Im 8. Kapitel stelle ich mir die Frage, wie die Rhythmen des Körpers sich zu den Rhythmen der Kultur (Religion, Technologie, Wissenschaft, Kunst etc.) verhalten. Sind angeborene Rhythmen besser als angelernte Rhythmen? Oder sollte man zwischen beiden keinen Unterschied machen?
Im dritten Teil „Von alten zu neuen Rhythmen“ werde ich aufzeigen, wie wir sowohl den alten Rhythmen ein neues Gewand verpassen als auch neue Rhythmen erfinden und ausprobieren können. Im 9. Kapitel widme ich mich dann der dressierenden Wirkung von Rhythmen. Michel Foucault beschreibt, wie Körper und Geist durch rhythmisch sich wiederholende Übungen trainiert und kontrolliert werden. Doch derselbe Foucault propagiert die Selbstdressur als Gegengewicht zur Dressur von außen. Im 10. Kapitel mache ich einige Vorschläge, wie man seine Umgebung rhythmisch so gestalten kann, dass Ziele und Wünsche dadurch leichter erreicht werden. Im 11. Kapitel schließlich möchte ich zeigen, dass der Rhythmus des Alltags uns vollkommen selbstverständlich erscheint und dadurch kaum bewusst wahrgenommen wird. Dennoch ist es möglich, dass die Frage „Welcher Rhythmus herrscht gerade?“ in Zukunft relevanter sein wird als die Frage, wie spät es ist.
Was meinen „persönlichen“ Rhythmus angeht: Jetzt, da ich mein Buch beendet habe, tausche ich den regelmäßigen Rhythmus des Schreibens wieder gegen den Rhythmus aus heruntergeschlungenem Frühstück, Metro, Zug, Studenten, Besprechungen, Straßencafé, Kino, Kneipe und meinen Mitmenschen ein. Auch dieser Rhythmus wird nur vorübergehend sein. Die Suche und Aneignung von immer neuen Formen der Disziplin, wie sie meinen Zielen und Wünschen, aber auch meinen Mitmenschen angemessen sind, sind Elemente eines freiheitlichen Lebensrhythmus.