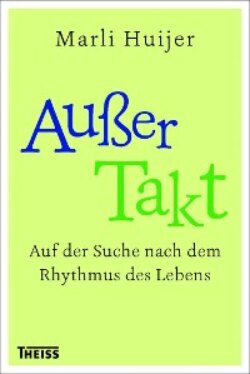Читать книгу Außer Takt - Marli Huijer - Страница 16
Die Zeit anhalten
ОглавлениеWer es gewöhnt ist, unter großem Zeitdruck zu arbeiten und sich von Deadline zu Deadline zu hangeln, weiß, dass es immer wieder Aufgaben gibt, die man einfach nicht rechtzeitig bewältigen kann. Ein unerwartetes Ereignis, ein krankes Kind, ein Freund, der Hilfe braucht, oder eine Beerdigung führen zu Verzögerungen. Manchmal stellt sich eine Aufgabe auch als umfangreicher heraus als anfangs erwartet. Sogar wenn man Tag und Nacht daran arbeiten würde, könnte man die Aufgabe nicht mehr rechtzeitig zu Ende bringen. Doch auch eine Blockade, ein Mangel an Lust oder Kreativität sind Hinderungsgründe.
Jeder kennt das Gefühl, in eine Sackgasse geraten zu sein, nicht mehr weiterzukommen, ungeachtet aller Stunden, die man am Klavier oder am Computer verbringt. Man glaubt, sich von einem Muster nicht mehr lösen zu können. Am liebsten würde man noch mal alles ändern, doch dazu reicht der Wille nicht mehr. Man steckt fest. Aus dieser Lage kann sich nur befreien, wer den Stecker zieht, den Trott hinter sich lässt, innehält oder wie Clive den Alltagsrhythmus durchbricht und sich in einen anderen Rhythmus begibt.
Stimmt das? Muss man wirklich das System, den Alltag oder die Arbeit hinter sich lassen und erst zur Ruhe kommen, bevor man weitermachen kann? Crasht der Computer, hilft es oft, den Stecker zu ziehen, bis zehn zu zählen, neu zu starten – und die Probleme sind gelöst. Funktioniert das auch beim Menschen? Müssen wir den Stecker aus dem Leben ziehen und das System neu starten, um weitermachen zu können?
In der Praxis funktioniert das Anhalten der täglichen Aktivitäten meist nicht so gut. Wer in den Ruhestand geht, bekommt oft gesundheitliche Probleme.27 Auch Sabbaticals haben nicht immer den erwünschten positiven Effekt. Die Unterbrechung, die jemand freiwillig auf sich nimmt, nachdem er eine Zeit lang (zu) hart gearbeitet hat, kann ihn vollkommen aus dem Rhythmus oder dem Gleichgewicht bringen und ihn am Weitermachen hindern. Er kann wie Clive der Ansicht sein, während der Ruheperiode etwas Brillantes geschaffen zu haben, um dann – zurück im normalen Leben – feststellen zu müssen, dass das Ergebnis miserabel ist.
Ist es tatsächlich sinnvoll, die Zeit anzuhalten? Steigert es unser Wohlbefinden, verbessert es unsere Arbeit, stärkt es unsere Menschlichkeit, wenn wir hin und wieder den Alltag hinter uns lassen? Oder ist das Gegenteil der Fall, und alles braucht einen Alltagsrhythmus, eine Zeitordnung, in der sich Augenblicke der Ruhe und der Aktivität durch Wiederholung täglich rhythmisch abwechseln? Erholt man sich nicht besser, wenn man im normalen Leben Ruhepausen einlegt, statt sich vorübergehend ganz aus diesem zu verabschieden?
Eine Anhängerin dieser Idee, dass wir die Zeit anhalten müssen, ist die niederländische Philosophin Joke J. Hermsen. In Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst (Halte die Zeit an. Plädoyer für eine langsame Zukunft) plädiert sie dafür, regelmäßig innezuhalten. Sie fordert, um es mit ihren Worten zu sagen, dass man „sich für kurze Zeit einem zeitlosen Moment hingibt“.28
Das moderne Leben steht unter dem Diktat der Uhr, behauptet Hermsen. Seit Beginn der industriellen Revolution hat die mechanische Uhrzeit uns im Griff und den Blick der Menschen auf sich selbst und auf die Welt stark verändert. Von da an stand die Erhöhung der wirtschaftlichen Rendite im Mittelpunkt: Es soll in immer weniger Zeit immer mehr Arbeit verrichtet werden. Wir hetzen von Deadline zu Deadline, eilen von zu Hause aus zur Arbeit, zum Supermarkt, zum Sportklub und wieder nach Hause. Wir gönnen uns kaum einen Moment der Besinnung, weshalb wir uns auf die Dauer von uns selbst entfremden.
Hermsen sieht keine andere Möglichkeit, als die Tretmühle der Uhrzeit zu verlassen, die Zeit anzuhalten und die Uhrzeiger buchstäblich zum Stillstand zu bringen.29 Dadurch bildet sich ein Intermezzo, in dem etwas Neues entstehen kann: Wir geraten auf ein neues Gleis, kommen auf neue Ideen, erreichen etwas Neues. Das Anhalten der Zeit wird somit zu einem Moment der Kreativität und Innovation, weil man plötzlich mit etwas in Berührung kommt, was Hermsen die „tiefe“ oder die „innere“ Zeit nennt. Diese tiefe, wirkliche Zeit fließt unaufhaltsam dahin und lässt sich im Unterschied zur Uhrzeit nicht in Einzelelemente zerteilen – sie dauert. Zu diesem kontinuierlichen Strom nehmen wir Kontakt auf, wenn wir es wagen, die Zeit zum Halten zu bringen.
Hermsen behauptet, dass beim Anhalten der Zeit etwas Nicht-Existentes die Chance erhält zu werden. McEwans Roman liefert dafür ein Beispiel: Der Komponist lässt sein hektisches Leben in London hinter sich und sucht die Ruhe der Natur, um dort die Melodie zu finden, die sich im Alltag kein Gehör verschaffen kann. Er vernimmt sie erst in der Stille der Zeit. Im zeitlosen Moment erhält die noch nicht existierende Melodie die Gelegenheit zu werden.
Wenn wir die Tretmühle der Uhrzeit verlassen, öffnet sich für Hermsen „ein menschlicher Raum […], in dem man sich von den Gewohnheiten und vermeintlichen Wichtigkeiten des Alltags distanziert“.30 Dieser zeit- und endlose Raum ermöglicht es dem Menschlichen, nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen auf Verborgenes hin abzutasten.31
Die Philosophin sucht ihren Ruheort, wohin sie sich vor der Uhrzeit flüchtet, in der Natur. Darin ähnelt sie Clive. Doch während der Komponist die Stille im Kampf mit den Elementen findet, im Regen, in den steilen Berghängen und den glatten Felsen des britischen Lake Districts, erfährt Hermsen sie in der Hitze Südfrankreichs oder bei einem Bad im Bolsena-See in Italien.
Hermsen greift für ihre Theorie über die Notwendigkeit des Zeitanhaltens auf Henri Bergson zurück. Der französische Philosoph unterscheidet zwischen einer zählbaren Zeit (beispielsweise im Stundenschlag einer Turmuhr) und der psychischen oder inneren Zeit, die man nicht zählen kann. Wie Bergson hält Hermsen die Uhrzeit für eine quantitative und äußere Zeit, die auch räumlich wiedergegeben werden kann, während die innere Zeit in der Tiefe der eigenen Psyche erfahren wird, wo frühere und spätere Augenblicke im Bewusstsein zu einer einzigen Zeit verschmelzen – zur durée, zur Dauer, um einen Begriff Bergsons zu gebrauchen.32
Hermsen nennt diese innere Zeit auch die „andere“ Zeit. Dieses Anders-Sein gründet sich auf zweierlei. Erstens auf den Unterschied von innerer Zeit und Uhrzeit, zweitens darauf, dass die innere Zeit eine Perspektive eröffnet, die so ganz anders ist als die des Hier und Jetzt. Diese Perspektive gewährt Kreativität, Innovation und Freiheit. Wenn es uns gelingt, so Hermsen weiter, „die Zeit zu verzögern und den rationalen Mechanismus in unserem Gehirn zu überwinden“, können wir endlich „unseren Kern, unseren Mittelpunkt“ finden, das heißt „den Ort, der oft vergessen wird, ein einsamer und verlassener Ort und dennoch der einzige, wo Erneuerung möglich ist“.33
Dagegen lässt sich einiges einwenden. Die Behauptung, dass Innovation nicht durch rationales Denken und den Intellekt hervorgebracht werden kann, sondern nur durch dessen Überwindung, ist reichlich gewagt. Es gibt zahlreiche historische Beispiele, die beweisen, dass Innovationen und neue Entwicklungen auf den Intellekt ihrer Urheber zurückzuführen sind wie Einsteins spezielle Relativitätstheorie, Watsons und Cricks Entdeckung der Doppelhelix und Newtons Bewegungsgesetze. Intuition kann bei der Bildung neuer Erkenntnisse durchaus eine wichtige Rolle spielen, aber sie kommt nicht aus dem Nichts, sondern basiert auf bereits erlangtem Wissen, auf früheren Wahrnehmungen oder Erfahrungen. „Novelty emerges only with difficulty, manifested by resistance, against a background provided by expectation“, schreibt Thomas Kuhn (1922–1996) in Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen.34 Seine Forschungen nach der Entstehung neuer Erkenntnisse in der Wissenschaft zeigen, dass sich das Neue nur dem offenbart, der weiß, wonach er sucht.
Auch Hermsens Ansicht, dass das Anhalten der Zeit die einzig mögliche Quelle der Innovation sei, stimmt nicht immer. Es gibt zahllose Geschichten von Leuten, denen die angehaltene Zeit zum Verhängnis wurde. Eine bestimmte Geschichte kursiert in vielerlei Varianten. Sie handelt von einem Mann, der in seiner knappen Freizeit einen Roman schreibt. Es wird ein Bestseller. Daraufhin beschließt er, seinen Job zu kündigen, um seinen Traum wahr werden zu lassen und Vollzeit-Autor zu werden. Täglich setzt er sich nun an den Schreibtisch, zum Schreiben bereit. Doch es geschieht nichts. Obwohl er nun über alle Zeit der Welt verfügt, bringt er keinen Buchstaben zu Papier.
Ähnliche Geschichten erzählen von Wissenschaftlern, die sich für ihr sabbatical year, ihr Freisemester, vorgenommen haben, endlich das längst begonnene Buch zu Ende zu bringen. Oder von den vielen Menschen, die im Ruhestand hofften, nun alle ihre lang gehegten Träume erfüllen zu können. Stattdessen sehen sie ihre Tage vom Alltagskram zerfleddert, der plötzlich viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als vorher.
Dass die angehaltene Zeit nicht zwangsläufig zu Neuerungen oder genialen Einfällen führt, zeigt auch das Ende von McEwans Roman. Clive erlebt in der kolossalen Leere der Natur zwar sein Heureka, doch die brillante neue Melodie erweist sich im Nachhinein nicht als Neuerung, sondern als Plagiat. Er hat sich angesichts der Landschaft an eine früher bereits gehörte Melodie erinnert, jedoch vergessen, dass sie von einem anderen Komponisten stammt.35
Diese Geschichte zeigt auch, dass wir beim Anhalten der Zeit nicht nur den Blick auf die Uhrzeit, sondern auch auf unsere Mitmenschen verlieren. In dem Moment, als Clive die Eingebung der Melodie hat, hört er ein Schreien. Über die Felskante hinabblickend, sieht er, wie ein Mann eine Wanderin überfällt. Doch er hat Wichtigeres zu tun, als der Frau zu Hilfe zu eilen: Er muss seinen Einfall notieren, um ihn nicht zu verlieren. Zurück in London erfährt er, dass die Frau von einem Serienmörder überfallen worden ist.
Bei Hermsen ist das Anhalten der Zeit eine persönliche Angelegenheit. Es geht nur den Menschen selbst etwas an; andere Personen stören dabei nur, vor allem wenn sie von der Zeit etwas abhaben wollen. Hermsen hofft, ihre persönliche, innere Zeit in der Einsamkeit zu finden, in der Abkehr von der „sozialen Zeit“, befreit von Uhren und Terminen.36 In ihrem Essay Windstille der Seele berichtet sie, wie sie drei Tage in einer offenen Dachgaube verbringt und auf eine geniale Eingebung wartet.37 Der Unterschied zwischen der Uhrzeit und der inneren Zeit ist für sie identisch mit dem Unterschied zwischen der sozialen und der persönlichen Zeit. In der sozialen Zeit brauchen wir die Uhr, damit wir uns verabreden können. Ohne Uhr würden wir zu oft auf den anderen warten müssen. Bei der persönlichen Zeit spielt der Mitmensch keine Rolle, man zieht sich tief in das eigene Innere zurück.
Nimmt man jedoch diesen Gedanken Hermsens auf und spinnt ihn weiter, könnte man auch behaupten, dass gerade diese höchstpersönliche Zeit eine Zeit ist, an der alle Anteil haben, vorausgesetzt wir sind bereit, uns ihr zu öffnen. Dann erfahren wir alle in unserem Inneren die „wahre Zeit“ hinter der Uhr, wodurch sich die innere Zeit als etwas Übermenschliches offenbart, als etwas Metaphysisches, Spirituelles – als ein Fluss, in den wir immer wieder von Neuem eintauchen.
Gibt es tatsächlich eine Zeit, die von allen Menschen als Dauer erfahren wird und vielleicht sogar unser Menschsein ausmacht? Das heißt, falls wir sie wahrnehmen. Brauchen wir eigentlich den Glauben an eine ununterbrochene, immer weiterlaufende Zeit? Oder gibt es auch ein lebenswertes Zeitempfinden, ohne dafür die Uhrzeit anhalten zu müssen.
Eine Antwort auf diese Fragen bietet uns Bachelards Zeitphilosophie. Er behauptet, dass die Zeit nicht kontinuierlich, sondern diskontinuierlich verlaufe und dass die Kontinuität, die viele zu erkennen glauben, ein von den Menschen mithilfe von Rhythmen ständig neu gebildetes Konstrukt sei. Das führt zu einem ganz anderen Zeitverständnis als jenes, das sich hinter der Idee vom Anhalten der Zeit verbirgt.