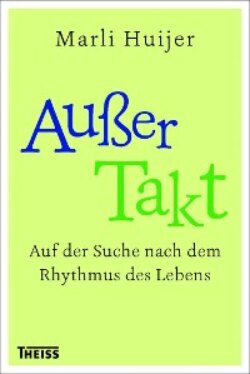Читать книгу Außer Takt - Marli Huijer - Страница 14
Die Bedeutung der Zeit
ОглавлениеDie Erkenntnis, dass Zeit ein Instrument sei, liefert noch keine Antwort auf die Frage, woraus sie ihre Bedeutung bezieht. Die Bedeutung liegt nicht im Instrument. Die Fortbewegung der Uhrzeiger erschafft noch keinen Sinn, und auch die Empfindung, dass etwas kurz oder lange dauert, tut dies nicht.
Zeit wird erst dadurch bedeutsam, dass einem bestimmten Augenblick des Tages, des Jahres oder eines ganzen Lebens – oder dem, was dazwischen liegt – eine Bedeutung zugewiesen wird. Das Datum des 31. Januars 1953 ist an sich ein bedeutungsloses Datum. Bedeutung erlangt es erst dann, wenn wir uns daran erinnern, dass sich in dieser Nacht die große Hollandsturmflut ereignete. Auch das Datum des 11. Septembers 2001 wäre an sich bedeutungslos, würden nicht jedes Mal, wenn wir dieses Datum hören, die einstürzenden Türme des World Trade Centers vor unserem inneren Auge auftauchen.
Die Tage der Woche erhalten ihre Bedeutung dadurch, dass wir ihnen einen Namen oder eine Reihenfolge zuordnen. Wenn unsere Vorfahren den Tagen eine durchlaufende Nummer gegeben hätten, würden sie sich weniger deutlich voneinander unterscheiden, als sie es heute tun. Dadurch, dass man einst die einzelnen Tage mit einem Namen bezeichnete und auch ihrer Verknüpfung zu einem größeren Ganzen einen Namen gab, unterscheidet sich der Montag in seiner Bedeutung vom Mittwoch oder vom Freitag. Mit dem Montag verbinden wir den Anfang der Woche, mit dem Mittwoch deren Mitte und mit dem Freitag ihr Ende. Und am Samstag ist es dann so weit: „Es ist endlich Samstag! Das ist Funtag! Endlich frei!/ Es ist endlich Samstag! Das ist mein Tag! Es ist geil!/ Es ist endlich Samstag! Das ist dein Tag! Das ist mein Tag! Sei dabei!/ Es ist endlich Samstag!“ So heißt es im Titelsong der Jugendserie „Endlich Samstag“.
Im Urlaub fällt dieser Bedeutungsunterschied zwischen den Tagen weg, denn dann unterscheiden sich die Tage im Ablauf nicht groß voneinander.
Die unterschiedliche Bedeutung der verschiedenen Tages-, Wochen-, Jahres- oder Lebenszeiten geht auf den Menschen zurück, selbst wenn sich ändernde natürliche Gegebenheiten für die Unterschiede verantwortlich sind wie bei den Begriffen „Sommer“ und „Winter“. Es ist der Mensch, der den Unterschied zwischen warmen, hellen und kalten, dunklen Tagen feststellt und den dazugehörigen Zeiten eine Bezeichnung zuordnet. Wären alle Tage gleich und verliefen ohne einen merkbaren Unterschied, gäbe es keine unterschiedliche Bezeichnung und Bedeutung der Tage.
Damit ein Datum oder ein bestimmter Zeitpunkt bedeutsam wird, genügt es nicht, ihnen einmalig eine Bedeutung zu verleihen. Einen Sinn ergibt das Ganze erst, wenn man das Spezifische des Moments durch seine Wiederholung hervorkehrt. So feiert man den Geburtstag eines Menschen immer wieder, damit das Datum in Erinnerung bleibt. In den Niederlanden wird jedes Jahr der vierte Mai feierlich begangen, um dabei der Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken. Wir bezeichnen den 11. September 2001 als „nine-eleven“, damit die Toten des Angriffs auf das WTC nicht in Vergessenheit geraten. Die Unterschiede zwischen den sieben Tagen der Woche, zwischen den zwölf Monaten des Jahres, zwischen Kriegs- und Friedensjahren, zwischen „goldenen“ und weniger glanzvollen Jahrhunderten werden immer wieder betont, damit deren Bedeutung nicht verloren geht.
Und damit sind wir wieder beim Begriff des Rhythmus angelangt, einem Begriff, der Wiederholung, Variation und Ordnung in sich vereint. Nicht nur die Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresrhythmen, sondern auch die Rhythmen der Alltagshandlungen markieren durch Differenzierung und Wiederholung das Leben immer wieder neu und verleihen ihm Ordnung und Sinn.
Kommt dem sozialen oder individuellen Leben die Rhythmik abhanden, fallen auch Ordnung und Sinn weg, denn mit der Rhythmik verschwindet die Kennzeichnung der unterschiedlichen Zeitabschnitte und damit ihre Bedeutung. Zwischen Werktagen und Wochenende, zwischen den verschiedenen Jahreszeiten, zwischen Tagesanfang (Morgen) und Tagesende (Abend) gäbe es dann keinen Unterschied mehr.
Dieses Buch soll ein Versuch sein, dem Verlust gemeinschaftlicher Rhythmen entgegenzuwirken. Welche Folgen hat der Verlust solcher Rhythmen? Werden sie durch etwas anderes ersetzt? Welche Rolle spielen soziale Rhythmen heute? Kommt es jedes Mal, wenn Rhythmen unregelmäßig werden, zu antagonistischen Effekten, wie Henri Lefebvre in seiner Studie über die Rhythmen des Alltags behauptet?21 Gerät das gesellschaftliche System in eine Krise, wenn die Ordnung durch den Verlust der Rhythmen gestört wird?
Um Aufschluss über die Rhythmik des modernen Lebens zu erlangen, möchte ich die Rhythmen darstellen, denen das Leben im 21. Jahrhundert unterliegt: Biorhythmen, die Rhythmen der traditionellen und der neuen sozialen Medien, die Rhythmen der Religion, des Körpers, des Geschlechtsverkehrs und der Musik. Wodurch zeichnen sich diese Rhythmen aus? Woher stammen sie? Warum schaffen sie Ordnung? Wo stören Rhythmen einander? Können wir neue Rhythmen schaffen, die den Erfordernissen der modernen Gesellschaft besser angepasst sind? Und zuletzt: Woraus besteht ein guter Rhythmus?
Dieses Buch ist kein Plädoyer für die Rückkehr zu den Rhythmen früherer Zeiten. Solche Rhythmen lassen sich in einer säkularisierten Gesellschaft mit gutem Gewissen nicht vertreten, obwohl bei vielen Menschen, die gläubig erzogen worden sind, eine Sehnsucht nach diesen alten Rhythmen zu spüren ist. Sie ist darauf zurückzuführen, dass die traditionellen Rhythmen sowohl eine ordnende Funktion besitzen als auch eine soziale und spirituelle: Durch sie kann man zu einem höheren oder einem größeren Ganzen Verbindung aufnehmen.
Eine Rückkehr zu alten Rhythmen lässt sich auch deshalb nur mit Mühe verteidigen, weil das Geschlechterverhältnis sich so sehr verändert hat. Männer und Frauen sind heute gleichberechtigter als früher, und das wollen nur wenige rückgängig machen. Seit die Frauen auf dem Arbeitsmarkt präsenter sind, ist die Vollzeitarbeit nicht mehr die Regel. Die Rückkehr zur Verteilung, wonach der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, steht nicht mehr zur Debatte. Heute besteht die Herausforderung darin, neue Rhythmen zu schaffen und in die Praxis umzusetzen.
Wir könnten aber auch alte Rhythmen wiederaufleben lassen, und zwar dadurch, dass wir ihnen eine neue Bedeutung zuordnen. Als Beispiel will ich den Sonntagsbrunch nennen. Wer am Sonntagmorgen durch die Cafés im Berliner Prenzlauer Berg geht, findet hier die Ruhe und das Gemeinschaftsgefühl von Freunden und Familienmitgliedern, die sich regelmäßig zum gemeinsamen Frühstück treffen. Dieser Rhythmus war früher von der Messe und dem Gottesdienst besetzt. Ein neuer, gemeinschaftsbildender Rhythmus wie der Cafébrunch kann sich aber nur deshalb etablieren, weil ein kleiner Prozentsatz der Berliner Bevölkerung bereit ist, am Sonntagmorgen zu arbeiten.
Das ist eines der Paradoxa der heutigen Zeitordnung, dass eine Gruppe ihre Freizeit nur dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeinschaftlich verbringen kann, wenn eine andere Gruppe gleichzeitig auf ihre Freizeit verzichtet. Vielleicht muss man ja zwei oder noch mehr feste Ruhezeiten für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen pro Woche einführen. Doch das würde dann wieder die gemeinschaftlichen Pausen beeinträchtigen.
Einige sind der Ansicht, dass das moderne Zeitproblem mit seiner Gehetztheit, dem Zeitmangel und dem Stress durch Entschleunigung gelöst werden könne. Aber Entschleunigung ist kein Gegenmittel gegen den Verlust von Rhythmen. Wie bereits erwähnt, sind „Zeit“ oder Rhythmen an sich weder schnell noch langsam, sondern werden es erst in Bezug auf andere Zeiten oder Rhythmen. Wer die Zeit verzögern oder sogar anhalten will, gibt den Menschen, die täglich mit ungezählten Verpflichtungen konfrontiert sind, keinerlei Hilfe an die Hand. Ein zusätzlicher freier Tag oder ein Sabbatical führen nur dazu, dass die Arbeit liegen bleibt und der Druck nach der Auszeit nur noch größer ist.22 Außerdem ist Schnelligkeit nicht per se eine schlechte Sache, obwohl das viele Vertreter einer neuen Trägheit behaupten.23 Schnelligkeit kann auch vergnüglich sein, vor allem im Wechsel mit der Langsamkeit. Es ist gelegentlich durchaus angenehm, Dinge wie Einkaufen, das Schreiben von ein paar Zeilen oder einer kurzen Mitteilung an jemanden schnell zu erledigen. Auch wenn diese rasch erledigten Tätigkeiten ermüden, so versetzen sie einen auch in Euphorie, das heißt, sie verleihen eine bestimmte Form der Energie, die der Philosoph Gaston Bachelard eine vernunftbetonte Energie, „l’énergie rationnelle“, nennt.24
Vielleicht können unsere Zeitprobleme gar nicht mit großen Konzepten wie Entschleunigung oder dem Anhalten der Zeit gelöst werden, sondern nur mittels vieler kleiner Lösungen, die das Ziel haben, eine Zeitordnung zu schaffen, die unser Leben angenehmer macht.