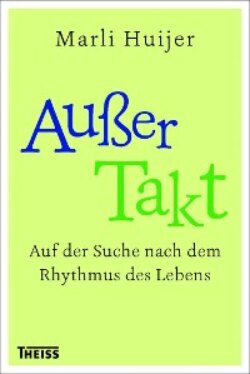Читать книгу Außer Takt - Marli Huijer - Страница 6
Persönlicher Rhythmus
ОглавлениеRhythmus bedeutet Disziplin und Freiheit zugleich. Rhythmus ist die Disziplin, etwas zwei, drei oder hundert Mal zu wiederholen, und sie ist die Freiheit, innerhalb dieser Wiederholung zu improvisieren und Neues zu entdecken. Rhythmus ist die Disziplin eines Schlagzeugers, den Takt zu schlagen, und seine Freiheit, innerhalb dieses sich stetig wiederholenden Schlags Variationen einzubauen. Rhythmus umfasst auch die Disziplin eines Autofahrers, immer wieder dasselbe Stück Autobahn zurückzulegen; gleichzeitig hat er aber auch die Freiheit, dies mit wechselnden Geschwindigkeiten zu tun. Mit anderen Worten: Rhythmus bedeutet, über die Disziplin zu verfügen, jeden Tag dasselbe zu tun, und gleichzeitig die Freiheit zu genießen, stets neue Aufgaben damit zu verknüpfen.
Die Freiheit ist der angenehmere Teil des Rhythmus. Doch ohne die Wiederholung, die die Freiheit erst ermöglicht, könnte diese Freiheit unter Umständen furchtbar langweilig sein.
Während der Monate, die ich an diesem Buch arbeitete, hatte ich mit beiden Aspekten des Rhythmus zu kämpfen. Ich hatte mir einen strengen Arbeitsplan auferlegt: zeitig aufstehen, immer zur selben Zeit, dann an den Schreibtisch, Mittagspause, weiterarbeiten, eine halbe Stunde Sport, essen, ausruhen und schlafen gehen. Sechs Tage lang, dann einen Tag frei. Aber es war Frühling. Herrliches Wetter draußen. Freunde und Freundinnen riefen an, ob ich sie ins Kino, in ein Konzert oder in eine Kneipe begleiten wolle.
Diszipliniert wie ich war, beschloss ich, ihnen ihre Bitten abzuschlagen. Aber es kribbelte in mir: Ich wollte in die Stadt, wollte Menschen treffen, neue Dinge entdecken und hören. Wie konnte ich diesen energetischen Schub aufrechterhalten und trotzdem am Schreibtisch bleiben?
„Sitzen bleiben!“, herrschte ich mich an. Aber mein Körper hörte nur halb zu, meine Muskeln standen unter Strom, das Blut pulsierte in meinen Adern, die Lungen waren gebläht, alles war bereit zu neuen Abenteuern. Dieser Zustand quälte mich vor allem morgens. Kaum war ich wach, war der physische Druck groß, mich rasch anzukleiden, ein Frühstücksbrot herunterzuschlingen und aus dem Haus zu stürmen, um die U-Bahn noch zu erreichen. Meine Körperkonstitution hatte sich meinem bisherigen Lebensstil angepasst, was Geist und Körper ausnehmend gut gefiel. Jeden Tag ereignete sich etwas, auf das ich am Abend mit großem Wohlgefallen zurückblickte, und es war immer etwas anderes. Wie sich an den neuen Rhythmus gewöhnen?
In Richard Sennetts (* 1943) Handwerk las ich, dass jede auf einer Wiederholung beruhende Tätigkeit befriedigend sein kann. Beim täglichen Üben, das jeden Tag etwas länger sein sollte – sei es auf der Geige, im Garten, beim Mauern oder Schreiben –, erfahren wir Befriedigung, wodurch wir mit der Zeit immer länger durchhalten.
Aber als mir klar wurde, dass ich für mein Buch nicht genug Sitzfleisch besaß, überfiel mich Verzweiflung. Statt mich weiter meinem Zeitplan zu unterwerfen, wollte ich lieber auf Reisen gehen.
Nach ein paar Wochen verschwand dieses Gefühl. Auf einmal konnte ich stundenlang still sitzen, ohne mich auch nur eine Minute zu langweilen. Die Wiederholung und die Regelmäßigkeit, die mich anfangs so zermürbten, boten mir jetzt Halt: soundso viele Stunden schreiben, soundso viele Stunden Ruhe. Ohne dass ich es bemerkte, hatte sich auch in mein Arbeiten ein Muster eingeschlichen. Ich zählte die Tage: nach dem freien Tag vier Tage arbeiten, dann konnte ich am fünften Tag den Blick schon wieder auf den freien Sonntag vor mir richten. Dieser Rhythmus wirkte entspannend auf mich. Das Schreiben fing an, mir Spaß zu machen.
Kann man sich auf diese Weise an jeden Lebensrhythmus gewöhnen? Kann sich der menschliche Körper nach wenigen Wochen oder Monaten jedem beliebigen Rhythmus anpassen? Könnten auch wir uns an eine Siesta gewöhnen? Wäre eine Zehn-Tage-Woche denkbar? Schließlich pendeln wir uns nach jedem Jetlag wieder in den veränderten Tag-und-Nacht-Rhythmus ein, stellen uns zweimal pro Jahr auf die Winter- bzw. Sommerzeit um, passen uns dem Rhythmus unseres Geliebten an. Oft genug erweist sich der andere nicht als der Tag- oder Nachtmensch, der man selbst ist. Lässt sich mit etwas Disziplin ein Morgenmensch in einen Nachtmenschen verwandeln und umgekehrt?
Hinter solchen Fragen steht die große Frage nach dem Verhältnis zwischen Natur und Kultur. Der eingefleischte Morgen- oder Nachtmensch ist davon überzeugt, dass der Zeitpunkt, an dem er aufzustehen oder zu Bett zu gehen pflegt, Teil seiner Natur ist. Zur Stützung seiner These verweist er auf die Biologie. Doch wer sich vom Lebensgefährten oder von den Familienmitgliedern gestört fühlt, die früher oder später aufstehen bzw. zu Bett gehen, lässt sich nicht von der Meinung abbringen, das Ganze sei eine Sache des Lernens, und beruft sich auf Argumente aus der Soziologie und der Pädagogik.
Ich selbst gehöre zur Kategorie der „Acht-Stunden-Schläfer“. Gehe ich früh ins Bett, werde ich auch früh wach. Gehe ich spät ins Bett, schlafe ich bis Mittag. Angeblich kommt das nur bei Teenagern oder jungen Erwachsenen vor, doch ich habe die Erfahrung gemacht, dass man schlafen tatsächlich lernen kann. Wenn man sich nach einer kurzen Nacht zwingt, liegen zu bleiben, schläft man von selbst wieder ein – auch wenn man keine achtzehn mehr ist. Die Disziplin des Acht-Stunden-Schlafs verleiht einem die Freiheit, mal ein Morgen- und mal ein Nachtmensch zu sein.
Der Acht-Stunden-Rhythmus ist nur einer unter vielen Rhythmen, nach denen ein Mensch leben kann. Für jedes Ziel, das man sich setzt, gibt es einen passenden Rhythmus. Der niederländische Autor und Übersetzer Guus Kuijer verbringt die Stunden von sieben bis zwölf Uhr morgens am Schreibtisch, an sieben Tagen der Woche, um in aller Ruhe seine Neuübertragung des Alten Testaments voranzutreiben.1 Eine bekannte niederländische Nachrichtensprecherin arbeitete bis vor wenigen Jahren eine Woche lang als Moderatorin und ging in der nächsten Woche ihrem Zweitberuf als Fotografin nach. Durch diesen Rhythmus gelang es ihr, zwei Dinge nicht nur parallel, sondern auch gut zu tun.
Einen solchen selbst auferlegten Rhythmus können wir als eigenen oder persönlichen Rhythmus bezeichnen. „Eigen“ im doppelten Sinne: Wenn jemand sich einen Rhythmus angeeignet hat, ist er ihm eigen geworden. Und zwar so, als wäre er eine zweite Natur. Man kann sich dann kaum noch vorstellen, dass es je anders gewesen ist. Trotzdem ist dieser Rhythmus angelernt.
„Persönlich“ heißt nicht zwangsläufig, dass man der Einzige mit dem betreffenden Rhythmus ist, auch nicht, dass man ihn sich unbeeinflusst von anderen aneignet. Jeder „persönliche“ Rhythmus ist abhängig von den Rhythmen der Mitmenschen. Guus Kuijers Schreiben wird zusätzlich von den Rhythmen derjenigen bestimmt, die mit ihm zusammenwohnen, -leben oder -arbeiten. Eine Umgebung, die in den Morgenstunden sehr lärmig wäre oder seine Aufmerksamkeit beanspruchte, würde seiner Arbeit nicht förderlich sein. Es sei denn, er hätte diesen Umstand in seinem Rhythmus mit berücksichtigt. Die Nachrichtensprecherin konnte ihren Rhythmus nur deshalb einhalten, weil Kollegen beim Sender ihre Arbeit während ihrer Abwesenheit übernahmen bzw. freinahmen, wenn sie im Studio anwesend war.
Das bedeutet, dass Rhythmen sowohl Plural und Singular in sich vereinigen. Es gibt eine Fülle von rhythmischen Phänomenen, die das Alltagsleben bestimmen, und es gibt den einzigartigen, singulären „persönlichen“ Rhythmus von Gegenständen und Menschen. Der singuläre Rhythmus (Herzschlag, Schlafrhythmus, Verdauung, Arbeit) wird von den pluralischen Rhythmen beeinflusst, die das Alltagsleben prägen (den Rhythmen der öffentlichen Verkehrsmittel, dem Tag-und-Nacht-Rhythmus, den Ladenschlusszeiten, dem Rhythmus der Jahreszeiten).
Wie das Pluralische nun mit dem Singulären zusammenwirkt, die Disziplin mit der Freiheit, die Wiederholung mit der Erstmaligkeit und die Natur mit der Kultur, davon will dieses Buch erzählen. Wie verhalten sich der Rhythmus der Straßenüberquerung und der Rhythmus der Ampel zueinander? Wie das Zeitregime des Smartphones und der Rhythmus des Schlafs? Werden die religiösen Rhythmen allmählich von den Biorhythmen verdrängt? Auf welche Weise steuern Rhythmen des Sprechens und der Musik unbemerkt unser Verhalten? Lassen sich selbst gesteckte Ziele leichter erreichen, wenn man seinen persönlichen Rhythmus kennt?